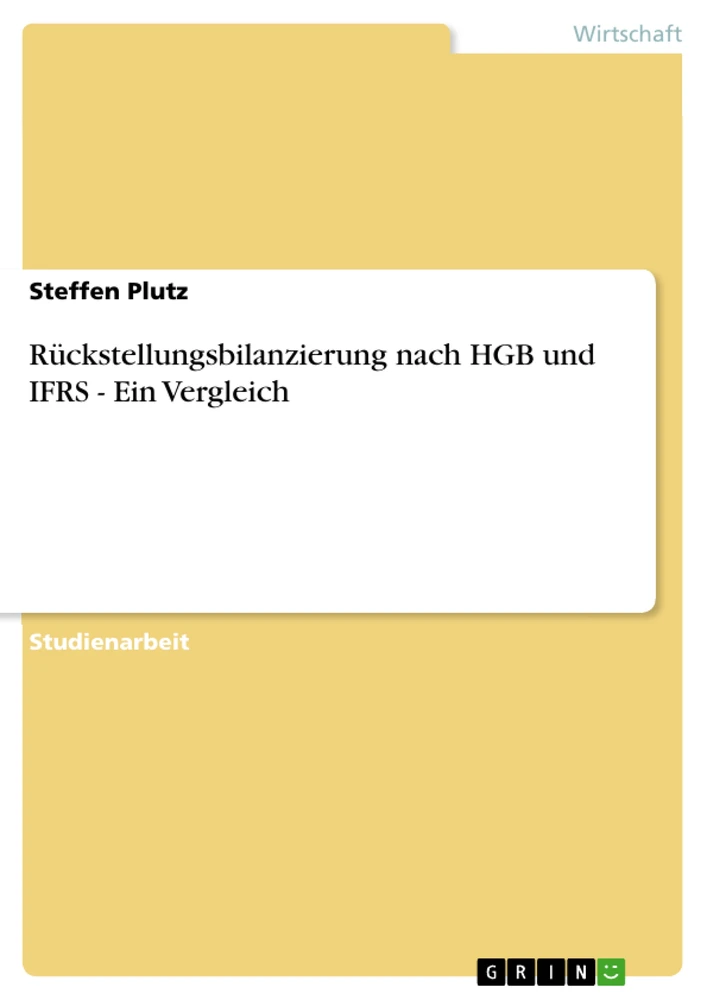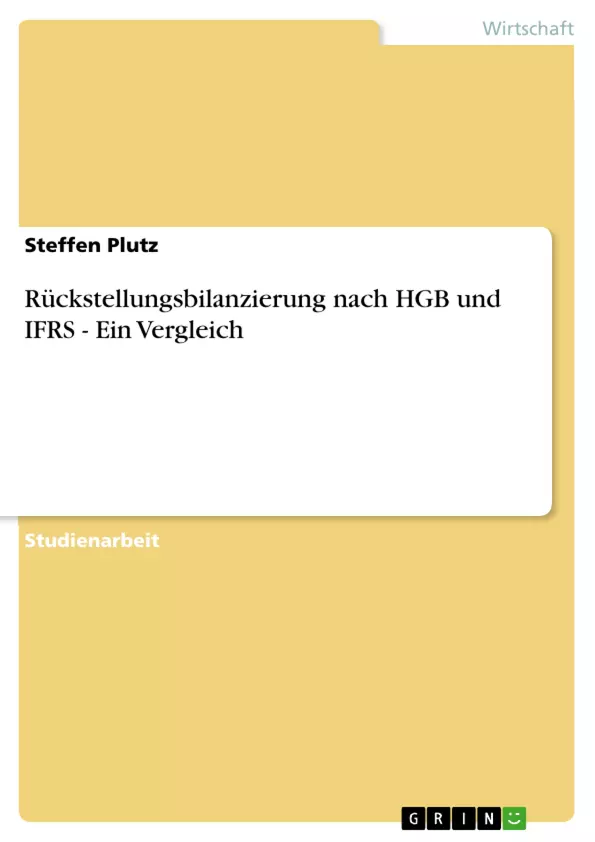„Eine zentrale Aufgabe jeder Rechnungslegung ist, die am Bilanzstichtag bestehenden
Lasten und die damit verbundenen künftigen Ausgaben abzubilden.“ (Binger, 2009, S.1). Die Bilanzierung von Rückstellungen ist aufgrund der Unsicherheit der zugrunde liegenden Verpflichtungen zu einem oft diskutierten Thema geworden. Da das deutsche Bilanzrecht immer mehr durch zunehmende internationale Einflüsse (z.B. IFRS: International Financial Reporting Standards) geprägt ist, kann die Bilanzierung von Rückstellungen nicht nur auf die die Vorschriften des HGB begrenzt werden. Das gemeinsame Kennzeichen von Rückstellungen ist in allen Rechtskreisen, dass Ungewissheit bezüglich der am Bilanzstichtag bereits verursachten künftigen Belastung des Unternehmens besteht (vgl. Federmann, 2010, S.376). Es bestehen jedoch beachtliche Unterschiede nach HGB und IFRS, auf welche im Laufe dieser Arbeit näher eingegangen werden soll.
Da nach einschlägiger Literatur zufolge, Kriterien für Rückstellungen grundsätzlich dem Ansatz nach geprägt sind, soll Innerhalb dieser Arbeit auf die in der Fachliteratur erwähnten Passivierungskriterien/Schlüsselkriterien im Zuge eines grundlegenden Vergleichs der Bilanzierung von Rückstellungen nach HGB (insbesondere nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz) und IFRS eingegangen werden. Dabei soll zunächst der Rückstellungsbegriff näher erläutert und anschließend auf die verschiedenen Arten von Rückstellungen eingegangen werden. Eine vergleichende Zusammenfassung soll den Abschluss der Arbeit bilden. Ziel der Arbeit soll es sein, Schlüsselkriterien, welche für die Passivierungsfähigkeit einer Rückstellung nach HGB und IFRS erfüllt sein müssen, vergleichend darzustellen, sowie konkrete Kriterien/Ausnahmen deren Anwendung anhand aufgeführter Rückstellungen überblicksartig aufzuführen. Da es in der Literatur unterschiedliche Meinungen bezüglich der Ansatz- und Bewertungskonzepte zur Passivierung von Rückstellungen gibt, soll sich hier auf Konzepte einiger ausgewählter Autoren beschränkt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rückstellungen nach HGB
- 2.1 Der Rückstellungsbegriff nach HGB
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Der Begriff der Schuld
- 2.1.3 Rückstellungen nach Außen- und Innenverpflichtung
- 2.2 Arten von Rückstellungen nach BilMoG
- 2.2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
- 2.2.2 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
- 2.2.3 Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung
- 2.2.4 Rückstellungen für Abraumbeseitigung
- 2.2.5 Rückstellungen für Gewährleistungen
- 3. Rückstellungen nach IFRS
- 3.1 Der Rückstellungsbegriff nach IFRS
- 3.1.1 Definition
- 3.1.2 Der Begriff der Schuld
- 3.1.3 Allgemeine Ansatzkriterien
- 3.2 Arten der Rückstellungen nach IFRS
- 3.2.1 IAS 37
- 3.2.2 Drohverlustrückstellungen
- 3.2.3 Restrukturierungsrückstellungen
- 3.2.4 Sonderregelungen
- 4. Zusammenfassung und Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Bilanzierung von Rückstellungen nach HGB und IFRS vergleichend darzustellen. Es werden die Schlüsselkriterien für die Passivierungsfähigkeit von Rückstellungen unter beiden Rechnungslegungsstandards analysiert und konkrete Beispiele aufgeführt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der jeweiligen Definitionen, Arten und Ansatzkriterien.
- Vergleich der Rückstellungsbegriffe nach HGB und IFRS
- Analyse der Kriterien für die Passivierungsfähigkeit von Rückstellungen
- Untersuchung verschiedener Arten von Rückstellungen unter HGB und IFRS
- Aufzeigen von Unterschieden in der Anwendung der Standards
- Zusammenfassender Vergleich der Ansatz- und Bewertungskonzepte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Rückstellungsbilanzierung ein und hebt die Bedeutung der Abbildung zukünftiger Ausgaben im Rahmen der Rechnungslegung hervor. Sie betont die wachsende Bedeutung internationaler Standards wie IFRS im deutschen Bilanzrecht und die Notwendigkeit eines umfassenden Vergleichs der Bilanzierung von Rückstellungen nach HGB und IFRS. Der Fokus liegt auf den Unterschieden trotz des gemeinsamen Kennzeichens der Ungewissheit bezüglich der künftigen Belastung. Die Arbeit kündigt den Vergleich der Passivierungskriterien an und benennt die methodische Vorgehensweise.
2. Rückstellungen nach HGB: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Rückstellungsbegriff nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), insbesondere im Kontext des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Es analysiert die Definition von Rückstellungen, beleuchtet den Begriff der Schuld und differenziert zwischen Außen- und Innenverpflichtungen. Die verschiedenen Arten von Rückstellungen nach BilMoG werden detailliert beschrieben, wobei die jeweiligen Kriterien und Ausnahmen für die Passivierung im Fokus stehen. Das Kapitel stützt sich auf einschlägige Literatur und zeigt die unterschiedlichen Interpretationen der Ansatz- und Bewertungskonzepte auf.
3. Rückstellungen nach IFRS: Analog zum vorherigen Kapitel, konzentriert sich dieser Abschnitt auf die Bilanzierung von Rückstellungen nach den International Financial Reporting Standards (IFRS). Er beschreibt den IFRS-konformen Rückstellungsbegriff, definiert den Begriff der Schuld und erläutert die allgemeinen Ansatzkriterien. Die verschiedenen Arten von Rückstellungen nach IFRS, einschließlich IAS 37, werden detailliert erörtert, wobei Sonderregelungen und Ausnahmen berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich zu den HGB-Bestimmungen und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Rückstellungen, HGB, IFRS, Bilanzierung, ungewisse Verbindlichkeiten, drohende Verluste, Passivierung, Außenverpflichtung, Innenverpflichtung, BilMoG, IAS 37, Ansatzkriterien, Bewertung, Vergleich, Rechnungslegung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Rückstellungsbilanzierung nach HGB und IFRS
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Bilanzierung von Rückstellungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Rechnungslegungsstandards hinsichtlich der Definition, Arten und Ansatzkriterien von Rückstellungen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Den Rückstellungsbegriff nach HGB und IFRS, die Unterscheidung zwischen Außen- und Innenverpflichtungen, verschiedene Arten von Rückstellungen (z.B. für ungewisse Verbindlichkeiten, drohende Verluste, Gewährleistungen), die Passivierungskriterien nach HGB und IFRS, den Einfluss des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG), den Vergleich der Ansatz- und Bewertungskonzepte unter HGB und IFRS, und spezifische Regelungen wie IAS 37.
Wie werden Rückstellungen nach HGB bilanziert?
Das Dokument beschreibt detailliert die Bilanzierung von Rückstellungen nach HGB, insbesondere im Kontext des BilMoG. Es analysiert die Definition von Rückstellungen, den Begriff der Schuld und die verschiedenen Arten von Rückstellungen nach BilMoG. Die Kriterien und Ausnahmen für die Passivierung werden im Detail erläutert, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interpretationen der Ansatz- und Bewertungskonzepte.
Wie werden Rückstellungen nach IFRS bilanziert?
Ähnlich wie bei HGB, erklärt das Dokument die Bilanzierung von Rückstellungen nach IFRS. Es beschreibt den IFRS-konformen Rückstellungsbegriff, die allgemeinen Ansatzkriterien und verschiedene Arten von Rückstellungen, inklusive IAS 37. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zu HGB und den daraus resultierenden praktischen Konsequenzen. Sonderregelungen und Ausnahmen werden ebenfalls berücksichtigt.
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der Rückstellungsbilanzierung nach HGB und IFRS?
Das Dokument hebt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Definitionen, Arten und Ansatzkriterien von Rückstellungen nach HGB und IFRS hervor. Der Vergleich umfasst die Passivierungskriterien, die Behandlung verschiedener Rückstellungsarten und die jeweiligen Bewertungsansätze. Konkrete Beispiele verdeutlichen die Unterschiede in der Anwendung der Standards.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis des Dokuments?
Relevante Schlüsselwörter sind: Rückstellungen, HGB, IFRS, Bilanzierung, ungewisse Verbindlichkeiten, drohende Verluste, Passivierung, Außenverpflichtung, Innenverpflichtung, BilMoG, IAS 37, Ansatzkriterien, Bewertung, Vergleich, Rechnungslegung.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Die Zielsetzung des Dokuments ist ein vergleichender Überblick über die Bilanzierung von Rückstellungen nach HGB und IFRS. Es analysiert die Schlüsselkriterien für die Passivierung und zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Rechnungslegungsstandards auf.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich der Rechnungslegung und Bilanzierung, die sich mit dem Vergleich von HGB und IFRS auseinandersetzen. Es eignet sich auch für alle, die ein tiefes Verständnis der Bilanzierung von Rückstellungen benötigen.
- Arbeit zitieren
- Steffen Plutz (Autor:in), 2011, Rückstellungsbilanzierung nach HGB und IFRS - Ein Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184591