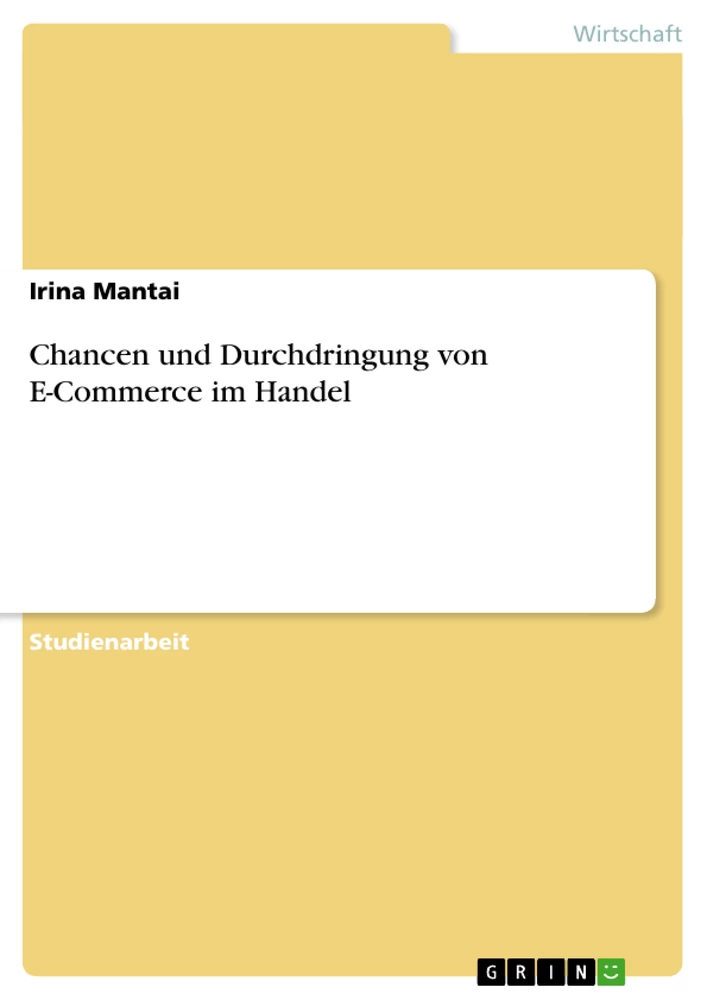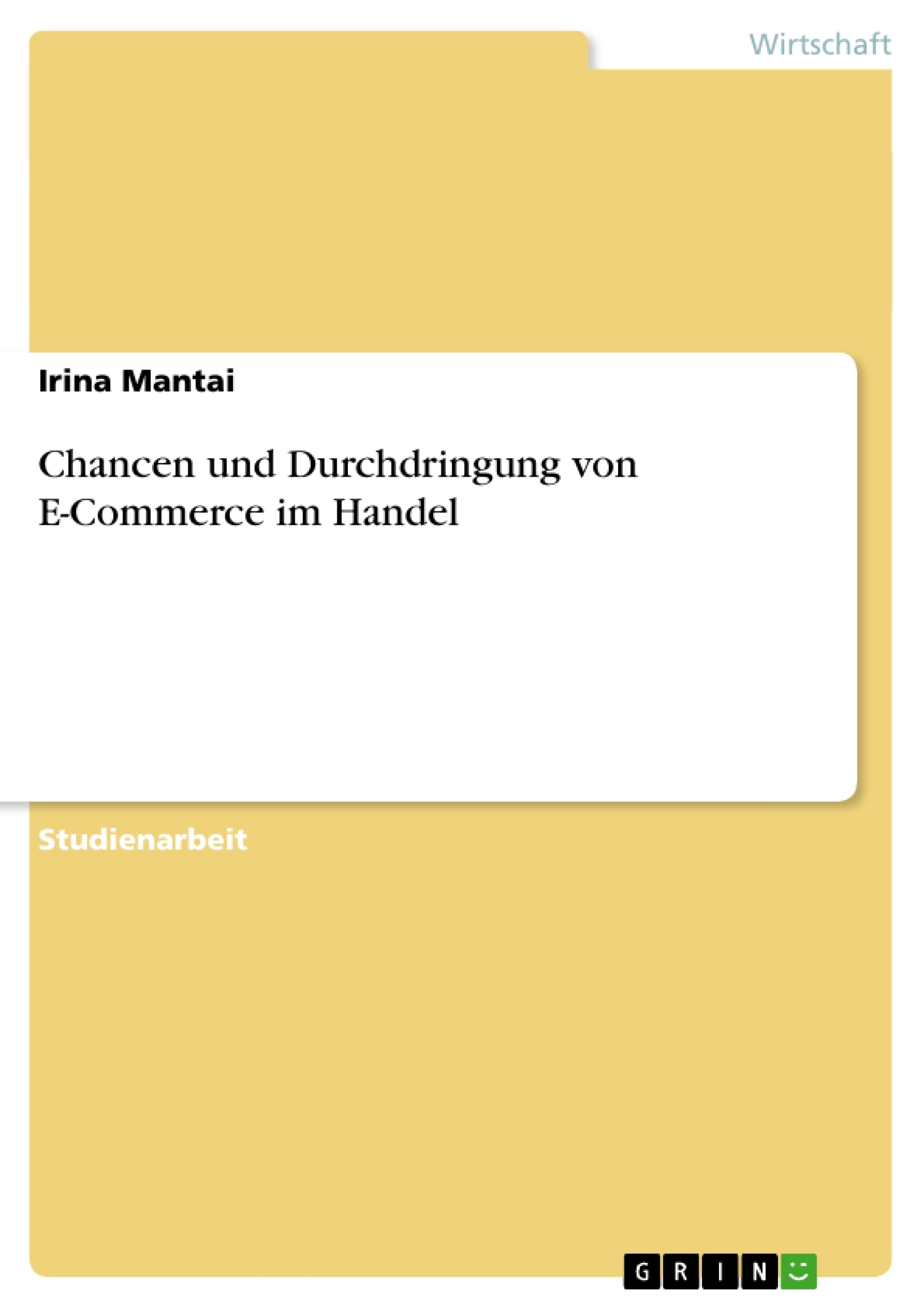Innerhalb kurzer Zeit und mit erstaunlicher Geschwindigkeit haben die neuen Technologien zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Veränderungen geführt. Unsere Gesellschaft verändert sich immer mehr von einer Industriegesellschaft zu einer digitalen Gesellschaft. Dabei spielt die Entwicklung des Internets eine sehr wichtige Rolle. Nur innerhalb von 3 Jahren nach der Einführung des Internets haben 50 Millionen Menschen dieses Medium genutzt. Wie eine Studie aus dem Jahr 2000 belegt, surfte damals in Deutschland jeder Dritte regelmäßig im Internet. Global betrachtet waren rund 250 Millionen Menschen online. 1 Das Internet entwickelt sich zu einem internationalen Treffpunkt. Viele Experten sehen hier den Marktplatz der Zukunft. Dieses Potential haben auch längst viele Unternehmen erkannt. Das Internet wird nicht nur zum Informationsaustausch genutzt. Viele Firmen bieten ihre Produkte bereits in „elektronischen Kaufhäusern“ an. Die elektronische Geschäftsabwicklung wird auch Electronic Commerce genannt. Diese Art von Handel gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mittlerweile existieren rund 1000 E-Marketplätze im Internet, Tendenz steigend. Für das Jahr 2004 wird für Deutschland im Electronic Commerce ein Umsatz von 400 Milliarden Euro prognostiziert. Doch können die Unternehmen blind auf die Prognosen vertrauen und in E-Commerce investieren? Ist Electronic Commerce tatsächlich die Zukunft des Handels?
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Klärung dieser Fragen. Zu Beginn (Kapitel 2.1 ) wird der Begriff des Electronic Commerce definiert und abgegrenzt. Im Kapitel 2.2 werden die verschiedenen Erscheinungsformen des Electronic Commerce kurz erläutert. Im Hauptteil dieser Arbeit ( Kapitel 3 ) wird auf die wichtigen Aspekte dieses Themas, wie Möglichkeiten und Risiken von Electronic Commerce eingegangen.
Den Abschluß bildet das 4. Kapitel. Hier werden die zukünftigen Entwicklungen und Perspektiven von Electronic Commerce besprochen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. E-Commerce – Begriffliche Grundlagen
2.1 Definition E-Commerce
2.2 Erscheinungsformen E-Commerce
2.2.1 Wirtschaftssubjekte im E-Commerce
2.2.2 Art der angebotenen Waren / Dienstleistungen
2.2.3 Phasen einer Handelstransaktion
3. Chancen und Risiken von E-Commerce
3.1 Ziele von E-Commerce
3.2 Vorteile und Nachteile für Konsumenten
3.3 Vorteile und Nachteile für Unternehmen
4. Perspektiven und Trends des E-Commerce
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Markt und Transaktionsbereiche des Electronic Commerce
Abbildung 2: Einsatz des Electronic Commerce in verschiedenen Stufen des Distributionsprozesses
Abbildung 3: Prognose für den Online-Lebensmittelmarkt
1. Einleitung
Innerhalb kurzer Zeit und mit erstaunlicher Geschwindigkeit haben die neuen Technologien zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen geführt. Unsere Gesellschaft verändert sich immer mehr von einer Industriegesellschaft zu einer digitalen Gesellschaft. Dabei spielt die Entwicklung des Internets eine sehr wichtige Rolle. Nur innerhalb von 3 Jahren nach der Einführung des Internets haben 50 Millionen Menschen dieses Medium genutzt. Wie eine Studie aus dem Jahr 2000 belegt, surfte damals in Deutschland jeder Dritte regelmäßig im Internet. Global betrachtet waren rund 250 Millionen Menschen online.[1] Das Internet entwickelt sich zu einem internationalen Treffpunkt. Viele Experten sehen hier den Marktplatz der Zukunft.
Dieses Potential haben auch längst viele Unternehmen erkannt. Das Internet wird nicht nur zum Informationsaustausch genutzt. Viele Firmen bieten ihre Produkte bereits in „elektronischen Kaufhäusern“ an. Die elektronische Geschäftsabwicklung wird auch Electronic Commerce genannt. Diese Art von Handel gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mittlerweile existieren rund 1000 E-Marketplätze im Internet, Tendenz steigend. Für das Jahr 2004 wird für Deutschland im Electronic Commerce ein Umsatz von 400 Milliarden Euro prognostiziert.[2]
Doch können die Unternehmen blind auf die Prognosen vertrauen und in E-Commerce investieren? Ist Electronic Commerce tatsächlich die Zukunft des Handels?
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Klärung dieser Fragen.
Zu Beginn (Kapitel 2.1 ) wird der Begriff des Electronic Commerce definiert und abgegrenzt. Im Kapitel 2.2 werden die verschiedenen Erscheinungsformen des Electronic Commerce kurz erläutert. Im Hauptteil dieser Arbeit ( Kapitel 3 ) wird auf die wichtigen Aspekte dieses Themas, wie Möglichkeiten und Risiken von Electronic Commerce eingegangen. Den Abschluß bildet das 4. Kapitel. Hier werden die zukünftigen Entwicklungen und Perspektiven von Electronic Commerce besprochen.
2. Electronic Commerce – Begriffliche Grundlagen
Der Themenbereich „Electronic Commerce“ ist in den letzten Jahren sehr populär geworden. Es gibt inzwischen zahlreiche Artikel in der Presse zu diesem Thema und auch spezielle Fachbücher über diesen Bereich. Doch der Begriff des Electronic Commerce wird oft unterschiedlich interpretiert.
Daher ist es notwendig den Begriff zu definieren.
2.1 Definition Electronic Commerce
Wie bereits erwähnt gibt es mehrere Definitionsmöglichkeiten von Electronic Commerce. Einige Autoren setzen den Begriff Electronic Commerce dem Begriff Electronic Business gleich. Im Rahmen dieser Arbeit wird diese Meinung nicht vertreten. Electronic Commerce wird hier als ein Teilbereich von Electronic Business betrachtet und nicht als ein Synonym für Electronic Business. Zum besseren Verständnis wird zunächst der Begriff Electronic Business definiert.
Unter Electronic Business versteht man die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien zu Unterstützung aller interne und externer Geschäftsprozesse. Dabei ist nicht nur die Nutzung des Internets gemeint, sondern auch die Nutzung des Faxgerätes, Telefons oder Fernsehgerätes.
Electronic Commerce ist ein Teilbereich von Electronic Business. Hier handelt es sich um den Austausch von Waren, Dienstleistungen, Informationen und Geld über das Internet.[3]
2.2 Erscheinungsformen von Electronic Commerce
In der Praxis ist eine Vielzahl unterschiedlicher Formen von Electronic Commerce bekannt. Um diese Formen besser klassifizieren zu können werden in der Literatur einige Kriterien festgelegt. Diese Arbeit geht auf die 3 wesentliche Kriterien ein:
l Wirtschaftssubjekte im Electronic Commerce
l Art der angebotenen Waren / Dienstleistungen
l Phasen einer Handelstransaktion
2.2.1 Wirtschaftssubjekte im Electronic Commerce
Bei der Einteilung nach den Wirtschaftssubjekten wird danach unterschieden, wer die Marktteilnehmer oder Akteure im Electronic Commerce sind. Die Marktteilnehmer können hier in 3 Gruppen eingeteilt werden: Konsumenten (Consumer), Unternehmen (Business), öffentliche Institutionen (Administration).[4] Nach dieser Einteilung sind folgende Geschäftsbeziehungen möglich:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Markt- und Transaktionsbereiche des Electronic Commerce (Quelle: Hermanns, A.; Sauter, M. (1999) S. 23)
Da nicht alle der obengenannten Geschäftsbeziehungen für den kommerziellen Handel relevant sind, werden hier nur 2 dieser Ausprägungen näher erläutert: Business-to-Consumer (B-to-C) und Business-to-Business (B-to-B).
[...]
[1] vgl. o.V.: in Absatzwirtschaft (12/2000) S.36
[2] vgl. ebenda S.35
[3] vgl. Günther, J.: in Marketing Journal (2/2000) S.104
[4] vgl. Hermanns, A.; Sauter, M. (1999) S. 22
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Electronic Business und Electronic Commerce?
Electronic Business umfasst alle digitalen Geschäftsprozesse (intern und extern), während Electronic Commerce speziell den Austausch von Waren und Geld über das Internet beschreibt.
Was bedeuten die Begriffe B-to-C und B-to-B?
B-to-C (Business-to-Consumer) bezeichnet den Handel zwischen Unternehmen und Endverbrauchern, während B-to-B (Business-to-Business) Transaktionen zwischen Firmen beschreibt.
Welche Chancen bietet E-Commerce für Unternehmen?
Unternehmen können neue Märkte erschließen, Vertriebskosten senken, Prozesse beschleunigen und rund um die Uhr für Kunden erreichbar sein.
Welche Vorteile haben Konsumenten durch Online-Handel?
Konsumenten profitieren von größerer Auswahl, einfacher Preisvergleichbarkeit, Bequemlichkeit beim Einkauf von zu Hause und oft günstigeren Preisen.
Gibt es Risiken beim E-Commerce?
Zu den Risiken zählen Sicherheitsbedenken bei Zahlungen, Datenschutzprobleme, der Verlust des persönlichen Kontakts und die hohe Wettbewerbsintensität im Internet.
Wie sind die Zukunftsaussichten für den elektronischen Handel?
Die Arbeit prognostiziert ein stetiges Umsatzwachstum und eine zunehmende Durchdringung aller Wirtschaftsbereiche durch digitale Kaufhäuser und Marktplätze.
- Quote paper
- Irina Mantai (Author), 2002, Chancen und Durchdringung von E-Commerce im Handel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18462