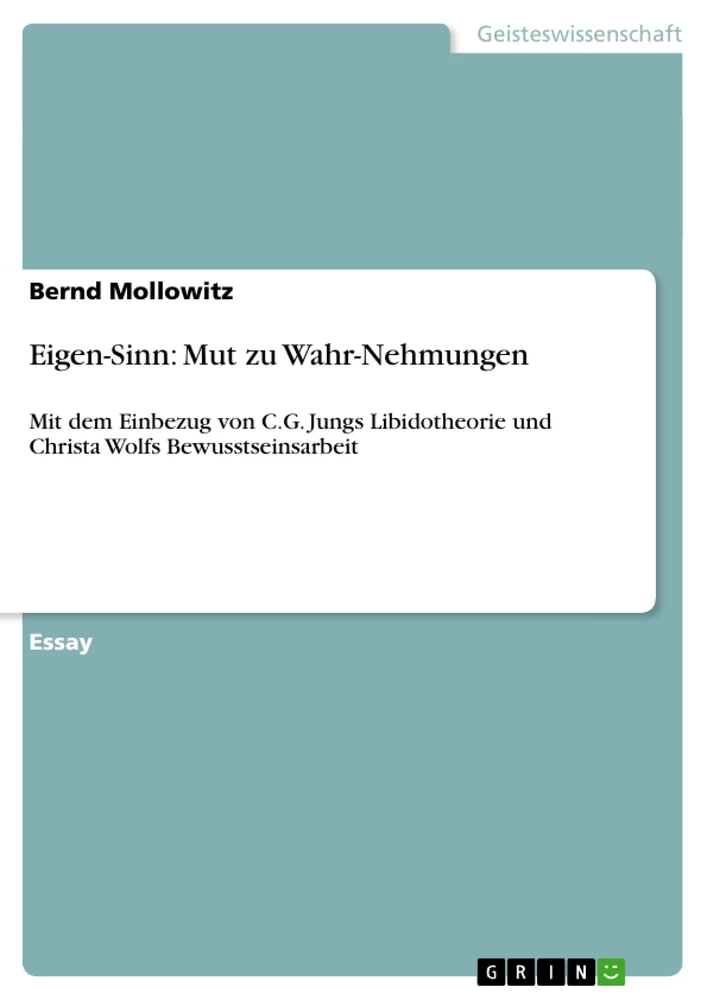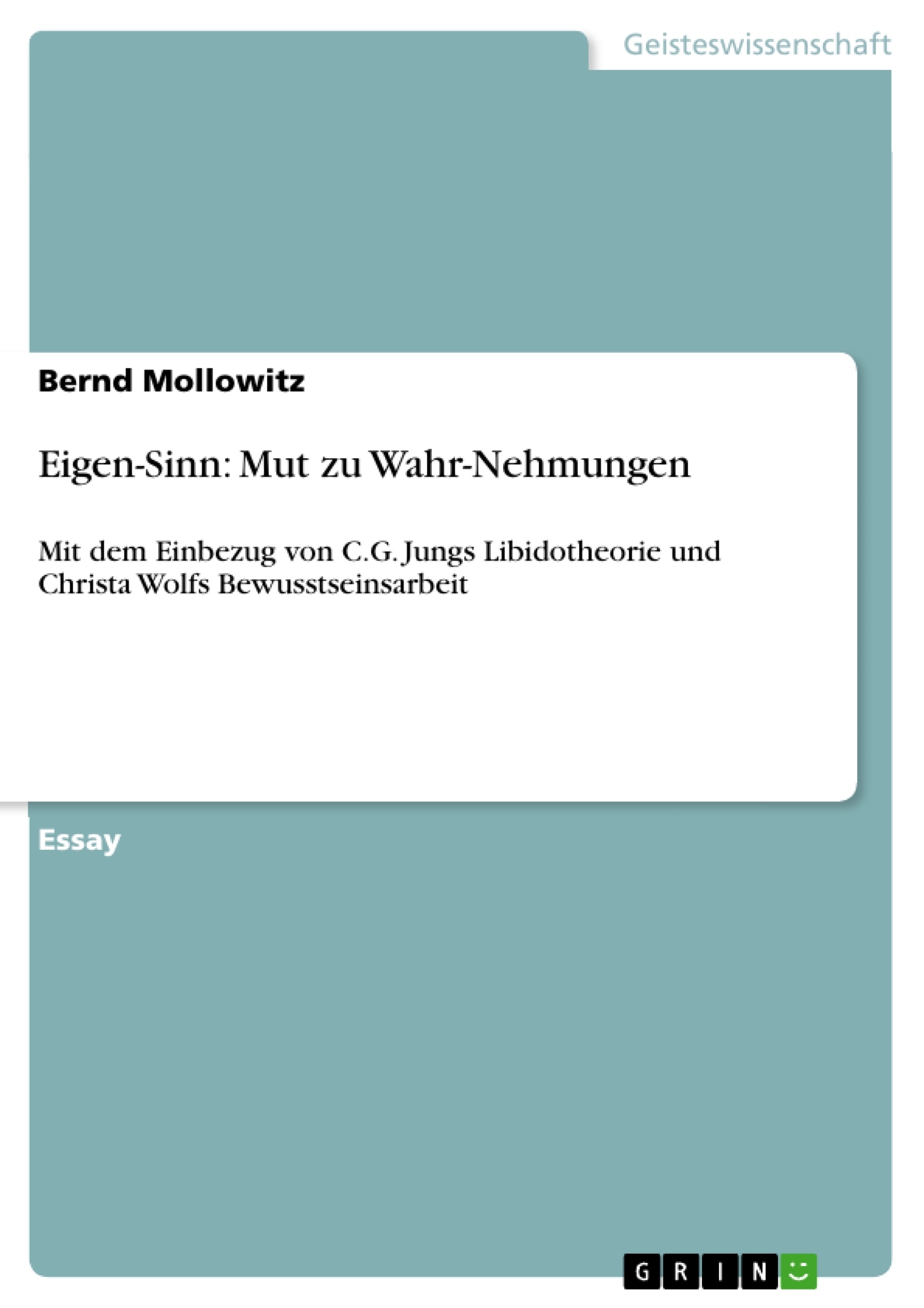Ausgehend von dem Gedanken, dass dem von uns zu lesenden "Text der Welt" labyrinthische Unergründbarkeit zu eigen ist, wird die Zielvorstellung menschlicher Theorie und Praxis im Bild eines "vagabundierenden Denkens" gesehen, das offen und beweglich unterwegs ist zwischen der Orientierung am Eigenen, dessen nicht entfremdeten Wesenskern aufzusuchen unsere Aufgabe ist, und am Maß, das die Anerkennung des Anderen fordert.
Der Text nimmt gedankliche Anleihen bei C.G. Jungs Libidotheorie und Christa Wolfs Bewusstseinsarbeit, die über den "Schmerz der Subjektwerdung" erfolgt.
Ziel des Essays ist es, Mut zu Wahr-Nehmungen zu machen, die helfen sollen, die Deformationen unserer Alltags"realität" aufzuheben.
Reflexion 1 Über den Höhlenmenschen, den Eigen-Sinn und das Maß
Bevor es um inhaltliche Fest-Stellungen geht, sind die erkenntnistheoretischen Voraus - Setzungen zu klären. Die Hermeneutik als die „Lehre vom Verstehen“ rät mir, mich bei einer Argumentation zuerst meiner Vor-Urteile zu versichern, um den Horizont meiner Fragehal- tung (die zugleich den Horizont einer möglichen Antwort absteckt) ins Bewusstsein zu rufen. Als solcherlei den Blick auf die Sache selbst verstellende Vor-Urteile hat schon in der frühen Neuzeit Francis Bacon die Idole, die er als „Götzenbilder“ bezeichnet, benannt. Er zählt deren vier auf : 1) die idola tribus, die allen Menschen als Menschen zukommen; 2) die idola specus, die meine ganz persönliche Sichtweise betreffen; 3) die idola fori, die auf den konven-tionellen Sprachgebrauch zurückzuführen sind; 4) die idola theatri, die aus überlieferten Meinungen und deren Lehrsätzen herrühren.
zu 1) Der menschliche Verstand gleicht einem Spiegel mit unebener Fläche für die Strahlen der Gegenstände, welche seine Natur mit den letzteren vermengt, sie entstellt und verunreinigt. 1 Legt Bacon mit diesem Hinweis die Betonung auf die faktische Entstellung durch unseren Erkenntnisapparat schon beim bloß rezeptiven Aufnehmen der Daten, so ist als weiteres Problem auf die Eigen-Aktivität der Willensentscheidung hinzuweisen : Ich nehme das wahr, was meiner Interessenslage entspricht (bewusst oder unbewusst). 2 Wenn Bacon im weiteren Verlauf seiner Argumentation fordert, dass man diesen Idolen zu entsagen habe, so ist mir nicht verständlich, wie das geschehen soll : Ich kann meinen Erkenntnisapparat nicht verändern, und auf unbewusste Interessensentscheidungen habe ich offensichtlich auch keinen Einfluss. Bacon verweist darauf, dass zum Reich der Wissenschaften kein anderer Eingang sein dürfe als zu dem Himmelreiche, in welches nur in Kindesgestalt einzutreten ge-stattet ist. Ich erlaube mir mit Edgar Wind dagegenzusetzen, dass wir uns nicht rückwärts / ins Paradies zurückstehlen können : das Tor ist verriegelt / und der Engel wacht davor. / Aber der Garten ist vielleicht / am anderen Ende offen. 3 Meint : Wenn ich um die Problematik meiner Wahr-Nehmung als so konstruierter Mensch weiß, kann ich die daraus resultierenden Fehl-Haltungen zwar nicht vermeiden, ich kann dieses Wissen aber bewusst mit in meine Art des Fest-Stellens aufnehmen. Dem entsprechend biete ich hier meine Wahr-Nehmung zum Dialog an.
zu 2) Entsprechendes gilt für meine ganz persönliche Höhle, in der ich aufgewachsen bin und innerhalb derer ich mich fortgebildet habe. Das betrifft meine familiäre Erziehung ebenso wie meine Ausbildung und die zeitgeschichtlichen Einflüsse, denen ich ausgesetzt gewesen bin. Aufgewachsen in einem gut-situierten, liberal eingestellten Elternhaus und ausgebildet durch mein Studium der Literatur und Philosophie, ist mir der Weg geebnet worden in eine weltoffene Einstellung in der Nähe des Hölderlin-Wortes So komm ! dass wir das Offene schauen / Dass ein Eigenes wir suchen / so weit es auch ist. / Fest bleibt Eins; es sei um Mittag oder es gehe / Bis in die Mitternacht, immer bestehet ein Maß, / Allen gemein, doch jeglichem auch ist eignes beschieden, / Dahin gehet und kommt jeder, wohin er es kann. 4 Diese Verse beinhalten schon die Bandbreite der Problematik des Begriffes Eigen-Sinn : Dem allen gemeinen Maß steht Eignes, das jeglichem auch beschieden (was meint : zugesprochen) ist, gegenüber. Dieses Gegenüber-Stehen kann vermittelnd aufgehoben werden in ein Sowohlals auch beider Seiten (so die These dieses Essays), und mit diesem Gedanken stehen wir im methodischen Bereich des dialektischen bzw. polaren Denkens : Zwei Pole, an denen mein Denken als an den Eckwerten einer Bandbreite sich ausbildet, werden der Eigenschaft, bloß statischer Eckwert zu sein, enthoben und kommen über eine bewegliche Wechselwirkung in ein „Gespräch“ miteinander. (Hölderlins „Friedensfeier“ : Seit ein Gespräch wir sind) Dieses Denken wiederum korrespondiert den zeitgeschichtlichen Einflüssen, mit denen ich in Berührung gekommen bin, die man grob als die 68er-Bewegung bezeichnen kann, deren Ziel-Setzung Karl Marx in unnachahmlicher Weise formuliert hat : Seine Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. 5 Das heißt, es geht darum, Entfremdung aufzuheben. Das aber meint : Ist mir Eigenes beschieden, so haben alle Fremd-Bestimmungen eine Ent-Fremdung meiner selbst von mir selbst zur Folge.
Wie der Anspruch des Maßes (als Fremd-Bestimmung) und der Anspruch des Eigenen (als Selbst-Bestimmung) miteinander vermittelt werden können - davon soll in diesem Aufsatz die Rede sein.
zu 3) und 4) Beide Aspekte fallen meiner Meinung nach als Unterpunkte unter 1) und 2). Welche überlieferten Lehrmeinungen mir begegnet sind und welche bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen sind (Aspekt 4), hängt von meiner Höhle ab. Dass Sprache ein zu allgemeines Medium ist, um Konkretes zu erfassen, und dass die eigene Sprache sich nie vollständig von den Gesetzen des Marktes (Aspekt 3) fernhalten kann - dass zudem nach Wittgenstein „die Grenzen meiner Sprache die Grenzen meiner Welt darstellen“ - all das sei bei den folgenden Überlegungen zugestanden und versuchsweise mit eingerechnet bei dem Gedankengang, den ich hier zum Dialog anbiete.
Reflexion 2 Der romantische Höhlenmensch und das Labyrinth, das die Welt ist
Wahr-Nehmungen verdichten sich nicht nur zu theoretischen Überbauten, sondern eben diese Überbauten sorgen schon von sich aus für die Auswahl der Wahr-Nehmungen. So zeigt sich die Theorie, die sich im Laufe der Ausdifferenzierung meines Bewusstseins gebildet hat, in einem dialektischen Wechselspiel mit den zu ihrer Begründung ausgewählten Bau-Steinen. Als ein dialektisches vermittelt dieses Spiel Pole, die zugleich Begrenzungen darstellen (s.o.), innerhalb derer ich mich wahrnehmungsmäßig orientiere, und zugleich eröffnet die beweg- liche Vermittlung (denn Dialektik ist Beweglichkeit) den Weg zum Neuen hin - ins begrenzt Offene also, wenn diese paradoxe Formulierung erlaubt ist.
Welche Bausteine man für sich wählt, so sagt Fichte, hänge davon ab, was für ein Mensch man sei 6. Aus solcherlei Bausteinen also baut man sich seine Welt-Anschauung, und diese sorgt wiederum für die weitere Suche nach Bausteinen. Ich möchte versuchen, meine Steine zu setzen, zu erläutern und in einen gedanklichen Zusammenhang zu bringen. Ich bitte darum, diesen Setzungs-Charakter des Folgenden (um den in methodischer Hinsicht meiner Meinung nach niemand herumkommt) immer mitzureflektieren.
Wenn ich versuchen soll, mein Menschen- und mein Welt-Bild in wenigen Sätzen fest-zu- stellen, so ist es mir wichtig zu betonen, dass ich das menschliche Vorstellungsvermögen mit einer uns unbegreiflich erscheinenden (und für uns damit un-fassbaren) Potentialität begabt sehe, einem Reich unendlicher (besser : uns unendlich erscheinender) Möglichkeiten, aus deren un-ermesslicher Fülle wir nur jeweils (und schrittweise) Teile bewusst er-arbeiten kön- nen. Diese „Teile“ sind im Hegelschen Sinne unwahr (oder besser : repräsentieren, für sich genommen, ein falsches Bewusstsein -7-), da sie erst im Kontext des Ganzen ihre Be-Deutung erhalten, sie sind auf der anderen Seite aber auch unsere ganz eigene Leistung, die (und das sollten wir uns stets bewusst machen) nicht sinn-los sind.
Um das ansatzweise zu verdeutlichen, will ich die Frühromantiker aus Jena, mit der Philo- sophie Fichtes als Muttermilch aufgezogen, zu Zeugen aufrufen : Als Romantiker sprechen sie zwar einerseits von der Sehnsucht nach dem Unendlichen, setzen aber andererseits - aus Selbst-Erkenntnis - im Sinne der romantischen Ironie (man reflektiert die eigene Beschränkt-heit und spielt mit ihr) bewusst die literarische Form des Fragmentarischen ein. Dieser Ein- satz des „bloß“ Fragmentarischen zeigt unsere menschliche Beschränkung und Leistung zugleich : Da das Unendliche wesensnotwendig unbewusst ist (sonst wäre es ja beschränkt und nicht unendlich), ist unsere Auffassung des Unendlichen, betont fragmentarisch einge- schränkt, die einzige Möglichkeit, wie das Unendliche überhaupt in ein Bewusstsein kommen, überhaupt bewusst gemacht werden kann. Wer so denkt und arbeitet, wie die Frühromantiker es in dieser Weise methodisch entwerfen, der leistet einen Dienst durch die Vermittlung zwischen dem Unendlichen und denjenigen Bewusstseinen, die noch nicht um das Unendliche wissen und auch nicht um die eigene Potentialität. Wer denn will, kann in bildlicher Sprache bei dieser Arbeit von einem Gottes-Dienst sprechen.
Auch ich weiß mich in dieser Hinsicht der theoretischen Grund-Legung durch Fichte verpflichtet 8; überzeugende Beispiele aus dem alltäglichen Leben legen nahe, dass unser Bewusstsein nur im sukzessiven Nach-Einander wahr-nehmen kann, dass wir also in jeder Situation (und über sie hinaus) dem unerschöpflichen Angebot potentieller Inhalte begegnen, denen wir uns gegenüber-stellen und aus deren Fülle wir jeweils ein Moment herauslösen und uns zum Gegen-Stand machen. (In diesem „Machen“ liegt der tiefere, entlarvende Sinn der Begriffe „Tat-Sachen“ bzw. „Fakten“.) Dass wir damit weder diesem Gegenstand noch uns im Hinblick auf die immanenten Möglichkeiten beider Seiten gerecht werden, ist nach den Voraussetzungen klar, aber unvermeidlich. Schauen wir auf uns und unser Bewusstsein, so ist es in diesem Moment „besetzt“ (fest-gestellt) durch den jeweiligen Bewusstseinsinhalt und den Ausschluss aller anderen möglichen Inhalte (jede positio ist zugleich negatio), doch können wir diese jeweilige Besetzung transzendieren, indem wir die Bewusstseins-Schranken, in die wir uns notwendig begeben haben (ohne Beschränkung kein Bewusstsein, s.o.), im dialektischen Sinne auf-arbeiten oder auf-heben. Diese Aufhebung negiert die Beschränkung und öffnet sich damit neuen möglichen Besetzungen, er-innert aber die gewesene Beschrän- kung (kein Fort-Schritt ohne das Moment des Konservativen !) und differenziert in diesem Prozess das, was wir unser Bewusstsein nennen, aus auf immer komplexere An-Schauungen hin.
Wenn wir auf der Basis dieses Menschen-Bildes ein übergreifendes Welt-Bild entwerfen wollen, sind auch hier die Grund-Vorstellungen „unerschöpflich“, „offen“ und dennoch „ganzheitlich“ angemessen. Da wir dieses Ganze mit unseren Möglichkeiten nicht ausmessen können, nehmen wir (zur Verdeutlichung des Problems, vor das wir uns gestellt sehen) das Sinn-Bild des Labyrinths, das wir nicht ausloten und in dem wir uns verirren können, zu Hilfe. Wir nehmen (wenn wir das Gesamt dieser Vernetzung auch nicht durch-schauen) an, dass die verzweigten Wege des Labyrinths untereinander vernetzt sind, vergleichbar einem „Gewebe“, einem „textum“, und daher verstehen wir unsere Aufgabe so, dass wir uns bemü-hen sollten zu versuchen, den „Text der Welt“ zu lesen. Dieser „Text der Welt“ erweist sich aber (allem Bemühen zum Trotz) als ein „Buch mit sieben Siegeln“ und dessen Erkenntnisse rühren aus dem Geist der Menschen, „in dem die Zeiten sich bespiegeln“ (Goethe, „Faust“). Die hier formulierte Einsicht ist mir sehr wichtig, dient mir aber weniger als Hinweis auf menschliche Unzulänglichkeit denn als Aufforderung, diesen Leseprozess kreativ und eigen-sinnig fortzuführen mit einem Grundgefühl, das sich der eigenen Bedeutung gewiss und das damit lustvoll besetzt ist.
Reflexion 3 Carl Gustav Jung und sein anstößiges Denken
In diesem Leseprozess (der auf die Musik bezogen auch ein Hör-Prozess und auf die bil- denden Künste bezogen auch ein Schau-Prozess ist) begegnen mir andere Vorstellungsver- mögen und beginnen mit mir einen Dialog. Meiner Auffassung nach ist es nun zwar auch ein Vergnügen, die Vor-Stellungen anderer so korrekt wie möglich auffassen zu wollen (hier haben meine philologischen Freunde ihr Zuhause), bedeutungsvoller aber erscheint es mir, die Impulse, die von anderer Seite kommen, kreativ ein- und weiterzuverarbeiten. So jedenfalls habe ich mein Lehrer-Dasein immer verstehen wollen - mit anderen zusammen Denkanstöße eigen -ständig zu verarbeiten. Und in diesem Sinne habe ich auch die gedanklichen Anregungen Hermann Hesses und Carl Gustav Jungs zur Grund-Lage der Arbeit einer AG ausgewählt.
Diese Wahl sieht sich Fragen ausgesetzt : Wie kann jemand, an dessen Höhlen-Wand (s.o.) die Bilder der 68er-Bewegung ihr anarchistisch-wollüstiges Dasein getrieben haben, ausgerechnet auf „konservative“, angeblich „unpolitische“ Vor-Bilder zurückgreifen ? Denen, die so fragen, sei der vorangegangene Absatz noch einmal zur Lektüre empfohlen : Es kann nicht darum gehen, in ergebener Schüler-Haltung vorgegebene Gedanken zu rezi-pieren, sondern in ihnen enthaltene Aspekte neugierig zur Kenntnis zu nehmen und sie auf die in ihnen enthaltene Kreativität hin zu befragen. Dem, der sich dieser Mühe im Hinblick z.B.
auf einen Denker wie C.G. Jung wirklich unter-ziehen will, sei die umfangreiche Arbeit von Tilman Evers, „Mythos und Emanzipation“ (über das Internet als pdf einsehbar), mit dem sprechenden Untertitel „Eine kritische Annäherung an C.G. Jung“, ans Herz bzw. Hirn gelegt.
Evers verweist auf die kritischen Hinweise der Schüler der „Frankfurter Schule“ und auch Ernst Blochs diesem als Konservativen eingestufen C.G. Jung gegenüber, zeigt in seiner sehr lesbaren Arbeit aber gerade die intensiven Verbindungslinien zwischen den beiden Lagern auf. Den Kritikern kann er den Vorwurf nicht ersparen : ‚Auch Jungs Person und Werk sind ambivalent, und viel hängt davon ab, wie man ihn liest.‘ (S. 4) Nach Evers sollte sich das Augenmerk auf d e n Aspekt des Jungschen Werkes konzentrieren, dessen Anliegen sich richtet auf den ‚zielsuchende(n) Prozess einer unabschließbaren Selbstgestaltung‘, auf die ‚experimentelle Gestaltung eigener Subjektivität‘. Die ‚beharrliche Arbeit an einer lebendigen Subjektivität‘ (und um die gehe es bei C.G. Jung) sei alles andere als unpolitisch, denn in ihr gründe ‚jenes Stück Autonomie, ohne die es kein veränderndes Handeln gibt‘ (S.7). Und : ‚Gerade angesichts des scheinbar unkontrollierbaren Selbstlaufs von Rüstungswahn und Umweltverseuchung, Arbeitslosigkeit und Entdemokratisierung, Kopfverkabelung und Sprachraub halte ich die Freisetzung eigensinniger (Unterstreichung von mir, B.M.) Lebendigkeit für wichtiger denn je. So sehr jedes Quäntchen Gegenmacht gebraucht wird und so sehr die Zeit drängt : Am langen Marsch zu sich selbst führt kein Weg vorbei. Handeln ist nur möglich in dem Maße, wie sich dabei auch die handelnden Subjekte herausbilden.‘ (S.8) (Damit ist Wesentliches gesagt - die weitere Lektüre des Evers-Textes überlasse ich dem interessierten Leser.)
Reflexion 4 Werde-Lust und Selbst
Was aber ist es nun, was hoffen lässt, C.G. Jung für den unter „Reflexion 2“ dargestellten
Ansatz fruchtbar machen zu können ? Warum gerade Jung und nicht seinen erfolgreicheren Lehrer Freud ? In der Literatur wird diese Frage sehr anschaulich beantwortet : „Während die Psychoanalyse das Unbewusste als Rumpelkammer und unaufgeräumten Keller der Psyche ansah, glaubte Jung, das Unbewusste halte Schätze bereit.“ 9 Ohne an dieser Stelle jetzt auf die Rolle des „Unbewussten“ einzugehen, kann doch an Hand dieses Zitates die Verbin- dung der Theorie Jungs mit oben angesprochener Potentialität hergestellt werden, die ja in nichts anderem besteht als in der Bereithaltung noch ungehobener Schätze. Wenn Jung diese Potentialität verbürgt sieht durch eine umfassende (und nicht wie bei Freud auf den Bereich der Sexualität beschränkte) Lebens-Energie, die er Libido nennt, so soll diese Vorstellung als Grund-Baustein übernommen werden. Jung meint nicht nur einen uneingeschränkten, unspe-zifischen Antrieb, sondern sieht in der Libido auch eine Werde-Lust 10.
Bevor auf diese Werde-Lust näher eingegangen werden kann, ist ein erkenntnistheoretischer Hinweis angebracht. Jung ist sich dessen bewusst, dass diese Libido-Vorstellung und der ihr zugrundeliegende Begriff metaphysischer Natur ist : Ich habe deshalb nachträglich in meiner „Darstellung der psychoanalytischen Theorie“ 1913 nachdrücklich erklärt, dass die
Libido, mit der wir operieren, nicht nur nicht konkret oder bekannt sei, sondern geradezu ein X ist, eine reine Hypothese, ein Bild oder Rechenpfennig, ebensowenig konkret fassbar wie die Energie der physikalischen Vorstellungswelt. Libido ist daher nichts anderes als ein abgekürzter Ausdruck für „energetische Betrachtungsweise“. 11 Dieser erkenntnistheoretisch begründeten Einschränkung setzt Jung in seinem Werk verschiedentlich den betonten Hinweis gegenüber, dass er den Aufbau seiner Theorie einer weitreichenden empirischen Erfahrungs-Praxis entlehnt habe. (Wer an dieser „Beweisführung“ Bauchschmerzen hat, der wird nicht zu Unrecht skeptisch sein - er sollte dann aber auch eingestehen, dass in den sog. „rein empirischen“ Wissenschaften noch ganz andere Winde wehen.)
Es bleibt die Frage zu beantworten, zu welchem Ziel denn diese Werde-Lust unterwegs ist. Jung bezeichnet dieses Ziel als Verselbstung (oder auch Selbstverwirklichung) und legt dabei Wert auf die Eigen-Tätigkeit : Es gehe um Selbsterziehung bzw. Selbstvervollkommnung. 12 In diesem Zusammenhang setzt Jung sein zweites erkenntnistheoretisches Ausrufezeichen : In diesen Begriffen verbirgt sich der für Jung zentrale Terminus des Selbst, und dieser Terminus ist nach Jung wiederum nur eine Konstruktion: Intellektuell ist das Selbst nichts als ein psychologischer Begriff, eine Konstruktion, welche eine uns unerkennbare Wesenheit ausdrücken soll, die wir als solche nicht erfassen können, denn sie übersteigt unser Fassungsvermögen. (...) Die Anfänge unseres ganzen seelischen Lebens scheinen unentwirr- bar aus diesem Punkte zu entspringen und alle höchsten und letzten Ziele scheinen auf ihn hinzulaufen. Dieses Paradoxon ist unausweichlich, wie immer, wenn wir etwas zu kenn-zeichnen versuchen, was jenseits dieses Vermögens unseres Verstandes liegt. 13
Der Verstand, die reine Ratio, reicht mit seinen bloßen Begriffs-Setzungen (wie uns Plato in seinem Linien-Gleichnis schon gezeigt hat) nicht hin, um Grund-Legendes zu berühren. Dazu bedarf es - auch nach Plato - des dialektisch orientierten Dialogs, den ein anderes Erkennt-nisvermögen in uns anzustreben sich bemüht. Plato wird es als „Vernunft“ bezeichnen, und Nachfolger werden ihm den Fachbegriff „intellectus“ zuordnen - alles Zuordnungs-Versuche also, man kann es nicht oft genug betonen.
Wenn im folgenden Zitat von einem Postulat die Rede ist, so bleibt das erkenntnistheore tische Dilemma bestehen : ein Postulat sei, so heißt es, eine Vernunft-Forderung. Wer aber versichert uns dessen, was die Vernunft, deren Einsichten als solche nicht erfassbar bzw. setzbar sind, als „vernünftig“ ansieht ? Jung formuliert : Als empirischer Begriff (gemeint sein kann nur : als empirisch verwendeter Begriff) bezeichnet das Selbst den Gesamtumfang aller psychischen Phänomene im Menschen. Es drückt die Einheit und Ganzheit der Gesamtper sönlichkeit aus. Insofern aber letztere infolge ihres unbewussten Anteils nur zum Teil bewusst sein kann, ist der Begriff des Selbst eigentlich zum Teil potentiell empirisch und daher im selben Maße ein P o s t u l a t. Mit anderen Worten, er umfasst Erfahrbares und Unerfahrbares bzw. noch nicht Erfahrenes. 14
Reflexion 5 Der Weg der Individuation und die Arbeit zum Selbst
Es wird Zeit, nach diesen erkenntnistheoretischen Vorüberlegungen die inhaltliche Frage anzugehen, in welcher Hinsicht C.G. Jungs Theorie uns etwas zu sagen hat. Es geht in zentra-ler Hinsicht um eine Lebens-Energie, die wir Libido nennen, mit Hilfe derer wir den noch un-genutzen Bereich unserer Potentialität aufzuschließen versuchen. Da es unsere je eigene Po- tentialität ist, können wir von einem Eigen-Sinn sprechen, der daran orientiert ist, die in unserem Selbst liegenden Möglichkeiten für uns fruchtbar zu machen. C.G. Jung spricht bei diesem angestrebten Prozess vom Weg der Individuation.
Das Kraft-Zentrum dieses Prozesses sozusagen ist das Selbst. Auch wenn diese uns ganz individuell zu eigene, uns Maß gebende und Offenheit anbietende Instanz nach Jung nur eine Konstruktion, bestenfalls ein Postulat ist, drückt sie doch, wie gesagt ist, nichts weniger als die Einheit und Ganzheit der Gesamtpersönlichkeit aus. Als solche ist sie der Ursprung und das Woraufhin unserer Potentialität. Aus ihr geht das bewusste Ich als Teil hervor, und zu seiner Verwirklichung strebt es, unaufhörlich, bis zum Tod, auch wenn das Ich niemals um das es ermöglichende Selbst „weiß“ : Es übersteigt unser Vorstellungsvermögen, uns klarzu machen, was wir als Selbst sind, denn zu dieser Operation müsste der Teil das Ganze begreifen können. 15 Was immer dies Ganze sein mag - Jung sieht dessen Aufgabe in der „Unio oppositorum“, der Vereinigung der Gegensätze, die wir in uns tragen - der Bereich des be- wussten Ich, der Bereich des Unbewussten, der Bereich der Persona (unsere gesellschaftliche Maske) oder der Bereich des „Schattens“, den wir als Ergebnis unserer alltäglichen Verdrän-gungen mit uns herumtragen, werden daran "Teil"-haben.
Es gibt in unseren Tagen eine endlose Diskussion um dieses Selbst - es ist verdächtig geworden, doch greifen seine Kritiker eher die sogenannte „Identität“ der Persönlichkeit an, die es ihrer Meinung nach im Fluss der Phänomene als solche gar nicht gebe. Diese Kritiker - ich verstehe sie nicht - nehmen zwar zu Recht Anstoß an der Setzung einer „res cogitans“, einer denkenden Substanz also, durch den Altvater neuzeitlichen Denkens, René Descartes. Aber wer, allen Ernstes, folgt dieser überholten Setzung heute noch ? Um gut 2000 Jahre älter ist eine weitaus adaequatere Sicht der Dinge durch Heraklit, den Dunklen aus Ephesos. An ihn und seine Philosophie könnte C.G. Jung, der Denker der Polarität, gedacht haben, als er das Selbst als Ganzheit den empirisch fest-stellbaren Einzelausprägungen unserer Persönlich-keit gegenübergestellt hat, und zwar als die all-umfassende Einheit (oder, wie Hölderlin es sagen würde, als Einheit von Identität und Differenz - siehe unten).
Heraklit, der den Fluss der Dinge betont hat (panta rhei - alles fließt), weiß sehr wohl um die zugrunde-liegende Einheit dieses Flusses, und er weiß auch darum, dass „die Anderen“ es nicht wissen (wollen ?) : Sie begreifen nicht, dass es, das All-Eine, auseinanderstrebend zusammengeht wie der Bogen und die Leier. Sowohl der gespannte Bogen vor dem Weg-
schnelles des Pfeiles 16 wie auch das Instrument der Leier bilden symbolisch die sinnstif-tende, zentripetal ausgerichtete Ganzheit, die, wenn sie die gegenstrebigen Kräfte ihrer Teile ausbalanciert hat, sich in einer Art Wohl-Spannung befindet.
Eigen-Sinn meint, das eigene Kraftzentrum dieses Selbst zu suchen (der mittelalterliche Sänger würde von einer Aventiure reden, bei der der Held mehrere Stationen seiner Entwick-lung abarbeitet 17, Haltepunkte sucht und sie doch wieder verlässt aus Furcht, er könnte sich „verligen“), also unablässige Arbeit (durchaus im marxistischen Sinn) an der Aus-Bildung seiner Persönlichkeit zu leisten. Dieser Weg heißt bei Jung Individuation.
Was sucht der Sich-auf-dem-Weg-Befindende ? Jung klärt zunächst einmal ex negativo, was er nicht sucht, indem er die Gegenposition beschreibt : Man wünscht sich das Leben einfach, sicher und glatt, und darum sind Probleme tabu. Man will Sicherheiten und keine Zweifel, man will Resultate und keine Experimente, ohne dabei zu sehen, dass nur durch Zweifel Sicherheiten und nur durch Experimente Resultate entstehen können. 18
Was den voreingenommenen Leser beim Stichwort „Individuation“ auf die falsche Fährte führen mag, ist die Verwechslung des Begriffs mit „Individualismus“ oder gar „Egoismus“.
Jung weist - das Gegenteil betonend - auf die Rolle der Individuation für die Entwicklung eines organisch gewachsenen Kollektivs hin : Die Individuation ist allgemein der Vorgang der Bildung und Besonderung von Einzelwesen, speziell die Entwicklung des psychologischen Individuums als eines vom Allgemeinen, von der Kollektivpsychologie unterschiedenen We-sens. Die I. ist daher ein Differenzierungsprozess, der die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit zum Ziele hat. Die Notwendigkeit der I. ist insofern eine natürliche, als eine Verhinderung der I. durch überwiegende oder gar ausschließliche Normierung an Kollektiv-maßstäben eine Beeinträchtigung der individuellen Lebenstätigkeit bedeutet. Die Individua-lität ist aber schon physisch und physiologisch gegeben und drückt sich dementsprechend auch psychologisch aus. Eine wesentliche Behinderung der Individualität bedeutet daher eine künstliche Verkrüppelung.
Es ist ohne weiteres klar, dass eine soziale Gruppe, die aus verkrüppelten Individuen besteht, keine gesunde und auf die Dauer lebensfähige Institution sein kann; denn nur diejenige Sozietät, welche durch ihren inneren Zusammenhang ihre Kollektivwerte bei größtmöglicher Freiheit des Einzelnen bewahren kann, hat eine Anwartschaft auf dauerhafte Lebendigkeit. Da das Individuum nicht nur Einzelwesen ist, sondern auch kollektive Beziehung zu seiner Existenz voraussetzt, so führt auch der Prozess der I. nicht in die Vereinzelung, sondern in einen intensiveren und allgemeineren Kollektivzusammenhang. 19
Ich habe den Terminus „Differenzierungsprozess“ unterstrichen, weil er zweierlei verdeut-licht : Zum einen wird Wert auf Differenzen gelegt (die Unterschiede, die Eigenheiten, halten den individuellen Menschen wie den sozialen Körper lebendig), zum anderen geht es um die Entwicklung hin zu einer diese Lebendigkeit der Differenzen haltenden Ganzheit, welche also einheits-stiftend wirkt und zugleich die lebendige Beziehung (Polarität) zwischen Identität und Differenzen aufrechterhält. Da die letztliche Einheit, das Selbst, faktisch nicht erreichbar ist, besteht ein lebbarer Ersatz für den einzelnen Menschen darin, vorläufige Stationen anzu-streben, die jeweils ein lebendiges Ganzes, eine Art Fließ-Gleichgewicht, verkörpern, das aber in seiner Labilität von zwei Seiten her in Unruhe versetzt wird : einmal von der Persona her, unserem gesellschaftlichen Masken-Dasein und der „mauvaise foi“, und einmal vom Ziel her, von der aufgegebenen Verwirklichung des Selbst her, von der Ahnung her, noch nicht am Ziel zu sein und daher seine eingenommene „Position“ transzendieren zu „müssen“ (letztere Not-Wendigkeit ergibt sich aus der Ausrichtung auf das angestrebte Ziel hin). Diese Unruhe wirkt produktiv unter dem polaren Wechselspiel zentripetaler und zentrifugaler Kräfte. Nehmen wir das längere Zitat Jungs beim Wort, so müsste uns klar sein, dass zweierlei auf dem Spiel steht : unser eigenes Seelen-Heil und die Verwirklichung der Idee eines sinnstiftenden Kollektivs. Um ihre Ver Wirklichung also geht es, um die Praxis, die jetzt theoretisch hinreichend abgesichert ist. Diese dargestellte Theorie folgt C.G. Jung in seinem Entwurf der Libido, in dem Bild des Selbst und in der Methode der Individuation 20. Letztere besteht im Unterschied zu Jung - meiner Meinung nach nicht primär in einer Aufarbeitung des per- sönlich Unbewussten, sondern eher des „Ungewussten“ durch eine kreative Weiterentwick lung unseres Bewusstseins. Zur Darstellung kann ein Exkurs zu Christa Wolf hilfreich sein.
Reflexion 6 Der Schmerz der Subjektwerdung
Vielleicht ist es uns aufgegeben, den blinden Fleck, der anscheinend im Zentrum unseres Bewusstseins sitzt und deshalb von uns nicht bemerkt werden kann, allmählich von den Rändern her zu ver kleinern, so dass wir etwas mehr Raum gewinnen, der uns sichtbar wird, benennbar wird. Aber, schrieb ich, wollen wir das überhaupt. Können wir das überhaupt wollen. Ist es nicht zu gefährlich. Zu schmerzhaft.
Christa Wolf, Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud 21
Laut Wikipedia bezeichnet der Terminus „Blinder Fleck“ ‚in der Sozialpsychologie die Teile des Selbst oder Ichs, die von einer Persönlichkeit nicht wahrgenommen werden‘. Fragt man nach, warum sie nicht wahrgenommen werden, so wird man auf Verdrängungsmechanismen stoßen. Diese haben eine Schutzfunktion, sind aber als Ausblendungsmechanismen problematisch. Es geht also, vereinfacht gesagt, um Wahr-Nehmungen, die der Wahr-Nehmende nicht wahr-haben will.
Im Zusammenhang meiner Überlegungen versteht der Terminus „blinder Fleck“ sich anders : Es geht um Bereiche (Flecken), die wir „noch nicht“ wahrgenommen haben, in
denen wir „blind“ sind, weil wir unsere Potenzen noch nicht ausgeschöpft haben. Wenden wiruns ihnen zu, geht es also nicht um Korrekturen falscher Selbst-Bilder, sondern um eine echte Bewusstseins-Erweiterung.
Folgen wir in diesem Verständnis dem Wortlaut Christa Wolfs, so ist uns etwas “aufgege-ben” - fragt sich, von wem ? Nach dem in den Reflexionen 1 - 5 Ausgeführten ist die Ant- wort klar : von uns selbst, von dem, was uns wesentlich ausmacht, von unserem Selbst also. Unser Bewusstsein, das ich hier mit dem Ich in der Taghelle des Bewusstseins gleichsetzen möchte, hat viele „blinde Flecke“ in dem Sinne, dass wir etwas noch nicht ins Bewusstsein gehoben haben, was wir hätten heben können. Wird von Christa Wolf in diesem Zitat nun der bestimmte Artikel „den“ gebraucht, wird es um einen bestimmten „blinden Fleck“ gehen, um d e n einen, grund-legenden, der auf dem Grund unserer Persönlichkeit sitzt, um das noch nicht erkannte Selbst, das uns permanent auffordert, uns um es zu kümmern.
Oben ist gesagt worden, dass das Ich das Selbst nicht erfassen, nicht be-greifen kann. Christa Wolf sagt, dass der blinde Fleck anscheinend im Zentrum unseres Bewusstseins sitze. Diese vorsichtige Formulierung ist eine erkenntnistheoretische Absicherung einerseits, ande rerseits der Hinweis, dass man hypothetisch davon ausgehen könne (vgl. Jung : Konstruktion / Postulat).
Der Fleck kann nicht bemerkt werden, weil er nicht er-fass-bar ist; da wir aber im Hin-Blick (das Wort im übertragenen Sinne genommen) auf ihn, wie behauptet wird, eine „Auf-gabe“ haben, machen wir uns auf den Weg, unsere Blindheit zu verringern (verkleinern) . Das soll a) allmählich und b) von den Rändern her geschehen. a) verweist auf den Prozess-Cha-rakter, b) auf die Arbeits-Methode. Wenn ich etwas, das im Zentrum sitzt und offensichtlich nicht erkannt werden kann, von den Rändern her angehe, kreise ich es sozusagen ein. Ich um-kreise es, ich ziehe meine Kreise. Auf diese Weise des Annäherns gewinne ich - als Nebenprodukt meiner Tätigkeit, das sozusagen dabei abfällt - etwas mehr Raum, der uns sichtbar wird, benennbar wird. Was sichtbar ist, kann ich fest-setzen und, so ich will, auch benennen.
Wer dieser Abhandlung bis hierher aufmerksam gefolgt ist, weiß, dass die Ergebnisse dieses Prozesses des Annäherns gar keine „Neben“- oder Abfallprodukte sind, sondern das, worauf (in einem ständig sich ausweitenden Differenzierungsprozess, wie oben dargestellt) mein bewusstes Ich sich aufbaut und sich in eins damit aus-bildet. Ich erhalte Bausteine zum Aufbau meines Selbst-Bildes. Zugleich sollte ich aber um die Vorläufigkeit der Ergebnisse dieses Prozesses wissen; solange ich das Ziel nicht erreicht habe, sind alle Annäherungen (und Bilder) unwahr (vgl. den Hinweis auf Hegel weiter oben). Ist hinwiederum das Ziel (die Erkenntnis des Selbst) nicht erreichbar, habe ich mit den Etappen der Annäherung zu leben, wohl wissend, dass ich das jeweils erreichte Etappen“ziel“ nur als Durchgangsstation anzuse hen habe, die es bewusst zu transzendieren gilt.
Christa Wolf schließt die wesentliche Frage an, ob wir diese Auf“arbeit“ung überhaupt wollten, ja wollen könnten, ob sie nicht zu gefährlich sei, zu schmerzhaft. Ihr fragender Einwand ist nur zu verständlich : Egal, ob der „blinde Fleck“ als Ergebnis eines Verdrängungs prozesses aufgefasst wird oder als apriori gegebenes „Noch-Nicht“ unseres Bewusstseins, eine Ver-Änderung, so not-wendig sie offensichtlich auch ist, betrifft eine grund-legende Änderung unserer Einstellung zu uns und zu dem, was außer uns ist, so dass wir Angst davor haben, uns als Persönlichkeit, die wir jetzt sind, dabei zu verlieren.
Schiller weist in seinen „Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen“ darauf hin, dass die Verhältnisse, unter denen wir alltäglich leben, ein „Gleichgewicht des Schlimmen“
seien, aber immerhin noch ein „Gleichgewicht“; stellte man dieses in Frage, wagte man die bestehende physische Existenz an an bloß mögliches Ideal mit der drohenden Konsequenz, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Können wir das überhaupt wollen ? Bevor diese Gretchen-Frage nicht geklärt ist, brauchen wir uns gar nicht erst auf den Weg zu machen.
Gehen wir trotzdem einfach los in dem naiven Vertrauen darauf, solange wir nur irgendetwas machten, sei das schon ein guter Weg, werden wir keine sinnvolle, reflektierte, an die Wurzel (radix) gehende und damit radikale Lösung finden. Ein bloßes Übertünchen der Probleme, indem wir ihnen einen freundlicheren Anstrich geben, hilft uns nicht weiter. Unsere grell-bunte Medienwelt spiegelt uns eh schon zu lange kindliche Täuschungen vor.
Wollen wires wollen, so haben wir, nach Kant, unsere „Faulheit und Feigheit“ zu überwinden, und wir haben uns uns darauf einzustellen, dass dieses wollen Konsequenzen haben wird, die Christa Wolf als schmerzhaft bezeichnet. Mit diesem Schmerz der Subjekt werdung (eine Formulierung Christa Wolfs) habe ich mich an anderer Stelle ausführlich befasst 22, das soll hier nicht noch einmal thematisiert werden. Entscheide ich mich zu einer Lebensweise, in der ich mich als aktives Subjekt begreife, werde ich den mit dieser Entscheidung verbundenen Trennungsschmerz von meiner bisherigen Persönlichkeit ertragen müssen. Dafür lebe ich aber auch in dem Bewusstsein, nicht passiv alle Konsequenzen einer verdinglichenden Objektivierung durch andere ertragen zu müssen (und in selbstverständlicher Konsequenz : auch andere nicht mehr verdinglichen, zu bloßen Objekten degradieren zu müssen).
Reflexion 9 Die lustvolle Überwindung des „Unbehagens in der Kultur“
Dank seines Reflexionsvermögens hat der Mensch den Kreis der „Naturwesen“ durch brochen und hat die Kultur zu seiner zweiten Natur gemacht. Kommt der Begriff „Kultur“ von lat. „colere“ = „anbauen, pflegen“, so ist der Mensch dasjenige Wesen, das sich seine Welt selbst erarbeitet und -sie pflegend- für sie Sorge trägt (Arnold Gehlen). Das ist ein in jeder Hinsicht aktives Verhältnis zu dem, was ihn umgibt. Er ist der Ausgangspunkt, das zugrundeliegende Subjekt für sein Denken und Handeln, das in voller Verantwortlichkeit je seines ist. Akzeptiert man zudem den in diesem Aufsatz vertretenen Gedanken, so ist der Mensch obendrein mit einer Lebensenergie begabt, die ihm potentiell unerschöpfliche neue Bereiche zur aktiven, kreativen (und phantasie-vollen) Bearbeitung eröffnet.
Denkt man diesem Gedanken zu Ende, so findet diese Aktivität des einen Menschen ihre Grenze an der des anderen. Wenn Freud das „Unbehagen in der Kultur“ im notwendigen Triebverzicht sieht, geht der vorliegende Ansatz von einer not-wendigen Einschränkung der lebensenergetischen Tatkraft aus. Ich kann meine Lebensenergie nicht bedenkenlos ausleben. Wenn ich mich als Subjekt meiner Welt begreife, so habe ich Gleiches auch den anderen Subjekten zuzugestehen, ja, wenn ich es ernst meine, es für sie sogar einzufordern. Ziel ist, um es mit einem Terminus Fichtes zu sagen, eine gesellschaftlich bedingte wechselseitige Limitation. Ich bin dem Anderen die Grenze so wie er die meine. Alles andere würde zu den von Marx weiter oben angesprochenen Entfremdungsverhältnissen führen.
Diese Einschränkung ist schmerzhaft. Schmerzhaft ist aber auch die Einsicht, wenn der Mensch begreift, dass er bisher seine Potenzen nicht ausgeschöpft hat und dass es ihm gut anstehe, wenn er sein bisheriges Leben der Selbst-Täuschungen und Selbst-Entfremdungen ändere. Andererseits kann nicht geleugnet werden, dass der Prozess der Ent-Täuschungen einem Neuanfang gleichkommt, der lustvoll besetzt ist. Erfahre ich den Anderen nicht mehr als den, der mich in meinen Möglichkeiten beschneidet und der mich schlimmstenfalls sogar verdinglicht, sondern erkenne ich in ihm den Partner in einer symmetrischen Interaktion, der mir Impulse für eine Bewusstseinserweiterung geben kann, so ziehe ich aus dieser Art von Interaktion ein beträchtliches Maß an Lustpotential.
Zu Anfang der Arbeit ist angekündigt worden, auf die Vermittlung zwischen dem Anspruch des Maßes und dem des Eigenen zu sprechen zu kommen. Wir hatten im Verlauf der Abhandlung schon gesehen, dass das Selbst an sich selbst schon diese Vermittlung dar- stellt : es ist m e i n Selbst und es i s t, d.h. es besteht als grund-legender Rahmen, als Maß meiner selbst. Hinzu kommt der soeben herausgearbeitete Gedanke : Es geht um die Vermittlung zwischen den Ansprüchen meiner eigenen Subjektivität und der Anerkennung der Ansprüche der Subjektivität der Anderen. Das Eigene und das Maß zu reflektieren, meint nichts anderes als den Aufbau einer Gesellschaft nicht entfremdeter Individuen im Blick zu haben.
Fasse ich zusammen, so ergibt sich das Bild eines Menschen, wie ich es an anderer Stelle schon gezeichnet habe 23 : Er ist unterwegs in seinem „vagabundierenden Denken“, das nicht etwa ziellos ist, sondern das einerseits zwar offen ist, sich zugleich aber andererseits der Ausbildung der ihm selbst immanenten Möglichkeiten verpflichtet weiß. Da der Mensch - (anders als etwa das Tier) aus dem Zentrum triebgesteuerter und instinktgesicherter Determinierung ausgeschlossen ist, ist er „ex-zentrisch“ oder auch „ver-rückt“, und er wird lernen dürfen, es gerne zu sein. Der von der Gesellschaft eingeräumte Ort für dieses Lernen ist - der
Möglichkeit nach - die Schule. Wer den Überlegungen dieses Aufsatzes bis hierher gefolgt ist, wird die gedanklichen Konsequenzen nun selber ziehen und sein Handeln daran ausrich-ten können. 24
Anmerkungen
[...]
1 vgl. Francis Bacon, „Novum Organon I“
2 vgl. www.philosophersonly.de , Text “Über die Wahr-Nehmung”
3 Having eaten from the tree of knowledge, we cannot slip backwards into paradise : the gate ist locked and the angel behind us, but the garden may be open at the opposite end. Edgar Wind, Art and Anarchy
4 Friedrich Hölderlin, “Brod und Wein”
5 Karl Marx, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“
6 August Messer, „Fichtes Leben und Philosophieren“, Leipzig 1926, S. 35
7 vgl. www.philosophersonly.de , „Hegels Einleitung in die PhdG“
8 vgl. www.philosophersonly.de , „Fichte - die Seele von Jena“
9 Gerald Mackenthun, „Carl Jungs Individuation“, S.5 (Text über Google abrufbar)
10 Gertrud Hess, “Psychische Energetik”. in : Kindlers Psychologie des 20. Jahrhunderts, Band 4, Weinheim 1982
11 C.G. Jung, Gesammelte Werke, Band 8, S. 41 (Über die Energetik der Seele),
12 Josef Goldbrunner, Vorwort zu „Individuation“, Krailling vor München, 1949
13 C.G. Jung, Gesammelte Werke, Band 7, § 398
14 C.G. Jung, Gesammelte Werke, Band 6, § 891
15 C.G. Jung, „Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewussten“, Zürich 1933, S. 70)
16 vgl. hierzu Eugen Herrigel, „Zen in der Kunst des Bogenschiessens“
17 Bei diesem Vergleich ist auf die unterschiedliche Ausrichtung des Entwicklungs- Begriffs zu achten : In der Weltsicht des mittelalterlichen Menschen entwickelt der Protagonist sich zu einem ihm vorbestimmten Ziel hin; bei Jungs moderner Auffassung geht es um ein echtes Abenteuer mit offenem Ausgang, da die Potentialität nur die weit- gesteckten Rahmenbedingungen abgibt.
18 C.G. Jung, „Seelenprobleme der Gegenwart“, Zürich 1931, S. 444)
19 C.G. Jung, Gesammelte Werke 6, § 825
20 Zu Beginn der „Reflexion 3“ habe ich betont, nicht C.G. Jungs Theorie um ihrer selbst willen untersuchen zu wollen, sondern Denkanstöße für die eigene Theorie aufzuneh- men und fruchtbar zu machen. Dennoch sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, was bei dieser Übernahme unter den Tisch fällt : zunächst einmal der konservativste Teil der Jungschen Lehre, die ihm selbst allerdings sehr wichtig war : die Lehre vom kollektiv Unbewussten, das uns als unübersteigbare Mitgift der phylogenetischen Entwicklung mitgegeben sein soll. Sodann alle Teile der Lehre, die auf eine betonte begriffliche Komplementarität hinaus- laufen und damit die Beweglichkeit der Polarität zu Begriffsschemata erstarren lassen (als Beispiel sei hier nur die Festlegung des begrifflichen Gegensatzpaares Animus / Anima genannt, gegen die vor allem aus feministischer Sicht vorgegangen wurde - meiner Meinung nach zu Recht).
21 Berlin 2010, S. 48
22 vgl. hierzu meine verschiedenen Arbeiten zu Christa Wolf auf www.philosophersonly. de bzw. veröffentlicht im Grin-Verlag
23 Die einzelnen Aspekte sind abgehandelt worden (oder werden in naher Zukunft abge- handelt) auf meiner Internet-Seite unter der Rubrik „Das philosophische Licht um mein Fenster“.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die "Idole" nach Francis Bacon und wie beeinflussen sie unser Verständnis?
Francis Bacon identifizierte vier Arten von "Götzenbildern" oder Idolen, die unser Verständnis beeinflussen: 1) idola tribus (allgemeinmenschliche Vorurteile), 2) idola specus (persönliche Sichtweisen), 3) idola fori (konventioneller Sprachgebrauch) und 4) idola theatri (überlieferte Meinungen). Bacon argumentierte, dass diese Idole unsere Wahrnehmung verzerren. Der Text hinterfragt jedoch, ob es möglich ist, diesen Idolen vollständig zu entsagen, da unser Erkenntnisapparat und unbewusste Interessensentscheidungen eine Rolle spielen.
Was bedeutet der Begriff "Eigen-Sinn" im Kontext des Hölderlin-Wortes und des Essays?
Der Begriff "Eigen-Sinn" bezieht sich auf das Spannungsverhältnis zwischen dem allgemeinen "Maß" und dem individuellen "Eigenen". Der Essay untersucht, wie diese beiden Aspekte vermittelt werden können, und schlägt ein "Sowohl-als-auch" beider Seiten vor. Dies steht im Zusammenhang mit dialektischem Denken und der Aufhebung von Entfremdung, wobei Selbstbestimmung und Fremdbestimmung in Einklang gebracht werden sollen.
Wie beeinflussen romantische Ideen die Wahrnehmung der Welt als Labyrinth?
Der Text beschreibt, wie Wahrnehmungen sich zu theoretischen Überbauten verdichten und umgekehrt. Frühromantiker mit ihrer Sehnsucht nach dem Unendlichen und dem bewussten Einsatz fragmentarischer Formen dienen als Beispiel. Die Welt wird als ein Labyrinth dargestellt, das wir nicht vollständig ausloten können, dessen verzweigte Wege aber miteinander vernetzt sind. Die Aufgabe besteht darin, den "Text der Welt" zu lesen, wobei die menschliche Interpretation und Kreativität betont werden.
Warum wird Carl Gustav Jung als ein anstößiger Denker betrachtet und wie wird sein Werk hier interpretiert?
C.G. Jung wird als anstößiger Denker betrachtet, da er von einigen als konservativ und unpolitisch eingestuft wird. Der Text argumentiert jedoch, dass es wichtig ist, Jungs Werk auf seine Kreativität und sein Potenzial zur Selbstgestaltung hin zu befragen. Es wird betont, dass die "Freisetzung eigensinniger Lebendigkeit" entscheidend für Autonomie und veränderndes Handeln ist.
Was versteht Jung unter "Werde-Lust" und "Selbst" und welche erkenntnistheoretischen Einschränkungen gibt es?
Jung sieht in der Libido nicht nur einen allgemeinen Antrieb, sondern auch eine "Werde-Lust", die auf "Verselbstung" oder "Selbstverwirklichung" abzielt. Das "Selbst" wird jedoch als eine Konstruktion oder ein Postulat betrachtet, das eine uns unerkennbare Wesenheit ausdrücken soll. Jung betont die empirische Basis seiner Theorie, räumt aber ein, dass der Begriff des Selbst unsere Erkenntnisfähigkeit übersteigt.
Was ist der "Weg der Individuation" nach Jung und wie unterscheidet er sich von Individualismus oder Egoismus?
Der "Weg der Individuation" ist der Prozess der Entfaltung der eigenen Potenziale und der Fruchtbarmachung der im Selbst liegenden Möglichkeiten. Es wird betont, dass Individuation nicht mit Individualismus oder Egoismus verwechselt werden darf, sondern vielmehr zur Entwicklung eines organisch gewachsenen Kollektivs beiträgt. Individuation ist ein Differenzierungsprozess, der die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit zum Ziel hat, aber auch zu einem intensiveren Kollektivzusammenhang führt.
Was bedeutet der "blinde Fleck" im Zentrum des Bewusstseins im Kontext von Christa Wolfs Werk und wie kann er verkleinert werden?
Der "blinde Fleck" bezieht sich auf Bereiche, die wir "noch nicht" wahrgenommen haben, in denen wir "blind" sind, weil wir unsere Potenzen noch nicht ausgeschöpft haben. Im Gegensatz zu einer Korrektur falscher Selbstbilder geht es um eine echte Bewusstseinserweiterung. Christa Wolf beschreibt, wie wir diesen blinden Fleck allmählich von den Rändern her verkleinern können, um mehr Raum zu gewinnen, der uns sichtbar und benennbar wird.
Welchen Schmerz gilt es im Prozess der Subjektwerdung zu überwinden?
Der Text verweist auf den "Schmerz der Subjektwerdung", bei dem es darum geht, die "Faulheit und Feigheit" zu überwinden und sich auf die Konsequenzen einer bewussten Entscheidung für ein Leben als aktives Subjekt einzustellen. Dies bedeutet, den Trennungsschmerz von der bisherigen Persönlichkeit zu ertragen, aber auch die passive Hinnahme einer verdinglichenden Objektivierung zu vermeiden.
Wie kann das "Unbehagen in der Kultur" überwunden werden und welche Rolle spielen dabei das "Maß" und das "Eigene"?
Das "Unbehagen in der Kultur" kann überwunden werden, indem die Einschränkung der lebensenergetischen Tatkraft als notwendig erkannt wird. Die Anerkennung der Subjektivität der Anderen und die wechselseitige Limitation führen zu einer symmetrischen Interaktion, aus der Lustpotential gezogen werden kann. Die Vermittlung zwischen dem Anspruch des "Maßes" (gesellschaftliche Normen) und dem des "Eigenen" (individuelle Bedürfnisse) zielt auf den Aufbau einer Gesellschaft nicht entfremdeter Individuen ab.
Welche Rolle spielt die Schule bei der Ausbildung des "vagabundierenden Denkens"?
Der Mensch ist "ex-zentrisch" oder "ver-rückt", da er nicht triebgesteuert ist. Die Schule soll ihm den Ort bieten, dieses "vagabundierende Denken" zu entwickeln, das offen ist, sich aber auch der Ausbildung der ihm immanenten Möglichkeiten verpflichtet weiß. Die gedanklichen Konsequenzen dieser Überlegungen sollen dazu dienen, das eigene Handeln daran auszurichten.
- Arbeit zitieren
- Bernd Mollowitz (Autor:in), 2011, Eigen-Sinn: Mut zu Wahr-Nehmungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184640