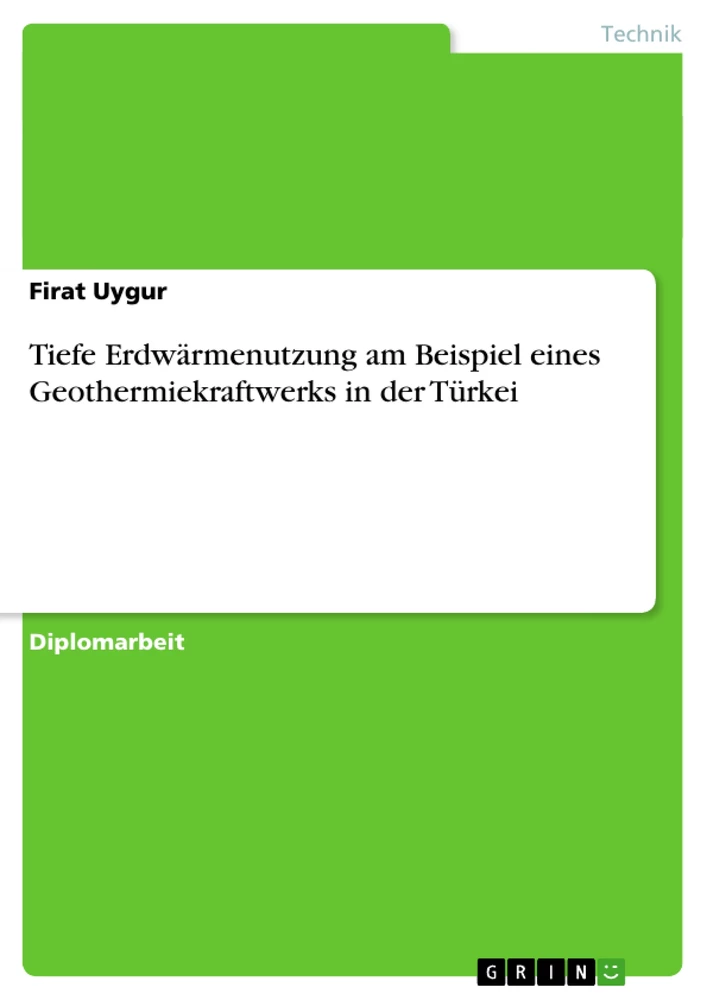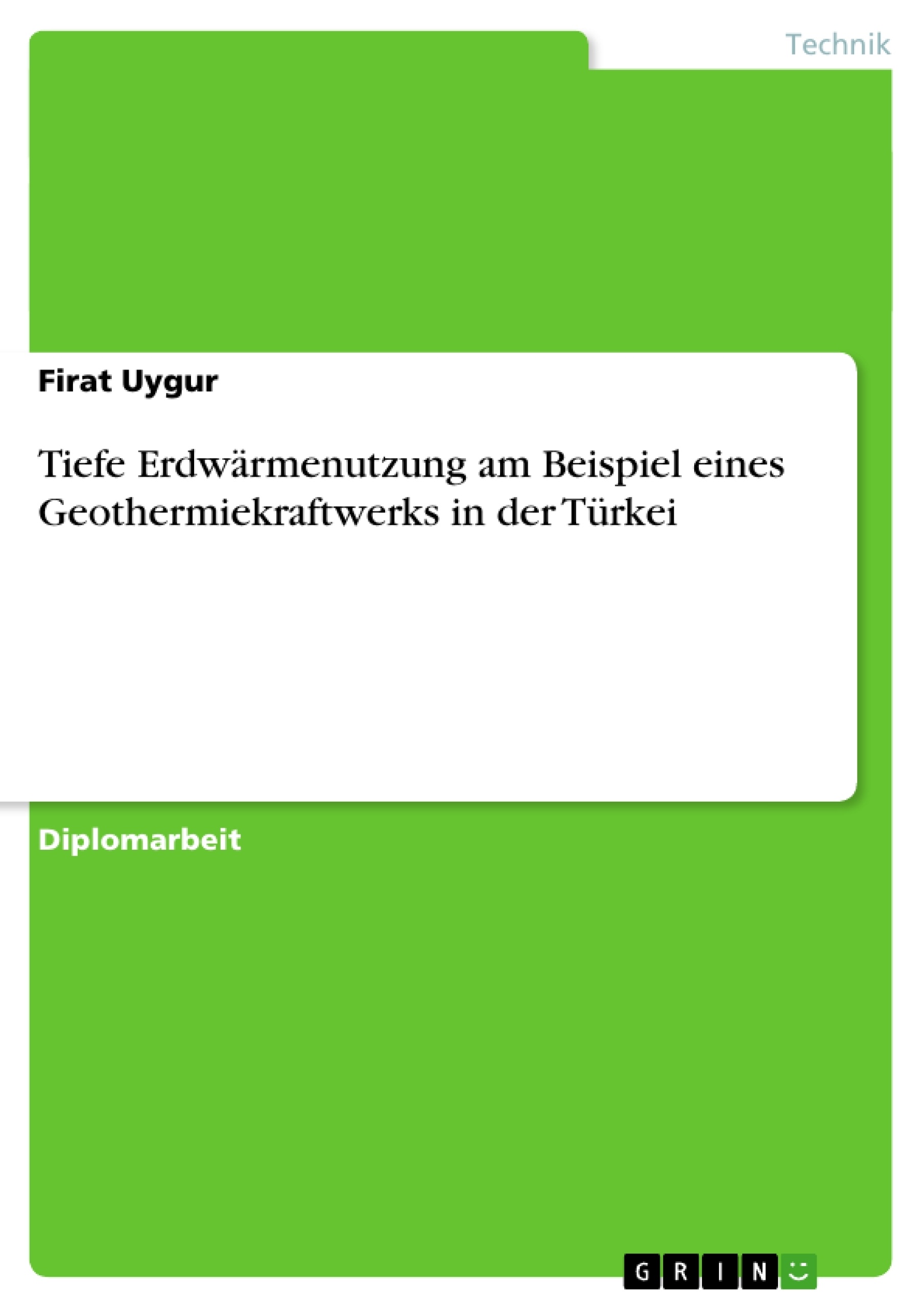Mit ihrer dauerhaften Versorgungssicherheit, Ressourcenschonung, Umwelt-, Klima- und Gesundheitsverträglichkeit, stellt die Erdwärme eine gewinnbringende und durch ihre Unerschöpflichkeit wertvolle Alternative zu den heutigen Energieträgern und eine gute Lösungsmöglichkeit für die mit ihnen verbundenen Probleme dar. Im Gegensatz zur Nutzung konventioneller Energieträger erlaubt die Erdwärmenutzung eine höhere Fehlertoleranz, bedarf weniger Platz und weist eine geringere Feuer- und Explosionsgefahr auf. Wie alle anderen erneuerbaren Energieträger ermöglicht auch die Erdwärme eine, im Bezug auf die Betriebskosten, wirtschaftliche Beschaffung ihrer Energie. Des Weiteren verringern die dezentralen Nutzungsanlagen außerhalb der Städte Transportverluste und schaffen dabei gleichzeitig Arbeitsplätze im ländlichen Raum - sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase.
Die Erdwärmenutzung wird je nach ihrer Lage im Boden in oberflächennahe und tiefe und abhängig von der Existenz von Grundwasser als Wärmeträgermedium in hydrothermale und petrologische Systeme untergliedert. Sowohl die hydrothermalen oberflächennahen Systeme als auch die petrologischen oberflächennahen Systeme stellen nur eine begrenzte Menge an geothermischer Energie zur Verfügung. Dem gegenüber bieten die mit der Tiefe steigenden Temperaturen ein sehr breites Spektrum an Nutzungsmöglichkeiten und erreichen ein für die Nutzer beträchtliches Potential an Wärmeenergie. Die Erdwärme der tiefen hydrothermalen Systeme wird seit mehreren Jahren zu zahlreichen Zwecken eingesetzt, während auf dem Gebiet der Nutzung der tiefen petrologischen Systeme zurzeit noch geforscht wird.
Aufgrund ihres riesigen Potentials konzentriert sich diese Diplomarbeit auf die tiefe hydrothermale Erdwärmenutzung. Nachdem die geologische und geophysische Grundlagen sowie Klassifizierung der Erdwärmesysteme in dem ersten Teil verständnishalber kurz zusammengefasst werden, werden in dem zweiten Teil auf die wesentlichen Phasen von Bau und Betrieb der tiefen hydrothermalen Erdwärmenutzung (Untersuchung, Gewinnung und Nutzung) im Hinblick auf ihren potentialen Schwachstellen wie Korrosion, Ablagerungen und Umweltauswirkungen eingegangen. Im letzten, praxisorientierten Teil der Arbeit werden dem Leser die in Kapitel eins und zwei dargestellten Inhalte am Beispiel eines bestehenden Erdwärme-Kraftwerks in der Türkei verdeutlicht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Verzeichnis der Symbole und Abkürzungen
- 1 Einleitung
- 1.1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Geologische Grundlagen
- 2.2.1 Erdentstehung und –aufbau
- 2.2.2 Theorie der Plattentektonik
- 2.3 Geothermische Systeme
- 2.3.1 Oberflächennahe Geothermie
- 2.3.2 Tiefe Geothermie
- 2.3.2.1 Allgemeines
- 2.3.2.2 Hydrothermale Systeme
- 2.3.2.3 Petrologische Systeme
- 3 Erschließung und Nutzung hydrothermaler Geothermie
- 3.1 Allgemeines
- 3.2 Untersuchung der geothermischen Energie
- 3.2.1 Allgemeines
- 3.2.2 Geologische Untersuchungen
- 3.2.3 Hydrologische Untersuchungen
- 3.2.4 Geochemische Untersuchungen
- 3.2.4.1 Siliciumdioxid-Geothermometer
- 3.2.4.2 Kation-Geothermometer
- 3.2.4.3 Gas-Geothermometer
- 3.2.4.4 Isotope Geothermometer
- 3.2.5 Geophysikalische Untersuchung
- 3.3 Gewinnung der geothermischen Energie
- 3.3.1 Allgemeines
- 3.3.2 Bohrung
- 3.3.2.1 Baustelleneinrichtungen
- 3.3.2.2 Bohrtechnik
- 3.3.2.3 Bohrspülung
- 3.3.2.4 Verrohrung und Zementation
- 3.3.2.5 Komplettierung
- 3.3.2.6 Sicherheit
- 3.3.3 Förderung
- 3.3.3.1 Pumpen
- 3.3.3.2 Ablagerung und Korrosion
- 3.3.4 Wärmewandlung und -transport
- 3.3.4.1 Wärmeüberträger
- 3.3.4.2 Wärmepumpen
- 3.3.4.3 Rohrleitungen
- 3.4 Nutzung der geothermischen Energie
- 3.4.1 Allgemeines
- 3.4.2 Stromerzeugung
- 3.4.2.1 Allgemeines
- 3.4.2.2 Direkte Dampfnutzungsanlagen
- 3.4.2.3 Flash-Anlagen
- 3.4.2.4 Binäranlagen
- 3.4.3 Raumheizung und -kühlung
- 3.4.4 Agrikultur und Aquakultur
- 3.4.4.1 Allgemeines
- 3.4.4.2 Agrikultur
- 3.4.4.3 Aquakultur
- 3.4.5 Industrielle, balneologische und touristische Anwendungen
- 3.4.6 Umweltauswirkungen der Erdwärmenutzung
- 3.4.6.1 Allgemeines
- 3.4.6.2 Physikalische und soziale Auswirkungen
- 3.4.6.3 Wasser- und Luftverschmutzung
- 4 Tiefe hydrothermale Erdwärmenutzung in der Türkei
- 4.1 Allgemeines
- 4.2 Erdwärmenutzung in der Türkei
- 4.3 Erdwärme-Kraftwerk Dora-1
- 4.3.1 Das Salavatli-Sultanhisar Erdwärmesystem
- 4.3.2 Aufbau und Betrieb
- 4.3.2.1 Binärtechnologie
- 4.3.2.2 Kühlsystem
- 4.3.2.3 Rückinjektion
- 4.3.2.4 Korrosions- und Ablagerungsschutz
- 4.3.2.5 Anschluss an das Stromnetz
- 4.3.2.6 Das Pentan-Sicherheitssystem
- 4.3.2.7 CO2-Gewinnungsanlage
- 4.3.3 Erweiterungsprojekte
- 4.4 Nutzungsmöglichkeiten der Rest- und Abwärme
- 4.4.1 Restwärme
- 4.4.1.1 Allgemeines
- 4.4.1.2 Fernwärmeheizung
- 4.4.1.3 Gewächshausheizung
- 4.4.1.4 Balneologische und touristische Nutzung
- 4.4.2 Abwärme
- 5 Zusammenfassung und Fazit
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der tiefen hydrothermalen Erdwärmenutzung am Beispiel eines Geothermiekraftwerks in der Türkei. Sie analysiert die geologischen und geophysischen Grundlagen der Erdwärmenutzung und erläutert die wesentlichen Phasen von Bau und Betrieb einer hydrothermalen Erdwärmeanlage, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die potentiellen Schwachstellen wie Korrosion, Ablagerungen und Umweltauswirkungen gelegt wird. Im zweiten Teil der Arbeit wird die tiefe hydrothermale Erdwärmenutzung in der Türkei am Beispiel des Erdwärmekraftwerks Dora-1 in Salavatli/Aydin detailliert untersucht, um die in den ersten beiden Kapiteln theoretisch dargestellten Inhalte praxisnah zu veranschaulichen.
- Geologische und geophysische Grundlagen der Erdwärmenutzung
- Erschließung und Nutzung von hydrothermalen Erdwärmesystemen
- Korrosion, Ablagerungen und Umweltauswirkungen bei der Erdwärmenutzung
- Die tiefe hydrothermale Erdwärmenutzung in der Türkei
- Das Erdwärmekraftwerk Dora-1 in Salavatli/Aydin
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einführung in das Thema der Erdwärmenutzung als regenerative Energiequelle und zeigt die Notwendigkeit ihrer Nutzung angesichts der begrenzten Ressourcen an fossilen Brennstoffen und den negativen Auswirkungen auf die Umwelt auf. Kapitel 2 erläutert die geologischen und geophysischen Grundlagen der Erdwärmenutzung, beschreibt die Entstehung der Erde und ihren Aufbau sowie die Theorie der Plattentektonik. Es werden außerdem die geothermischen Systeme nach ihren Nutzungstiefen in oberflächennahe und tiefe Geothermie unterteilt und die Unterschiede zwischen hydrothermalen und petrologischen Systemen hervorgehoben. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Erschließung und Nutzung von hydrothermalen Erdwärmesystemen. Es werden die verschiedenen wissenschaftlichen Methoden zur Untersuchung der geothermischen Energie, die wesentlichen Phasen der Erdwärmebereitstellung sowie die Nutzung der bereitgestellten geothermischen Energie erläutert. Dabei werden wichtige Aspekte wie Korrosion, Ablagerungen, Wärmewandlung und -transport sowie die Umweltauswirkungen der Erdwärmenutzung detailliert behandelt. Kapitel 4 befasst sich mit der tiefen hydrothermalen Erdwärmenutzung in der Türkei am Beispiel des Erdwärmekraftwerks Dora-1 in Salavatli/Aydin. Es wird das Salavatli-Sultanhisar Erdwärmesystem vorgestellt und der Aufbau und Betrieb des Kraftwerks Dora-1 detailliert beschrieben. Anschließend werden die Erweiterungsprojekte des Kraftwerks und die Nutzungsmöglichkeiten der Rest- und Abwärme des Kraftwerks untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der tiefen hydrothermalen Erdwärmenutzung, des Geothermiekraftwerks Dora-1 in Salavatli/Aydin, der geologischen und geophysischen Grundlagen, der Erschließung und Nutzung von hydrothermalen Systemen, der Korrosion, der Ablagerungen, der Wärmewandlung und -transport sowie der Umweltauswirkungen der Erdwärmenutzung. Weitere wichtige Begriffe sind: Plattentektonik, hydrothermale Systeme, petrologische Systeme, Binäranlagen, Flash-Anlagen, direkte Dampfnutzung, Rückinjektion, Reihennutzung, Salavatli-Sultanhisar Erdwärmesystem, Inhibitoren, NKGs, CO2-Gewinnungsanlage, GLOBALG.A.P.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen hydrothermaler und petrologischer Geothermie?
Hydrothermale Systeme nutzen vorhandenes Grundwasser als Wärmeträger, während petrologische Systeme auf die Wärme im trockenen Gestein setzen.
Welches konkrete Beispiel für ein Geothermiekraftwerk wird in der Arbeit untersucht?
Das Erdwärme-Kraftwerk Dora-1 in Salavatli/Aydin in der Türkei wird detailliert analysiert.
Welche Vorteile bietet die Erdwärmenutzung gegenüber fossilen Energieträgern?
Geothermie bietet dauerhafte Versorgungssicherheit, ist ressourcenschonend, klimaverträglich, benötigt wenig Platz und hat geringe Transportverluste durch dezentrale Anlagen.
Welche technischen Probleme können beim Betrieb von Geothermieanlagen auftreten?
Wesentliche Schwachstellen sind Korrosion an den Bauteilen sowie Ablagerungen (Scalings) in den Rohrleitungen und Pumpen.
Was versteht man unter Binärtechnologie bei Geothermiekraftwerken?
Hierbei wird die Wärme des Thermalwassers über einen Wärmetauscher an ein zweites Arbeitsmedium (z. B. Pentan) abgegeben, das einen niedrigeren Siedepunkt hat und die Turbine antreibt.
Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es für die Restwärme eines Kraftwerks?
Restwärme kann für Fernwärmeheizungen, Gewächshäuser, Aquakulturen oder balneologische Zwecke (Thermen) genutzt werden.
- Arbeit zitieren
- Firat Uygur (Autor:in), 2010, Tiefe Erdwärmenutzung am Beispiel eines Geothermiekraftwerks in der Türkei, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184661