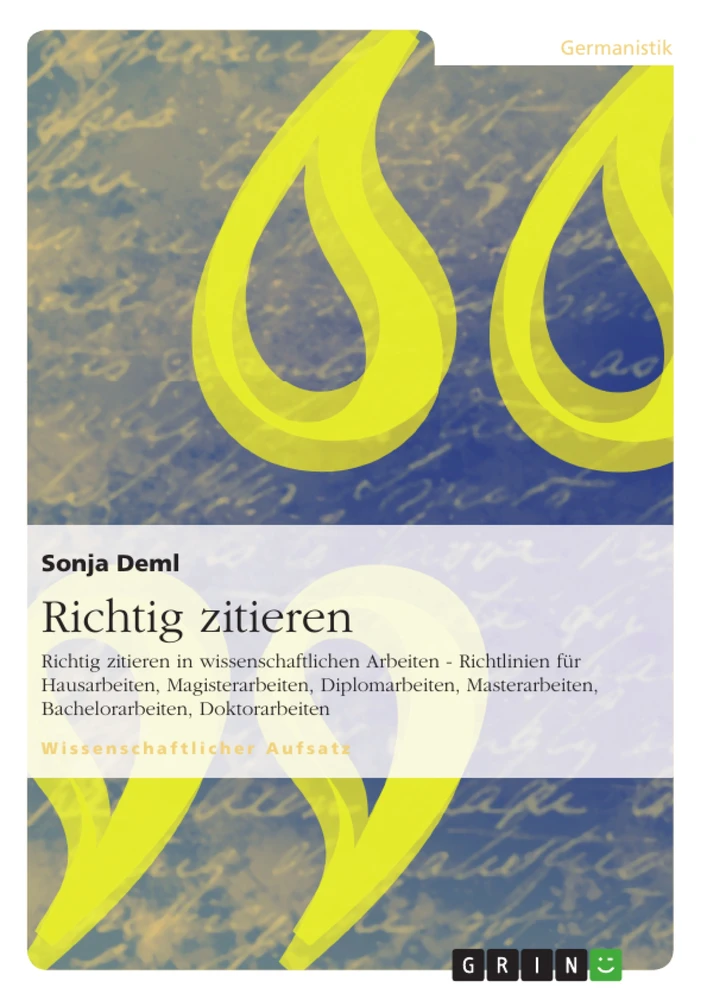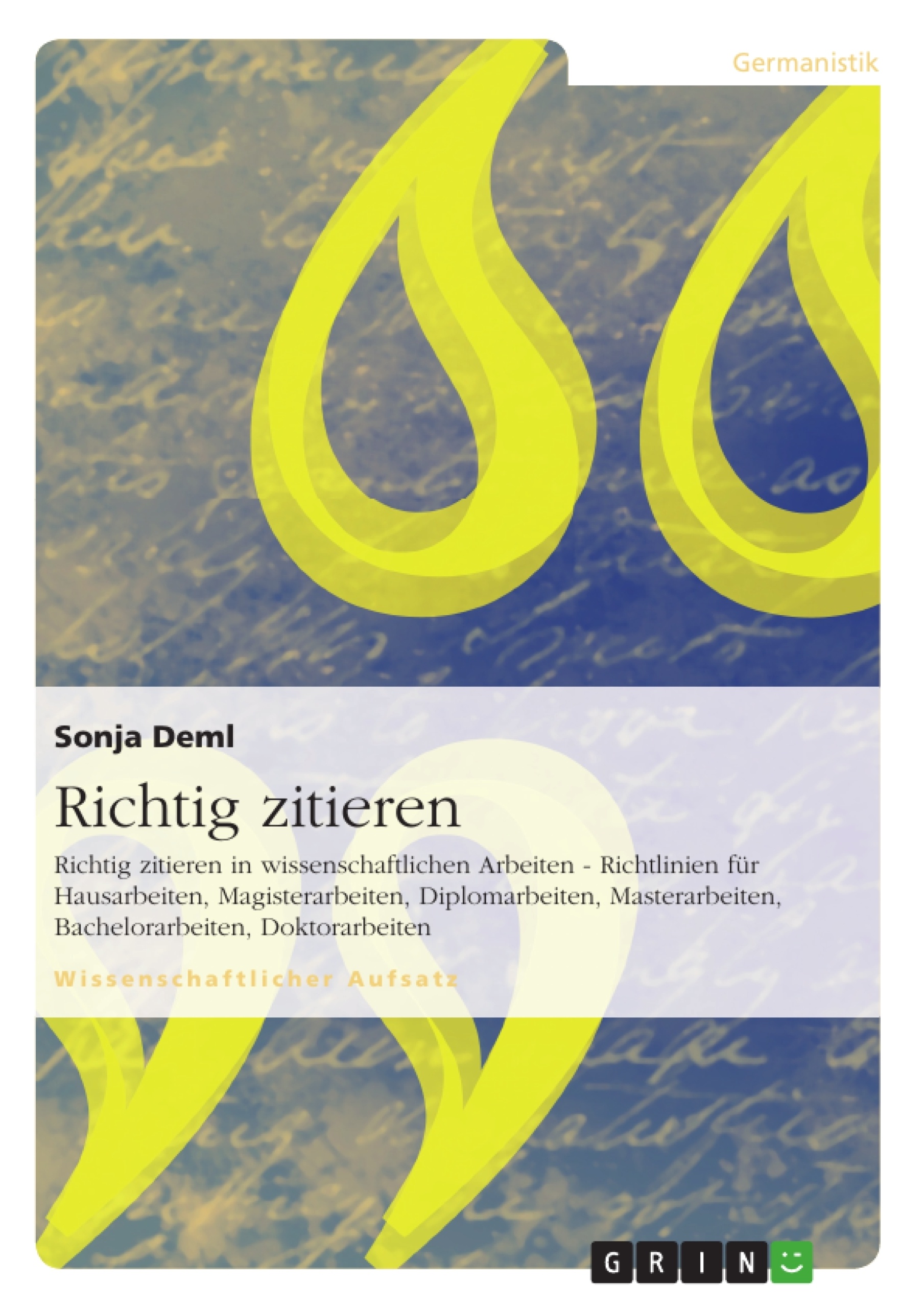Korrektes Zitieren ist das A und O wissenschaftlicher Arbeiten. Der Aufsatz zeigt wichtige Richtlinien auf und macht verschiedene Vorschläge, wie Sie die Quellen angeben können. Richtiges Zitieren, das Sie sich einmal zurechtgelegt haben, ist ein Kinderspiel und Sie vergessen Ihre Methode nicht mehr, wenn Sie sie gut eingeübt haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Grundsätzliches zum Zitieren
- 2. Das Literaturverzeichnis
- 2.1 Die Angabe von Büchern
- 2.2 Herausgeberwerke
- 2.3 Die Angabe von Zeitschriftenartikeln
- 2.4 Die Angabe von Internetadressen
- 2.5 Problemfälle
- 3. Das Zitieren im Text
- 3.1 Wörtliche Zitate
- 3.2 Sinngemäße Zitate
- 3.3 Interviews
- 4. Ein Wort zum Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, Richtlinien für das korrekte wissenschaftliche Zitieren in verschiedenen Arten von akademischen Arbeiten (Hausarbeiten, Magisterarbeiten, Diplomarbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten und Doktorarbeiten) bereitzustellen. Der Fokus liegt auf der Erstellung eines einheitlichen und korrekten Literaturverzeichnisses sowie der korrekten Zitierweise im Text selbst.
- Grundregeln des wissenschaftlichen Zitierens
- Erstellung eines Literaturverzeichnisses
- Korrekte Zitierweise von Büchern, Zeitschriftenartikeln und Internetadressen
- Handhabung von wörtlichen und sinngemäßen Zitaten
- Spezifische Herausforderungen beim Zitieren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Grundsätzliches zum Zitieren: Dieses Kapitel betont die Bedeutung korrekten Zitierens in wissenschaftlichen Arbeiten und räumt mit dem Mythos allgemeingültiger Regeln auf. Es unterstreicht die Variabilität der Zitierpraktiken zwischen Institutionen und Fachbereichen. Der Autor/die Autorin betont die Notwendigkeit konsequenter Anwendung einer einmal gewählten Zitiermethode und empfiehlt, bei Unsicherheiten die Zitiergewohnheiten des betreuenden Professors oder Gutachters zu überprüfen. Die oberste Regel ist die einheitliche und vollständige Angabe aller Quellen.
2. Das Literaturverzeichnis: Dieses Kapitel widmet sich der Erstellung eines Literaturverzeichnisses, das am Ende der Arbeit nach dem Anhang steht. Es erklärt die alphabetische Sortierung nach Autorennamen und die chronologische Ordnung bei mehreren Werken desselben Autors. Der Autor/die Autorin empfiehlt, das Literaturverzeichnis parallel zum Schreiben der Arbeit anzulegen, um spätere Unsicherheiten zu vermeiden. Es wird die Verwendung eines hängenden Einzugs empfohlen, um die Übersichtlichkeit zu verbessern.
2.1 Die Angabe von Büchern: Detailliert werden verschiedene Formate zur Angabe von Büchern im Literaturverzeichnis vorgestellt. Der Autor/die Autorin zeigt verschiedene Varianten, die von der Kurzform bis zur ausführlichen Angabe reichen und veranschaulicht diese anhand von Beispielen, einschließlich der korrekten Zitierung von Büchern mit mehreren Autoren oder Ausgaben. Die Möglichkeit, eigene Formate zu kreieren, wird erwähnt, unter der Prämisse der Einheitlichkeit innerhalb des gesamten Literaturverzeichnisses.
3. Das Zitieren im Text: Dieses Kapitel befasst sich mit der korrekten Zitierweise im Text selbst. Es unterscheidet zwischen wörtlichen und sinngemäßen Zitaten und erläutert die jeweilige Vorgehensweise. Die korrekte Zitierung von Interviews wird ebenfalls angesprochen. Das Kapitel baut auf den vorhergehenden Kapiteln auf und verdeutlicht die praktische Anwendung der Regeln für die Quellenangabe.
Schlüsselwörter
Wissenschaftliches Zitieren, Literaturverzeichnis, Quellenangabe, Zitation im Text, wörtliche Zitate, sinngemäße Zitate, Bücher, Zeitschriftenartikel, Internetadressen, einheitliche Zitierweise, wissenschaftliche Arbeiten.
Häufig gestellte Fragen zum wissenschaftlichen Zitieren
Was beinhaltet dieser Leitfaden zum wissenschaftlichen Zitieren?
Dieser Leitfaden bietet eine umfassende Übersicht zum wissenschaftlichen Zitieren, inklusive Inhaltsverzeichnis, Zielen, Schwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen. Er deckt die Erstellung von Literaturverzeichnissen, die korrekte Zitierweise im Text (wörtliche und sinngemäße Zitate) sowie spezifische Herausforderungen beim Zitieren ab. Der Fokus liegt auf der Einheitlichkeit und Korrektheit des Zitierens in verschiedenen Arten von wissenschaftlichen Arbeiten (Hausarbeiten, Magisterarbeiten, Diplomarbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten und Doktorarbeiten).
Welche Themen werden im Leitfaden behandelt?
Der Leitfaden behandelt grundlegende Prinzipien des wissenschaftlichen Zitierens, die Erstellung von Literaturverzeichnissen (inklusive der korrekten Angabe von Büchern, Zeitschriftenartikeln und Internetadressen), die korrekte Zitierweise von wörtlichen und sinngemäßen Zitaten im Text, sowie die Handhabung von Interviews als Quellen. Er beleuchtet auch Problemfälle und spezifische Herausforderungen beim Zitieren.
Wie ist der Leitfaden aufgebaut?
Der Leitfaden ist in vier Kapitel gegliedert: Kapitel 1 behandelt grundsätzliche Aspekte des Zitierens und betont die Wichtigkeit einer einheitlichen Zitiermethode. Kapitel 2 widmet sich dem Literaturverzeichnis, inklusive detaillierter Anweisungen zur Angabe von Büchern, Herausgeberwerken, Zeitschriftenartikeln und Internetadressen. Kapitel 3 befasst sich mit dem Zitieren im Text, unterscheidet zwischen wörtlichen und sinngemäßen Zitaten und behandelt die Zitierung von Interviews. Kapitel 4 bietet einen kurzen Schluss.
Wie wird ein Literaturverzeichnis nach diesem Leitfaden erstellt?
Das Literaturverzeichnis wird alphabetisch nach Autorennamen sortiert. Bei mehreren Werken desselben Autors erfolgt eine chronologische Ordnung. Es wird ein hängender Einzug empfohlen. Der Leitfaden bietet detaillierte Anweisungen zur korrekten Angabe von Büchern (inklusive verschiedener Varianten und Beispiele), Zeitschriftenartikeln und Internetadressen.
Wie zitiere ich wörtliche und sinngemäße Zitate korrekt?
Der Leitfaden unterscheidet klar zwischen wörtlichen und sinngemäßen Zitaten und erläutert die jeweilige korrekte Vorgehensweise. Für wörtliche Zitate sind genaue Angaben der Seitenzahlen erforderlich. Sinngemäße Zitate erfordern eine Quellenangabe, die den Gedankengang der Quelle wiedergibt.
Welche Rolle spielt die Einheitlichkeit beim wissenschaftlichen Zitieren?
Einheitlichkeit ist entscheidend. Der Leitfaden betont die Notwendigkeit, eine einmal gewählte Zitiermethode konsequent anzuwenden. Bei Unsicherheiten sollte die Zitierweise des betreuenden Professors oder Gutachters überprüft werden. Die oberste Regel ist die einheitliche und vollständige Angabe aller Quellen.
Welche Arten von wissenschaftlichen Arbeiten werden berücksichtigt?
Der Leitfaden richtet sich an alle Arten von wissenschaftlichen Arbeiten, inklusive Hausarbeiten, Magisterarbeiten, Diplomarbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten und Doktorarbeiten.
Wo finde ich Beispiele für die korrekte Zitierweise?
Der Leitfaden enthält zahlreiche Beispiele zur korrekten Zitierweise von Büchern, Zeitschriftenartikeln und Internetadressen, sowohl im Literaturverzeichnis als auch im Text. Insbesondere Kapitel 2.1 bietet detaillierte Beispiele zur Angabe von Büchern.
Was sind die Schlüsselwörter dieses Leitfadens?
Schlüsselwörter sind: Wissenschaftliches Zitieren, Literaturverzeichnis, Quellenangabe, Zitation im Text, wörtliche Zitate, sinngemäße Zitate, Bücher, Zeitschriftenartikel, Internetadressen, einheitliche Zitierweise, wissenschaftliche Arbeiten.
- Quote paper
- Sonja Deml (Author), 2012, Richtig zitieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184663