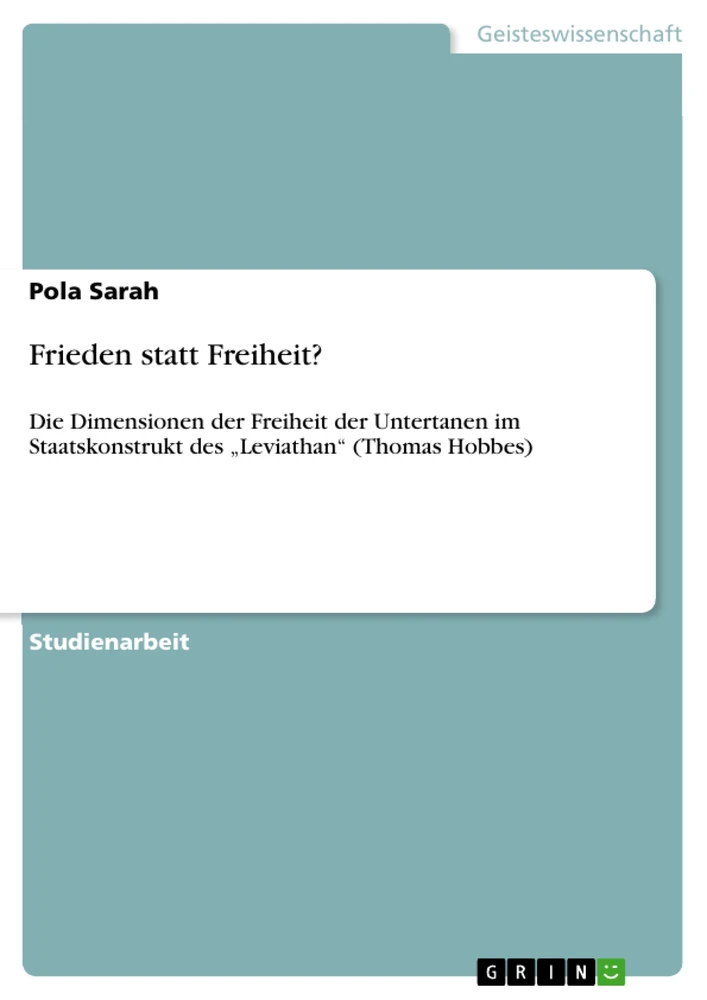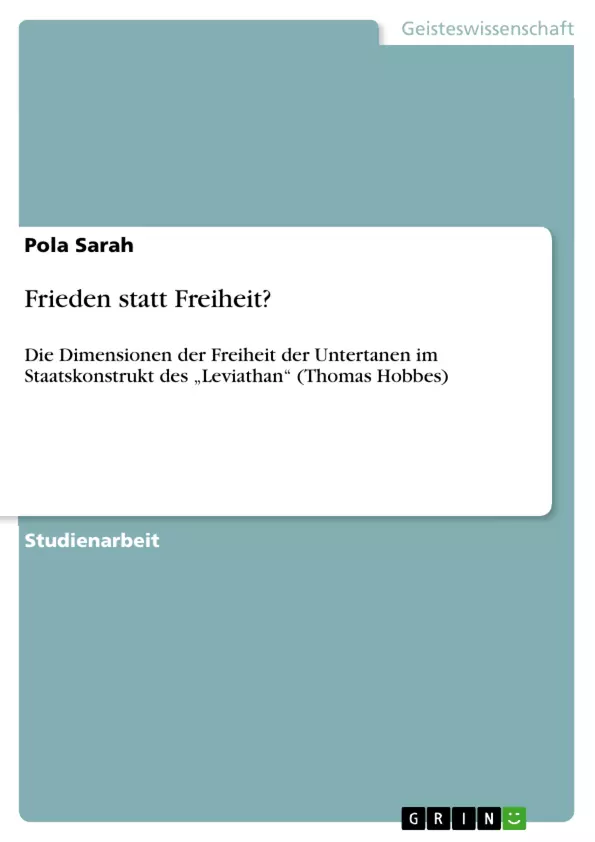1. Einleitung
[...] Hobbes stand also an der Nahtstelle vom klerikal beherrschten Mittelalter zur säkularen Neuzeit. Das war nicht nur im weithin römisch- katholisch bestimmten Kontinentaleuropa gefährlich , sondern auch in England, dessen besonderer Protestantimus eine Gemeinschaft von geistlicher und weltlicher Herrschaft vorsieht. Die geistliche Herrschaft in Frage zu stellen, bedeutete folglich die englische Krone und den Adel in Frage zu stellen. Letztlich war das Anlass für Hobbes Flucht aus England.
Hobbes grenzt sich mit seine Theorie allerdings auch klar von der klassischen philosophischen Tradition ab, insbesondere von Aristoteles‘ Polis-Theorie. Laut Hobbes ist es eine idealistische Verblendung, zu sagen, in der Antike seien die Menschen frei gewesen. Er geht davon aus, dass zwar die Staaten frei waren, der einzelne Bürger jedoch nicht. Herb führt an, dass es sich bei der Kritik an den griechischen Philosophen im Grunde um eine Kritik an ihren späteren Nachahmern handelt. Hobbes will klären, wie Herrschaft aus dem Naturzustand hergestellt werden kann und beschäftigt sich mit einem rechtsphilosophischen Grundproblem. Auch hier taucht der Angriff auf die bisherige Grundlage von Herrschaft von Gottes Gnaden durch die neu konstruierte Herrschaft aus dem menschlichen Naturzustand auf.
In seinem Staatskonstrukt, das er im Werk „Leviathan“ vorstellt, spielt die Freiheit der Untertanen eine erhebliche Rolle. Allerdings ist diese Freiheit, die Hobbes den Untertanen in seiner Staatstheorie nach Vertragsabschluss lässt, sehr eingeschränkt. In der politischen Partizipation der Untertanen – auch eine Art Freiheit- sah er die Ursache für Unruhen und Kriege:
„Aber die Menschen lassen sich von dem bestechenden Wort Freiheit leicht täuschen […] Und wird dieser Irrtum noch durch die Autorität von Leuten, die wegen ihrer Schriften über diesen Gegenstand berühmt sind, bestärkt, so ist es kein Wunder, wenn daraus Aufruhr und Staatsumwälzungen entstehen.“ [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hobbes Idee von Staat und Untertan
- 3. Freiheit im Naturzustand
- 4. Freiheit im Staat
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Dimensionen der Freiheit der Untertanen im Staatskonstrukt des „Leviathan“ von Thomas Hobbes. Sie untersucht, wie Hobbes das Verhältnis von Freiheit und Herrschaft konzipiert und wie er den Naturzustand und den Übergang in den Staat beschreibt.
- Die philosophischen Grundlagen von Hobbes' Staatsphilosophie
- Die Konzeption des Naturzustands und die Rolle der Freiheit
- Die Freiheit der Untertanen im Staat und deren Einschränkungen
- Die Rolle der Selbsterhaltung und des menschlichen Triebes in Hobbes' Theorie
- Die Bedeutung von Krieg und Unruhen für Hobbes' Staatskonstrukt
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den historischen Kontext von Hobbes' Werk und seine zentrale These vor, dass die Freiheit der Untertanen im „Leviathan“ stark eingeschränkt ist.
- Kapitel 2 erläutert Hobbes' Idee von Staat und Untertan. Er argumentiert, dass die Menschen im Naturzustand frei, aber zugleich in einem permanenten Krieg leben, der die Selbsterhaltung bedroht. Aus diesem Grund geben sie freiwillig ihre Freiheit auf, um einen Staat zu errichten, der Schutz und Ordnung bietet.
- Kapitel 3 erörtert die Freiheit im Naturzustand, die Hobbes als eine Freiheit von Gesetzen und Regeln beschreibt. Er betont, dass im Naturzustand jeder Mensch frei ist, zu tun, was er für richtig hält, aber gleichzeitig auch ständig der Gefahr durch andere Menschen ausgesetzt ist.
- Kapitel 4 analysiert die Freiheit im Staat. Hobbes argumentiert, dass der Staat den Menschen Freiheit durch Gesetze und Regeln garantiert, die den Frieden und die Sicherheit gewährleisten. Diese Freiheit ist jedoch begrenzt, da der Staat die Macht hat, die Untertanen zu kontrollieren und zu bestrafen.
Schlüsselwörter
Thomas Hobbes, Leviathan, Naturzustand, Freiheit, Herrschaft, Krieg, Selbsterhaltung, Staat, Untertan, Vertrag, politische Philosophie, Neuzeit, Staatsphilosophie, Gesellschaftsvertrag, Bürgerkriege, Rechtfertigung staatlicher Gewalt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These von Thomas Hobbes im „Leviathan“?
Hobbes argumentiert, dass Menschen ihre Freiheit aufgeben müssen, um durch einen starken Staat (Leviathan) Sicherheit und Frieden zu gewährleisten.
Wie beschreibt Hobbes den „Naturzustand“?
Er beschreibt ihn als einen „Krieg aller gegen alle“, in dem das Leben des Einzelnen einsam, armselig und kurz ist, da keine Gesetze existieren.
Warum ist die Freiheit der Untertanen bei Hobbes eingeschränkt?
Hobbes sah in zu viel politischer Freiheit die Ursache für Aufruhr und Bürgerkriege; daher hat der Souverän fast uneingeschränkte Macht.
Wie unterscheidet sich Hobbes von Aristoteles?
Während Aristoteles den Menschen als von Natur aus gemeinschaftsbildend sah, betrachtet Hobbes den Staat als künstliches Konstrukt zur Selbsterhaltung.
Welche Rolle spielt die Religion in Hobbes' Staatstheorie?
Hobbes fordert eine Unterordnung der geistlichen unter die weltliche Macht, um religiös motivierte Konflikte im Staat zu verhindern.
- Quote paper
- Pola Sarah (Author), 2009, Frieden statt Freiheit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184681