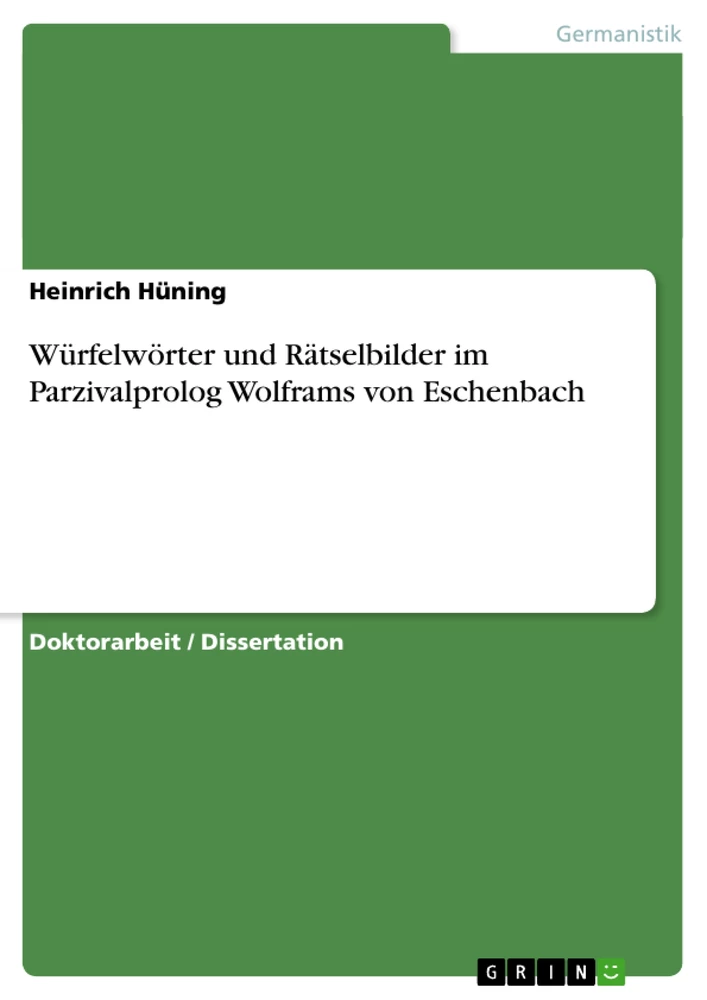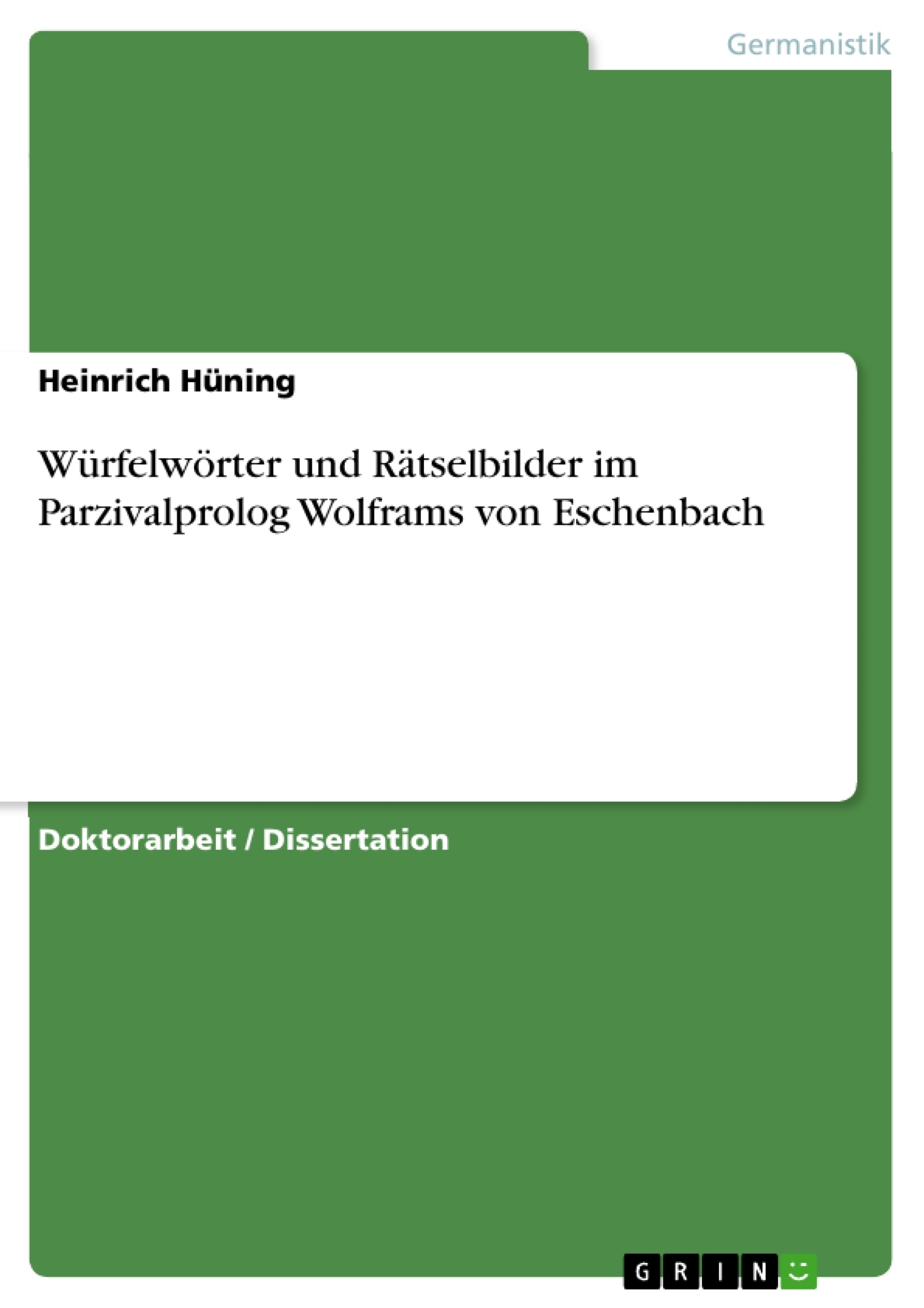Der „Parzival” Wolframs von Eschenbach (um 1200) zählt zu den bedeutendsten Dichtungen der Weltliteratur. Der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis des Romangeschehens liegt in seinem Prolog, bestehend aus ca. 120 Versen. Die Rätsel, die dieser Text – immer schon – jedem einzelnen Zuhörer und der Wolframforschung insgesamt aufgegeben hat, konnten in einer langen Forschungstradition bisher nicht zufriedenstellend gelöst werden.
Diese Rätselhaftigkeit ist ausdrücklich Gegenstand meiner Dissertation mit dem Titel „Würfelwörter und Rätselbilder im Parzivalprolog Wolframs von Eschenbach”.
Die Hauptthese lautet: Der Parzivalprolog gibt nicht nur Rätsel auf, er ist vom Dichter in der Form eines Rätsels konzipiert worden. Dem Zuhörer wird die Aufgabe zugemutet und zugetraut, es lösen zu können. – Form und Sinn des Textes in mittelhochdeutscher Sprache sind jedoch so eng ineinander verwoben, dass einerseits die Lösung des Rätsels für Zeitgenossen relativ einfach war, andererseits – eine der Lösung vorhergehende Übersetzung des mhd. Textes in die Sprache des 20. Jahrhunderts – ihn als Rätsel heute nahezu unlösbar macht. Wie der Prolog im 20. Jahrhundert „übersetzt” werden kann, bleibt eine offene Frage.
Entgegen der – auch in der Forschung – gelegentlich vertretenen Meinung, der Parzivalprolog sei „unverständlich, weil unübersetzbar”, wird hier behauptet: Die Bilder des Parzivalprologs sind – wenn man sich ihnen aus der Perspektive des 12. Jahrhunderts nähert – durchaus klar und verständlich. In ihrem Zusammenhang und im Kontext mit dem Literaturexkurs Gottfrieds v. Straßburg im Tristan geben sie auch Aufschluß darüber, worum es im sogenannten Literaturstreit ging. „Alles in einem” ist der Text: literarisches Rätsel, Urform der Dichtung, „Eingang” zum Roman.
Den bedeutungsvollen Anfang des Parzivalromanes bildend, kann ein solcher Prolog – wie ein Burgtor – die Brücke zum Romangeschehen sperren oder öffnen, je nachdem, ob man die richtige Lösung (Parole) kennt oder nicht kennt.
So gesehen ist der Parzivalprolog zugleich ein „Exempel” (bispel) für andere Rätsel bzw. „Erlösungsfragen” im Roman, die u.a. auch das Gralsgeschehen betreffen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Die Bilder des Parzivalprologs
1.1 Das Problem der dichterischen Bilder
1.2 Ein Literaturstreit im 12. Jahrhundert
1.3 Das Verhältnis von Wort und Bild - ein Verständigungsproblem
1.4 Auf der „verte“ des „bickelwortes“
1.5 Sprachlogik und Logik der dichterischen Bilder - ihr unterschiedliches Verhältnis zum Phänomen der Zeit
2. Ein „bickelwort“ als Literaturkritik
2.1 Diskussion zum Problem der dichterischen Bilder im Parzivalprolog
2.2 Der „bickel“, ein unbekannter Gegenstand als literarisches Bild
2.3 Volkskundliche Analyse der Form und Funktion des „bickels“
2.4 Das dichterische Bild Gottfrieds und seine Bedeutung für Wolfram
2.5 „Bickelwortkritik“ im Literaturstreit - „Kinderkram“ in der Deutung
3. Der „zwîvel“ des Parzivalprologs in der Forschung - Literaturreferat
3.1 „naiv“ - „genialisch“ - „anders“ (2,16)
3.2 Der Text als Rätsel - eine geheime Botschaft
3.3 Sind dichterische Bilder nur „anschaulich“?
4. Der Eingangsvers des Prologs - ein Rätsel
4.1 Vorbemerkungen zur spezifisch literarischen „Naivität"
4.2 Das Elsterngleichnis und der bildlogische Hintergrund von „zwîvel“
4.3 Was „tuot“ die Elster der „varwe“ an? Eine existentielle Deutung des Elsterngleichnisses
4.4 Die Elster
5. Das Verhältnis von „agelstern“ - „zwîvel“ - „nâchgebûr“
5.1 Der „zwîvel“ und das Bild der Elster
5.2 Die Bilder des Eingangs und die „Selbstverteidigung“ Wolframs
5.3 Die rätselhafte Beziehung von „nâchgebûr" und „zwîvel"
6. Das dichterische Gesamtbild des Anfangs (1,1-1,14)
6.1 Die Herzmitte des Eingangs
6.2 „gesmaehet unde gezieret ist, swâ sich parrieret unverzaget mannes muot“
6.3 „zwîvel“ im „herzen“ verbunden mit dem „unverzaget mannes muot“ - die Grundverfassung des Menschen
6.4 Die Rätselbilder des Parzivalprologs - Probleme ihrer Übersetzung und Interpretation
6.5 Die heilsgeschichtliche Verfassung auf der Basis einer „glücklichen Schuld“
6.6 Wer ist der „unstaete geselle“ im Elsterngleichnis?
6.7 Die abstrakten Bilder des Prologs (1,1-1,14) als Eingangsrätsel des „Parzival“
7. Die „stiure“ der vorliegenden Interpretation
7.1 Philologische Argumente zum Literaturstreit und Anfang des Prologs
7.2 Das sinngebende Umfeld von „zwivel“ und „nachgebur“
7.3 Das volkskundliche Umfeld von „agelster“
7.4 Die Überlieferung von „agelstern“ in den Handschriften des Prologs
7.5 Das Wort „nachgebur“ in den Handschriften
7.6 Etymologie des Wortes „agelstern“
7.7 Das Verhältnis von „zwivel“ – „velle“ - „varwe“
7.8 Grammatik und Syntax des Eingangs und Elsterngleichnisses (1,1-1,6)
7.9 Das Subjekt von Eingang und Elsterngleichnis
7.10 Probleme bei der allegorischen Deutung des Parzivalprologs
7.11 Ist das Elsterngleichnis eine „Gregorius“-Parodie?
7.12 Nachtrag zur Bickelwortinterpretation
8. Die Enite-Kritik, ein Bilderrätsel im Text der Frauenlehre
8.1 „Inhalte“ als Rätsel im Literaturstreit
8.2 „ich enhân daz niht vür lîhtiu dinc“ (3,15-3,18)
8.3 „Dise manger slahte underbint - iedoch niht gar von manne sint“
8.4 „verligen“ und verlogen
9. Die Erec-Satire als Reihung von rätselhaften Bildern
9.1 „Umständliches“ zum „verligen“ - Motiv und zum Verhalten Erecs
9.2 Die Erec-Satire im Parzivalprolog
9.3 Das „verligen“ Erecs oder der „valsch geselleclîche muot“ (2,17)
9.4 Der „dritte biz“ (2, 22) - eine erotische Metapher
9.5 Der „dritte biz“, ein Zeichen der Bereitschaft, das „nicht galt“
9.6 „vuor si mit bremen in den walt“ (2,22) - „Bremsen“ oder „Brummen“
10. Anmerkungen zum Konzept des Parzivalprologs
10.1 Kann eine Dichtung „unverantwortlich“ und eine Interpretation „unwissenschaftlich“ sein?
10.2 Wolfram von Eschenbach als „Apologet“ des Christentums
10.3 Zuordnung des eigenen Interpretationsversuches und Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
I. Quellen
II. Literatur
III. Nachschlagewerke
Sachregister
Anhang
Vorwort
Der Zufall führte Regie bei der Wiederentdeckung einer altertümlichen Form von Würfeln, die im Literaturstreit des 12. Jahrhunderts zwischen Gottfried von Straßburg und Wolfram von Eschenbach eine große Rolle spielten. Die Auseinandersetzung um „Würfelwörter“ („bickelworte“) so der Vorwurf Gottfrieds, ist u.a. für die vorliegende Studie über den Parzivalprolog von großer Bedeutung. Die auffällige Form und Funktion des Gegenstandes „bickel“, der mit unseren heutigen Vorstellungen von Würfeln nichts zu tun hat, motivierte ihn („Tristan“ 4636-39) zum dichterischen Bild des „bickelwortes“, mit dem „boshaft, aber nicht ganz unzutreffend“, wie Eberhard Nellmann sagt (1994, S. 458), der Stil Wolframs von Eschenbach im Prolog charakterisiert wird. Dieses Bild ist bis heute aus dem einfachen Grunde nicht richtig verstanden worden, weil man den zum dichterischen Bild gehörenden Gegenstand bisher nicht identifizieren konnte. Er wird im Rahmen der folgenden Überlegungen vorgestellt.
Durch systematische Versuchsreihen mit einer Anzahl dieser archaisch-orakelhaft funktionierenden „Würfel“ wurde auf empirischem Wege auch das Wertungs- bzw. Glücksspielsytem so weit rekonstruiert, daß der Sinn des „bickelwort“ Vorwurfs Gottfrieds von Straßburg erkennbar wurde. Unabhängig davon, ob man seiner Kritik zustimmt oder nicht, eröffnete sich damit eine neue Perspektive auf charakteristische, strukturelle Eigenschaften in der Dichtung Wolframs von Eschenbach, die der eigentliche Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind.
Meine erste Begegnung mit mittelalterlicher Literatur im Studium liegt ungefähr vierzig Jahre zurück. Sie wurde 1961 mit dem Staatsexamen für das Hauptfach Deutsch abgeschlossen. Das Thema der schriftlichen Arbeit lautete: „Die Gestalt des Feirefiz in Wolframs von Eschenbach `Parzival´.“
Nach meiner Pensionierung nahm ich im Jahre 1995 meine germanistischen Studien an der Universität Köln wieder auf, obgleich ich in meiner aktiven Lehrtätigkeit - außer der Arbeit in der ehemaligen Volksschule von 1953-1959 - im Hauptfach „Deutsch“ in weiterführenden Schulen nie unterrichtet hatte. Unmittelbar nach meinem späteren Staatsexamen wurde ich 1961 als Lehrer an das Werklehrerseminar (später „Institut für Werkerziehung“) der Stadt Köln berufen. Dort war ich viele Jahre in der praktischen und theoretischen Ausbildung von Lehrern, Sozialpädagogen und Kunsterziehern im Fach Werkerziehung an allgemeinbildenden Schulen tätig.
Die langjährige Werkstattarbeit im Bereich der freien und angewandten Kunst hinterläßt in der vorliegenden Studie über den Text des Parzivalprologs Spuren eines relativ pragmatischen Verständnisses, das für die Germanistik als Wissenschaft eher untypisch erscheint. Gemeint ist damit eine besondere Art des Umgangs mit Formen und Funktionen von Dinglichkeit in der Sprache Wolframs von Eschenbach. Die sich hieraus ergebende etwas „andere“ Art der Deutung eines literarischen Textes ist vielleicht gewöhnungsbedürftig. Sie sollte zum Zwecke der „Ergänzung“ rein wissenschaftlichen Vorgehens bei der Textanalyse nicht sofort von der Hand gewiesen werden.
In seiner Studie „Wolfram von Eschenbach als Dissertationsthema“ geht Werner Schröder (1980, S. 181) der Frage nach: „Ist Wolfram als Thema für Anfänger geeignet?“ Er beklagt, daß die Dichtung Wolframs von Eschenbach „seit langem schon und noch immer ein beliebter Gegenstand von Anfängerarbeiten“ sei, deren „absehbares Ergebnis [...] Ergänzung oder Modifizierung, Zurückweisung oder Wiederaufnahme von längst Erwogenem, Vermutetem, Postulierten und Nachzulesendem“ sei.
Zum Verständnis der vorliegenden Dissertation an der Philosophischen Fakultät der Universität Köln, die sich trotz der o.a. Warnungen mit Wolfram von Eschenbach befaßt, sei es erlaubt, einige Vorbemerkungen zu machen.
Nach dem Tode meines hochverehrten Doktorvaters Prof. Dr. Rathofer im Jahre 1998 mußte ein neuer Hauptgutachter gefunden werden, der nach Lage der Dinge keinen Einfluß mehr auf irgendeine Phase der Entstehung der Arbeit hatte. Diese Aufgabe übernahm Herr Professor Dr. Göttert, dem ich dafür zu großem Dank verpflichtet bin. Als Zweitgutachter stellte sich Herr Universitätsprofessor Dr. Ziegeler zur Verfügung. Auch ihm habe ich zu danken. Die mündliche Prüfung in Form einer Disputation fand am 30. Juni 1999 statt.
Es ist leicht nachzuvollziehen, wenn angesichts der besonderen Situation im Revisionsverfahren eine Überarbeitung gefordert wurde. So wurden z.B. alle Passagen aus dem Text entfernt, die mit dem ehemaligen Untertitel der Arbeit („Studie aus der Perspektive des verstehenden Umgangs mit Kunst“) zu tun hatten. An seine Stelle trat das umfangreiche Kapitel Nr. 7,1-12, in dem „drei Vorbehalte“ des Zweitgutachtens besonders berücksichtigt wurden. Der Abschnitt 2.5. wurde ebenfalls nachträglich eingefügt. Trotz dieser Änderungen konnte abschließend nicht in allen Teilen der Arbeit mit dem Zweitgutachter volle Übereinstimmung erzielt werden.
Besonderer Dank gebührt meiner ehemaligen Studienkollegin Frau Anne Kund, Hamm, die die mühsame Arbeit des Korrekturlesens übernommen hat.
1. Die Bilder des Parzivalprologs
1.1 Das Problem der dichterischen Bilder
Bildlichkeit der Sprache ist das auffallendste Merkmal in Wolframs von Eschenbach Parzivalroman, nicht nur ihrer Fülle, sondern vor allem ihrer Qualität wegen. Diese besondere Eigenschaft hat nicht immer Zustimmung gefunden. Joachim Bumke spricht deshalb von der „Ausgefallenheit seiner sprachlichen Bilder“, die als „befremdlich oder dunkel, manchmal auch bedrohlich [...] beschrieben“ werden. Dabei haben „nach der Lehre der Poetik [..] sprachliche Bilder die Funktion, Lebendigkeit und Anschaulichkeit zu erzeugen“ (1997, S. 135f). Diese „Ausgefallenheit“, welche in der Forschung eher für Verwirrung als für Erkenntnisgewinn gesorgt hat, soll in der vorliegenden Studie unter dem Stichwort „Abstraktheit der dichterischen Bilder“ ausdrücklich thematisiert werden.
Das Verhältnis von Wort und Bild in einem dichterischen Text stellt sich nicht nur als ein Problem für die Interpretation mittelalterlicher Dichtung dar, es betrifft auch aktuelle Bemühungen zu diesem Thema. So konnte man bis vor wenigen Jahren den Terminus „dichterische Bilder“ in der Literaturdiskussion noch verwenden, weil damit die selbstverständliche Vorstellung verbunden war, es gehe in künstlerischen Texten, mit denen es die Germanistik ja in erster Linie zu tun hat, um ein Verhältnis gegenseitiger Ergänzung von Text und Bild, also um Einheit. Einen allgemeinen Konsens darüber, denn nur von ihm ist hier die Rede, scheint es nicht mehr zu geben.
So wurde im Jahre 1988 unter der Schirmherrschaft der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Kongreß veranstaltet mit dem programmatischen Titel „Text und Bild - Bild und Text“. Im Referat „Zur Eröffnung des Symposions“ erklärte Wolfgang Harms u.a.: [...] „mit ‘Text’ lassen sich alle sprachlichen, mit Bild alle bildlichen (bildnerischen) Medien der menschlichen Kulturarbeit abkürzend bezeichnen.“ Damit wegen der literarischen Form des Kongreßtitels keine Mißverständnisse aufkommen konnten, wurde folgendermaßen kommentiert: [..] „mit der Formulierung ‘Text und Bild, Bild und Text’ wollten wir die Suggestion einer prinzipiellen Priorität des einen vor dem anderen ausschließen“. Dem ist zuzustimmen, aber dem folgenden nicht mehr: „Vielleicht greife ich nicht zu weit vor, wenn ich sage, daß in diesen Zwillingsformeln mit ‘Text’ das tatsächlich verbal Artikulierte, nicht ein diffus ungeformt vorgestellter Inhalt gemeint ist, entsprechend mit ‘Bild’ das anschaulich Dargebotene, nicht das nur potentiell Vorstellbare “ (Harms, 1990, S. 5). Das ist eine völlig unverständliche Parzellierung und Stückelung der künstlerischen Einheit von Wort und Bild, die vorgenommen wurde, um mit Hilfe der Operationalisierung, einem wissenschaftlichen Verfahren der Arbeitsteiligkeit (Taylorisierung) aus der Industrieproduktion, sich dem Gegenstand des Kongresses zu nähern. Die Problemlösung nach der Methode der wissenschaftlich kleinsten Schritte ist auf das Verhältnis und Verständnis der Einheit von Bild und Text nicht anzuwenden.
Der ungewohnt technologische Umgang mit der Einheit von „Text und Bild“, wie er sich ausgerechnet auf einer Germanistentagung zeigte, ist erstaunlich. Dem Kongreßbericht zufolge hat man es bei „Text und Bild, Bild und Text“ durchgehend mit zwei Künsten und zwei verschiedenen Medien zu tun, von denen sozusagen „arbeitsteilig“ das „Bild“ den Geisteswissenschaften (Kunstgeschichte und Volkskunde), das „Wort“ bzw. der „Text“ der Germanistik zugeordnet wurde. Eine solche Spaltung des Zusammenhangs ist zugleich eine Art „Abtretungserklärung“ der Germanistik für den gesamten Bereich „sprachlicher Bilder“ an die Disziplinen Volkskunde und Kunsthistorie. Sie ist durch nichts gerechtfertigt. Was die Deutung von Kunst und künstlerischen Texten betrifft, so hat eine Universalhermeneutik nicht den geringsten Vorsprung gegenüber der Literaturwissenschaft und ihren Methoden. Jede künstlerische Einheit von Bild und Text ist, wie das Sphinxrätsel, sui generis immer schon ein Problem, bei dessen Lösung man etwas riskieren muß. Es gibt keinen „arbeitsteiligen“, wissenschaftlichen Trick oder eine universelle Hermeneutik, mit der man das Risiko, die Frage nach dem Zusammenhang von Bild und Text falsch verstanden oder beantwortet zu haben, umgehen kann.
Jeder Germanist kann sich jedoch mit Fug und Recht auf die „wahrheitsverbürgende“ Struktur seiner subjektiven „Alltagshermeneutik“ bei der Deutung dichterischer Sprache verlassen; ebenso, wie sich vergleichsweise die „Kritische Theorie“ immer wieder auf die „wahrheitsverbürgende“ Struktur der Umgangssprache als ihrer ureigenen Basis für Wahrheitsfindung berief.
Es geht in diesen wenigen Sätzen nicht um eine destruktive Kritik des Kongresses 1988, sondern darum, einem Mißverständnis über die „Einheit“ von Bild und Wort, wie sie hier angedeutet wurde, gleich am Anfang vorzubeugen. Im Rahmen der eigenen Überlegungen zum Thema „dichterisches Bild“ spielt weder das „tatsächlich verbal Artikulierte“, noch das „anschaulich Dargebotene“ im o.a. Sinne eine Rolle. Das „dichterische Bild“ ist im Gegensatz zur Auffassung auf dem o.a. Kongreß eher das „fiktive“, d.h. in der Vorstellung und Phantasie „gemachte“ Bild, nicht nur das „diffus vorgestellte“, weil es erst im „Kontext“ von Wort und Bild seine akustisch-optische Prägnanz erhält und dadurch als Einheit von Bild und Wort in der Phantasie des Hörers existieren kann.
Auf demselben Kongreß gab es auch bemerkenswerte Gegenstimmen, z.B. die von Christel Meier (1990, S. 37 ff.) in ihrem Referat „Malerei des Unsichtbaren“ mit dem Untertitel „Über den Zusammenhang von Erkenntnistheorie und Bildstruktur im Mittelalter“. Sie verweist auf Hugo von St. Victor und seine Formel „vom Unsichtbaren im Sichtbaren“ (S. 37f), auf die „verschiedenen Leistungen des äußeren und des inneren Sehorgans“ und darauf, daß nach seiner Meinung für eine „Schau nicht das Auge des Körpers, sondern des Herzens vorbereitet werden muß“. Das gilt insbesondere für die abstrakten dichterischen Bilder des Parzivalprologs. Sie fallen wirklich aus dem Rahmen des üblichen Verstehens, so daß man sich ihren Sinn nur auf künstlerischem Wege erschließen kann.
Es gibt zwei Arten von dichterischen Bildern, solche, die etwas veranschaulichen im Sinne der alten Lehre der Poetik, und „abstrakte“, die gleichzeitig etwas verhüllen, mithin auf eine andere Art etwas „veranschaulichen“: Wenn sich dem Romanhelden Parzival beim Gesang der Vögel „die Brust weitet“ (118,16-17), kann man an diesem körperlichen Vorgang ablesen, daß sich im Gemüt des Helden ein entsprechendes seelisches Geschehen auch innerlich „ausbreitet“, z.B. als Gefühl für Schönheit dieser Naturerscheinung. Wenn derselbe Held, von seinem Jagdinstinkt getrieben, einen Vogel tötet und ihm anschließend die Tränen kommen, weiß man, daß er ein mitleidiges Herz hat. Der Zuhörer identifiziert sich mit dem Romanhelden, indem er synchron dieselben körperlichen und seelischen Bewegungen mitvollzieht und ohne lange Erklärungen versteht, was den Romanhelden bewegt. Solche einladenden Metaphern, die wie Miniaturen den ganzen Text durchziehen, bestimmen durch ihre Fülle den ersten Eindruck des Parzivalromanes.
Daneben gibt es völlig andere dichterische Bilder, die man zwar sieht, wie Parzival; die Dinge aber, um die es wirklich geht, scheinen unbegreiflich zu sein. Der Prototyp hierfür ist ein besonderes „dinc daz hiez der Gral“ (235,23). Er ist sozusagen die paradoxe, „abstrakte Veranschaulichung“ des rätselhaften Gralproblems: der Form nach zugleich Verhüllung und Enthüllung der Botschaft des Romans. - Der Gral ist das zentrale abstrakte Bild des Romans, so wie es der zwivel für den Prolog ist. Im Text sind beiden Bildern weitere dichterische „Abstraktionen“ zugeordnet, die in ihrem Zusammenspiel das Romangeschehen entscheidend prägen. Diese verschließen sich nicht zuletzt deshalb dem o.a. „selbstverständlichen“ Zugriff, weil sie mit dem größten Rätsel des Romans, seinem trinitarischen Menschenbild, etwas zu tun haben. Von diesem Bild sagt Wolfram: „des nemet künstecliche war“:
„man unde wîp diu sint al ein; als diu sonne diu hiute schein, und ouch der name der heizet tac. Der enwederz sich gescheiden mac: si blüent ûz eime kerne gar. Des nemet künsteclîche war.“ (173, 6).
Auf die „künstlerische“ Wahrnehmung und nicht auf kunst-wissenschaftliche Erklärung kommt es an. Das gilt für alle abstrakten und nicht nur religiösen dichterischen Bilder. Sie drängen sich nicht auf, sondern fordern heraus, vor allem dann, wenn es sich um Rätselbilder handelt, die man als solche zuerst einmal identifizieren muß, bevor man versuchen kann, behutsam ihr Geheimnis zu lüften. Die künstlerische Wahrnehmung, von der Wolfram spricht, ist als grundlegende Vorbedingung von der zuerst genannten selbstverständlichen Anschaulichkeit der Bilder zu unterscheiden.
Der folgende Vergleich kann vorab den Unterschied verdeutlichen: Das bereits zitierte Beispiel vom Gesang der Vögel, der Parzival die „Brust weitet“, stammt aus dem Erzähl- und Lebenszusammenhang des III. Buches. Nun ist auf der relativ abstrakten Ebene des Prologs von einem Herzen in derselben Brust des Romanhelden im Zwiespalt der Gefühle die Rede. Wenn man hört „ist zwîvel herzen nâchgebûr“, wird man sicherlich noch keine Vorstellung von einem „Brustkorb“ haben, in dem das Herz des Helden schlägt. Dieser Text scheint, oberflächlich gesehen, eher eine abstrakte begriffliche Aussage als ein dichterisches Bild zu sein. Im Hintergrund des Eingangsverses handelt es sich jedoch, wie die folgende Analyse zeigt, eindeutig um ein solches: Der „sich weitende Brustkorb Parzivals“ wird in diesem Bild formal zu einem Vogelkäfig („gebûr“, Vogelbauer), in dem das Herz wie in einem Gefängnis eingesperrt ist. Im Vergleich zur sinnfälligen Körperhaftigkeit des seelischen Ausdrucks beim bloß anschaulichen Bild im ersten Beispiel, wird die „Sinnfälligkeit“ seelischen Geschehens auf einer noch tiefer liegenden Ebene menschlicher Existenz angesiedelt, d.h. abstrahiert: Das Herz ist eingesperrt wie ein Vogel in einem „Brustkorb“; der wird aber, wie im ersten Beispiel, gar nicht mehr erwähnt, sondern gleich durch das Bild des „Vogelbauers“ („gebûr“) ersetzt. Das tertium comparationis heißt hier jedoch „Gerippe“ (Rippen des Vogelbauers und des Brustkorbes) und signalisiert „tödliche Bedrohung“. Es handelt sich bei dieser „Abstraktion“ um nichts anderes als eine auf die Spitze getriebene Versinnlichung, zu der man nicht immer bereit ist, weil sie u.U. ein Hinabsteigen in die „Niederungen“ menschlicher Existenz bedeutet. In diesem Sinne ist die Interpretation der folgenden als „abstrakt“ bezeichneten dichterischen Bilder Wolframs ein Versuch, ein „Unsichtbares sichtbar (zu) machen durch die Realität“ des künstlerischen Textes (Max Beckmann, 1965, S. 20). Entscheidend ist, mit welchen Mitteln ein Dichter diese Wirkungen erzielt. Wegen der Interpretation selbst sei auf das entsprechende Kapitel verwiesen, in dem die o.a. Interpretationsvariante des Eingangsverses begründet wird. Es geht primär um den Bildhintergrund, auf dem der Eingang des Prologs erscheint.
In der folgenden Gegenüberstellung soll aus methodischen Gründen an zwei motivgleichen Beispielen der Unterschied zwischen einem anschaulichen und einem abstrakten dichterischen Bild erläutert werden: Die erste Gruppe der anschaulichen dichterischen Bilder hat eher einen „Status“ von Anschaulichkeit. Es sind „Stehbilder“, die im Text in der Form von Wörtern „expressis verbis“ fixiert sind. Man findet sie leicht wieder, wenn man sich ihrer erinnern möchte. Die abstrakten dichterischen Bilder dagegen sind gekennzeichnet durch eine dynamische Struktur. Diese entfalten sich erst im „Vorübergang“; d.h. sie „existieren“ nur in „statu nascendi“ und verflüchtigen sich zwangsläufig sehr schnell wieder, weil man sie nicht an einzelnen Wörtern festmachen kann. Sie sind im Text „expressis verbis“ als Bildbeschreibungen gar nicht vorhanden, sondern „existieren“ erst durch die „ergänzende“ Mitwirkung der „Zuschauer“ und Zuhörer als Mitspieler in einem vom Dichter geplanten Darstellungs- und Erkenntnisprozeß. Im Vergleich der beiden o.a. „Brustbilder“ aus dem Parzivalroman, der im zweiten Fall, im übertragenen Sinne, „unter die Haut geht“, wird der Unterschied der Wahrnehmung deutlich: Indem man den Text „künsteclich wahr - nimmt“, bedient man sich seiner verborgenen Zeichen, um in der eigenen Phantasie „ selbst ein Bild zu machen “. Dabei setzt man sich dem Wagnis von Versuch und Irrtum aus, bis sich Zeichen (oder Zeichenfragmente) wie bei einem Puzzle zum Ganzen eines abstrakten dichterischen Bildes fügen. Ein solches fiktives dichterisches Bild existiert als Spiegelbild sinnfälliger Zeichen im Text in der Phantasie und ist nicht unmittelbar anschaulich.
Neben dem „zwîvel“ im Kontext des Prologeingangs gehören u.a. die drei Namen Parzivals zu den abstrakten Bildern des Romans, die dem Bemühen des Dichters um ein trinitarisches Menschenbild, als dem größten Geheimnis der menschlichen Existenz, eine gleichnishafte Struktur verleihen. Diese rätselhafte trinitarische Struktur ist m.E. maßgebend für das Grundkonzept der Dichtung insgesamt. Selbst das zentrale Bild des Parzivalromans, der Gral und die ihn umgebenden Motive scheinen sich in ihrer abstrakten Perspektive, nicht zuletzt auch „ im Durchgang durch ein orientalisches Medium“ (Konrad Burdach, 1938, Neuaufl. 1974 Hrsg. Johannes Rathofer, S. XIX), derart zu verwandeln, daß dem Leser möglicherweise Zweifel aufkommen, ob der Gral nach seiner Metamorphose in diesem Medium überhaupt noch mit dem „Parzival“, wie er überliefert wurde, etwas zu tun hat. Derart zweifelhafte Gefühle sind jedoch nicht neu. Die geistliche Vorübung für die Wahrnehmung von sich verwandelnden Wörtern und Bildern im Parzivalroman ist der Parzivalprolog.
Meine Überlegungen zum „Eingang“ des Parzivalprologs sind der Versuch, den ersten programmatischen Doppelvers als ein abstraktes dichterisches Bild zu verstehen, das durch das ebenfalls abstrakte Elsterngleichnis gestützt wird. In ihrer Zusammengehörigkeit als „vliegendes bîspel“ nimmt dieses dichterische Bild des Eingangs, als Einheit von Text und Bild, programmatisch das Romangeschehen als Ganzes vorweg.
Hauptproblem der Interpretation ist, daß der Eingangstext des Prologs (1,1-2) einerseits das wichtigste dichterische Bild enthält, es andererseits aber wie eine Hülle umschließt, damit man - wenn überhaupt - es nicht auf den ersten Blick erkennt. Als Text- und Bildzusammenhang wird der Eingangsvers der Form nach dadurch zu einem Rätsel , das es zu lösen gilt, um den Zugang zum Ganzen zu gewinnen. So gesehen handelt es sich um ein „Erlösungsrätsel“, das den Anfang des Parzivalromanes als eine Orakelfrage bestimmt. Ob man ein solches löste oder nicht löste, hatte immer schon weitreichende Folgen.
Eine gewisse „Ratlosigkeit“ dem Parzivalprolog gegenüber mag ursächlich damit zusammenhängen, daß man zeitgenössische Begriffe, wie z.B. den zwîvel-Begriff aus dem „Gregorius“ Hartmanns von Aue, als Maßstab anlegte (Heinz Rupp, 1961, S. 32 mit Verweis auf Hermann Schneider, Parzival-Studien, S. 11-31). Ein anderer Grund mag der unglückliche Umstand sein, daß die nachempfundene Urfassung durch eine ungenaue Transkription der Eingangsverse aus den Handschriften entstellt wurde und unnötige Schwierigkeiten verursachte. Das kann man am Beispiel des Wortes „nâchgebûr“, das in dieser Form in der Mehrzahl der Textzeugen aus dem 13. und 14. Jahrhundert als ein Wort „nâchgebûr“ nicht vorkommt, nachweisen. So wurden z.B. die Wörter „nach“ und „gebur“ in einer Transkriptionsliste, die Uta Ulzen (1974 S.38) der Herausgabe der Parzivalhandschriften (als Faksimiles) beifügte, im Gegensatz zu ihrer Schreibweise in den Handschriften beide stets zu einem Wort vereinigt.
Wenn Karl Lachmann (1891) „nachgebur“ als ein Wort transkribiert und mit „Nachbar“ übersetzt, macht das zwar einen besseren Sinn als jede mögliche andere Umschreibung oder Verkürzung. Dennoch lassen sich die getrennt geschriebenen Wörter „nach“ und „gebur“ nicht ein für allemal in diesem Sinn semantisch fixieren. - Erst nachdem sich bei der vorliegenden Deutung „gebur“ als zweideutige Äquivokation zu erkennen gab, erschloß sich die vermutete Einheit von „Sinn und Unsinn“ im Bild des Eingangsverses, den Gottfried von Straßburg möglicherweise zum bevorzugten Gegenstand seiner dichterischen „Kritik“ im kreativen Bild des „bickelwort-Vorwurfs“ machte.
Was dieser Vorwurf bedeutete, wird für die folgende Studie auf teilweise empirischem Wege ermittelt und den eigentlichen Überlegungen im Kontext einer kurzgefaßten Literaturrecherche vorangestellt. - Wem das Leitbild des „zwîvels“ in einem bewußt reduzierten, freiwillig „erniedrigten“ Verständnis allzu „fleischlich“ erscheint, der mag sich an den Wortteil „vel“ als die Abbreviatur von „velum“ oder „velatum“ (lat. Schleier bzw. Hülle) halten. Damit nähert er sich einer etwas „anspruchsvolleren“ Verständigungsebene: Der Schleier als Verhüllung ist ein Bild, das in der Kunst generell als Synonym für Form gebraucht wird. Auch biblische Autoren haben sich ebenso wie ihre Interpreten (z.B. Paulus und Augustinus, später auch Mohammed) vorzugsweise des Bildes als einer „Hülle“ bzw. Form bedient, unter der sich das „schlechthin andere“ (wie etwa ein Glaubensinhalt) zugleich verbergen und „enthüllen“ läßt.
Im Gegensatz zu einer abstrakten Deutung im Anschluß an ein außerhalb der Dichtung liegendes Motiv, wie das der Gregoriuslegende, wonach der Zweifel in die Verdammnis führt, läßt der Eingangsvers des Prologs aus sich selbst heraus eine naheliegendere textinterne Deutung zu: Er spricht von einem Herzen, das von „Hüllen“ eng umschlossen wird. Dieses Gefangensein - auch im übertragenen Sinne -, das den Menschen daran hindert, sich selbst, die Welt und Gott zu erkennen, beherrscht im Grunde den ganzen Prolog und große Teile des Romans.
Es handelt sich bei dieser Studie um den Versuch, anhand zentraler dichterischer Bilder die mögliche Hintergrundstruktur des Parzivalromanes zu identifizieren. Damit kann man den „irritierenden Perspektivenwechsel für [...] die von Wolfram gewünschten Zuhörer, die sich nicht gutgläubig der Erzählung anvertrauten“ (Bumke, 1991, S. 236f.) als die „andere Hälfte“ der Romanwirklichkeit einordnen und verstehen. Das ist wichtig, damit einem als Zuhörer am Ende nicht der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dann nämlich, wenn „zuletzt fast alles in Frage gestellt (ist), was vorher als gesicherte Grundlage für das Verständnis der Handlung gegolten hatte“ (Bumke, 1991, S. 237). Nur dann läßt sich z.B. das Beziehungsgeflecht zwischen den Bildern des Prologs und den verschiedenen Romanebenen, wie sie durch die drei „Namen“ Parzivals signalisiert werden, darstellen.
Die Hintergrundstrukturen sprachlicher Bilder, vor allem auch die Relationen von Vordergrund und Hintergrund des gesprochenen Wortes, sind abstrakt. Wenn man Begrifflichkeit und Bildlichkeit eines Textes miteinander vergleichen will, um etwas über ihre Beziehungen zu erfahren, entsteht das methodische Problem, Abstraktes und Sinnliches miteinander vergleichen zu müssen. Im Bereich der Kunst läßt sich zwar prinzipiell kein rationaler und in der Wissenschaft ebensowenig ein künstlerischer Maßstab anlegen. Man könnte jedoch versuchen, beide Bereiche auf mittlerer Ebene zwischen sprachlogischen und bildlogischen Strukturen vermittelnd, d.h. anhand eines anderen Beispieles, „vorübergehend“ und schematisch „gleichnamig“ zu machen. Zu diesem Zweck müßte ein künstlicher Parameter, ein „Mittelmaß“ erfunden werden; das ist eine „Paßform“ bzw. Zwischenform, die der Abstraktheit der Romanstruktur einerseits und der Sinnlichkeit der Bilder andererseits, „annähernd“ gerecht werden könnte. Mit dieser „Zwischenform“ könnte man sich den unterschiedlichen Ebenen sowohl annähern, als auch unterscheiden, m.a.W.: Abstraktes und Sinnliches sowohl trennen als auch verbinden. Um es mit den Worten Wolframs zu sagen: „beidiu samnen unde brechen“ (6,26), wie in einem Spiegelbild. In der soeben beschriebenen Funktion soll das von Gottfried von Straßburg erfundene „Leitwort“ des Literaturstreites in vermittelter Form als Richtungsangabe dienlich sein.
1.2 Ein Literaturstreit im 12. Jahrhundert
In der Hoffnung, über einen der größten Dichter des 12. Jahrhunderts, Wolfram von Eschenbach, mehr zu erfahren, hat sich die Forschung immer wieder mit dem Literaturstreit zwischen ihm und Gottfried von Straßburg beschäftigt. Der Streit selbst ist zu Literatur geworden. Nicht nur deshalb ist er für die heutige Literaturwissenschaft so interessant.
„Polemisiert Gottfried gegen Wolfram?“, fragt Peter Ganz (1978, S. 69). Mit dem Hinweis auf zahlreiche Forscher, die sich mit diesem Thema befaßten, sagt er: „Es scheint eine unnütze Frage zu sein, denn es ist wohl heute von niemandem mehr bestritten, daß die `berühmte Karikatur´ gegen Wolfram gerichtet ist." - Er plädiert mit Recht dafür, eine „eindeutige Polemik" sei Gottfried nicht vorzuwerfen, und deshalb solle das „Gericht" (Literaturkritik und Fehdeforscher?) „die Verleumdungsklage gegen Gottfried aus Mangel an Beweisen ablehnen". Dem ist auch deshalb zuzustimmen, weil unter dem Gesichtspunkt persönlicher Streitigkeiten und Fehden zwischen beiden das sachliche Interesse der Philologie an diesen beiden großen Dichtergestalten und ihrer Dichtung zu sehr in den Hintergrund gedrängt werden könnte. Nellmann (1994, S. 123) meint zum Dichterstreit: „Die immer subtiler werdende Fehdeforschung hat freilich durch mancherlei Überspitzungen erheblich an Kredit verloren. An keiner einzigen Stelle des 'Parzival' hat sich eine Reaktion Wolframs auf Gottfried zweifelsfrei nachweisen lassen."
Unter Hinweis auf den Tristan-Text Vers 4638-4690, in dem das o.a. Fremdzitat als „Karikatur" bezeichnet wird, kommt Ganz (1978, S. 69) abschließend zu einer anderen etwas unverständlichen Aussage: „Wenn man annimmt, daß Gottfried sagen wollte, daß er den Parzivalprolog unverständlich fand, so geht dies aus dem vorliegenden Text nicht hervor, sondern bedeutet eine Rückwärtsprojektion der Schwierigkeiten, die moderne Philologen in dem Wolfram-Text finden" (Ganz, 1978, S. 83). Gottfrieds Schwierigkeiten als Zeitgenosse Wolframs waren sicher anderer Natur als die der modernen Forschung. Den Sinn des Parzivalromans und der darin verwendeten Bilder, auf die seine Kritik zielt, hatte er recht gut verstanden. Ob Gottfried vor Abfassung seines Literaturexkurses gegen Wolfram den Parzivalprolog bereits kannte, weiß man nicht. Nach übereinstimmender Meinung der Forschung entstand dieser erst, als der gesamte Roman schon fertig war, sodaß er ihm wahrscheinlich noch unbekannt war. Wenn man die Entstehungszeit der Erec-Satire (2,15-24) und Enite-Kritik (3,15-24) berücksichtigt, welche die Schwerpunkte im zweiten Teil des Prologs bilden, könnte man annehmen, daß es sich um eine derbe Replik auf die Anspielungen Gottfrieds von Straßburg im Literaturexkurs des Tristan handelt. Abgesehen davon, daß hier keine Fehdeforschung im engeren Sinne betrieben werden soll, müßte die o.a. Aussage Nellmanns vielleicht doch revidiert werden.
Sollte Gottfried von Straßburg den angegriffenen Autor und den von ihm kritisierten Text absichtlich verschweigen, hat das einen guten Grund: Gemessen an der ebenso lapidaren wie vernichtenden Erec-Satire im Parzivalprolog, die Hartmanns Dichtung gilt, ist seine Karikatur im „Tristan“ als Kritik an Wolfram von Eschenbach auf den ersten Blick relativ harmlos.
Wenn man den Tenor der Literaturkritik im Tristan (4638-4690) beachtet, hat man keineswegs den Eindruck, Gottfried wolle sich selbst verteidigen. Er erklärt sich selbst zum Fachmann für gewisse Regeln der Dichtkunst (4645) und macht sich gleichzeitig zum Anwalt Hartmanns von Aue (4654f), sinngemäß etwa so: Wenn „irgendjemand“, dessen Name es nicht wert ist genannt zu werden (nämlich Wolfram von Eschenbach), daherkommt und versucht, Hartmann den Dichterkranz (4654f) vom Haupt zu reißen, d.h. ihn zu kritisieren wagt, so haben „wir“ (im „plural majestatis“ sei es gesagt, siehe Tr. 4645 u. 4649) da noch ein Wörtchen mitzureden!
Das ist deshalb nicht verwunderlich, weil Wolfram, nach Angaben im Literaturdiskurs Gottfrieds nicht ihn, sondern Hartmann von Aue hart angegriffen hatte. Die naheliegende Aufgabe der Forschung bestünde also darin, nach einer solchen Kritik an der Dichtung Hartmanns von Aue im Parzivalprolog Ausschau zu halten. Im Rahmen dieser Studie wird es versucht. Gottfried könnte sich z.B. über die bitterböse Erec-Satire (S. 185ff.) und Enite-Kritik (S. 168 ff.) im Parzivalprolog maßlos geärgert haben, die im zweiten Teil dieser Studie identifiziert und diskutiert wird. Vom Effekt her gesehen, muß Wolframs höhnische Satire in der Literaturszene des 12. Jahrhunderts wie ein Skandal gewirkt haben.
Zunächst soll jedoch die anstehende Frage bedacht werden: Bietet ein historischer Literaturstreit der heutigen Wissenschaft die Möglichkeit, über die „Andersheit" und damit über die Kunst Wolframs auf dem Hintergrund einer geschichtlichen Folie etwas zu erfahren; selbst dann, wenn man davon ausgeht, daß Gottfried in mancher Hinsicht Wolframs Dichtung nicht verstehen konnte oder wollte? Ein eventuelles Nichtverstehenkönnen oder -wollen hat jedenfalls der Rezeption des Parzivalromans überhaupt nicht geschadet.
Es kann nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, die Zahl möglicher Spekulationen zu erweitern oder Texte ausfindig zu machen, aus denen man über die Tatsache des Streites noch mehr erfahren könnte. Es ist vielmehr zu fragen, ob die sprachliche Form des Prologtextes auch inhaltliche Rückschlüsse zuläßt, denn bloße Spekulationen helfen nicht weiter. Es liegt die Vermutung nahe, daß Wolfram von Eschenbach, in der Form des Textes verborgen, eine scharfe Attacke gegen Hartmann oder Gottfried geführt haben könnte, gegen die sich keiner der beiden wehren konnte, weil sie nicht expressis verbis für jeden erkenntlich, sondern in Form einer bildhaften Satire vorgetragen wurden. Um der Kritik Wolframs begegnen zu können, hätte man seinen Text deuten müssen, womit die Vorwürfe dann auch inhaltlich ans Tageslicht gekommen wären. Das konnte beiden Dichterkollegen nicht angenehm sein. In der sprachlichen Form blieben sie wenigstens halbwegs verschleiert. Deshalb zieht Gottfried von Straßburg es vor, „durch die Blume zu reden“. Es kann also hier nur darum gehen, Wolframs Text von der Formseite her so weit zu dechiffrieren, daß ein Blick auf mögliche Inhalte frei wird. Dann erst ließe sich sagen, worüber man sich damals wirklich gestritten haben könnte.
In seinem o.a. Aufsatz „Polemisiert Gottfried gegen Wolfram?“ macht Ganz (1978, S. 73) zu dem wohl wichtigsten Wort der Literaturkritik Gottfrieds, nämlich dem „bickelwort“, eine interessante Bemerkung, die es verdient, für den Fortgang der Studie festgehalten zu werden. Eine Fußnote dazu lautet: „bickelwort ist ein hapax legomenon ." Es bedeutet (griech.): „ einmal gesagt“. Gemeint ist ein Wort, „das, in einer nicht mehr gesprochenen Sprache nur einmal belegt ist und in seiner Bedeutung häufig nicht genau bestimmbar“ ist (dtv, 1995, 20. Bd.). Das „bickelwort“ ist also eine originale Wortschöpfung Gottfrieds; insofern erübrigt sich eine etymologische Untersuchung. Eine kulturkundliche Untersuchung und Deutung dieses „einmaligen“ Terminus aus der historischen Literaturkritik bietet sich an.
Dem „bickelwort", das im Zentrum der Literaturkritik Gottfrieds steht, wendet auch Nellmann in einem Aufsatz „Dichtung ein Würfelspiel“ seine besondere Aufmerksamkeit zu. Er stellt fest, daß man sich über die Grundtendenz der aus dem Tristan zitierten Verse relativ einig zu sein scheint, jedoch: „ Ausgeschlossen von diesem Konsens ist [...] der Terminus bickelwort, der - als Kernpunkt der Polemik - immer wieder zu Überlegungen reizt.“ Weiter heißt es: „Keiner dieser Vorschläge hat sich allgemein durchgesetzt, keiner ist wirklich befriedigend“ (Nellmann, 1994, S. 46). Die Grundbedeutung von „Bickel“ scheint klar zu sein. ‘bickel’ heißt Würfel und zwar Würfel aus Knochen. Die Bedeutung von „ Würfelworten“ im Kontext der Gottfriedschen Literaturkritik ist damit jedoch noch nicht geklärt.
Unklarheit ist - mit andern Worten - noch immer der Stand der gegenwärtigen Diskussion zum Thema „bickelwort“. Beim Deutungsversuch des „bickelwortes" macht Nellmann einen interessanten „Umweg". Er überprüft zunächst den Sinn des Wortes „schanze": „Mein eigener Deutungsvorschlag bezieht sich nicht auf allgemeinere Charakteristika in Wortschatz oder Stil Wolframs, sondern auf ein ganz bestimmtes Wort im Parzivalprolog. In den Versen 2, 5-16 wird über die Schwierigkeiten des Textes gesprochen und zum Abschluß (2,13), quasi als Zusammenfassung des Gesagten, das Wort „schanze" (`Fall der Würfel') verwendet: ein provozierendes Wort, scheint es doch anzudeuten, daß Planlosigkeit und Zufall zum Programm des Romans gehören". Nellmann vermutet nämlich zwischen „bickelwort" und „schanze" einen logischen Zusammenhang. Das Wort, „aus dem Altfranzösischen übernommen, bedeutet [...] zunächst den `Fall der Würfel', sodann den (glücklichen) ‘Zufall', das `Risiko“ (Nellmann, 1994, S. 460).
"swer mit disen schanzen allen kan, an dem hat witze wol getan“ (2,13-14) „Wer sich auf alle diese verschiedenen Fälle der Würfel bezieht, bei dem hat sich der Verstand als hilfreich erwiesen."
Was im Wort „schanze" zunächst nur eine „Andeutung" ist, nimmt im Fortgang der aventiure Wolframs in der Gestalt der sog. „Selbstverteidigungsrede" (115,21-116,4) schärfere Konturen an; insofern nämlich, als darin unter dem Vorwand -„ichne kan decheinen buochstap = ich kann Buchstaben bzw. Bücherwissen nicht ausstehen [1] “ - dem dichterischen Wort im Verhältnis zum geschriebenen Text eine übergeordnete, mindestens aber völlig selbständige Bedeutung zuerkannt wird. „Zweideutigkeit" gilt also für Wolfram nicht nur im Sinne einer besonderen „ schanze", sie wird in einem allgemeineren Sinne zum Programm erklärt und zwar als Widerspruch von gesprochenem und geschriebenem Wort. Das kann Gottfried nicht überhören.
Diese Aussage betrifft insbesondere das Verhältnis von dichterischem Bild und Begriff als Einheit. Beide erscheinen im Gewand eines einzigen Wortes und werden - wenn man sie denn als dichterisches Bild identifizieren kann, weil man nicht zu den „tumben liuten“ zählt - überhaupt nur als Einheit wahrnehmbar. In dieser unauflöslichen Zuordnung von Wort und Bild entsteht die von Wolfram gewollte und von Gottfried kritisierte dynamische „Hin- und Herbewegung" zwischen sinnlicher Anschauung und reflektierender Distanz im Umgang mit Sprache, wenn es sich um ein dichterisches Bild handelt.
Die Idee Hermann Menhardts (1955/56, S. 237), die sogenannte „Selbstverteidigung" (115,21-116,1) in den Prolog einzuordnen - und zwar zwischen den Versen 3,24 und 3,25 - findet dadurch eine gewisse Bestätigung, da Wolfram gerade an dieser Textstelle sagt, daß er Buchstabenweisheit nicht mag bzw. leiden kann und erklärt, wie man „sich anders wol verstet". Von „nicht lesen“ oder „nicht schreiben können“ ist überhaupt keine Rede:
„hetens wîp niht für ein smeichen, ich solte iu vürbaz reichen an disem maere unkundiu wort, ich spraeche iu die âventiure vort. Swer des von mir geruoche, der enzel si zu keinem buoche. ichne kan decheinen buochstap. dâ nement genuoge ir urhap: diu âventiure vert âne der buoche stiure“. (115,21-116,4)
Das Unbehagen über Buchgelehrsamkeit, wie es in diesen Versen zum Ausdruck kommt, paßt inhaltlich recht gut zu den bereits im Eingang gemachten Bemerkungen (2,5-8) über die Richtung, in der sich das maere entwickelt, und was von den Zuhörern an Beisteuer („stiure“), die über das bloß Geschriebene hinausgeht, erwartet wird. Wolfram gibt also interessierten Zuhörern Auskunft darüber, was sie seiner Meinung nach gerne gewußt hätten bzw. wissen müßten:
„ouch erkante ich nie sô wîsen man, ern möchte gerne künde han welher stiure disiu maere gernt und waz sie guoter lêre wernt." (2,5-8)
„Andererseits kenne ich keinen so klugen Mann, der nicht gern gewußt hätte, welche Unterstützung (welchen Tribut) diese Erzählung verlangt, und was sie an guter Lehre bietet“. Diese von ihm selbst übersetzten Verse kommentiert Nellmann (1994, S. 461) im Anschluß daran so: „Im Parzival verwendet Wolfram das Neuwort „schanze" dort, wo er von den Leistungen spricht, die er von seinem Publikum erwartet“. Deshalb wählt er für das entsprechende Wort „stiure" den Ausdruck „ Unterstützung" bzw. „Tribut".
Nun hat das äquivoke Wort „stiure" von vornherein schon eine zweifache Bedeutung: 1. Steuer oder Steuermann (Lexer: stiure, swm.); 2. Steuer als „Unterstützung des Herrn durch Abgabe" (Lexer: stiure, stf.). Weil im unmittelbar folgenden Zusammenhang mit dieser Textstelle von „schanze", also vom „Zufall der Worte" die Rede ist, kann man das Wort „stiure" nicht gut im Sinne von „zu erbringender Leistung" verstehen, wenn nicht gesagt wird, was mit „Leistung“ gemeint ist. Wer z.B. beim Würfelspiel „nachhilft“, erbringt zwar eine „Leistung“, als ob er im Sinne von „corriger la fortune“ den Gang der aventiure beeinflussen könnte. Das gilt auch für das Würfelspiel der Worte: Das kann kein noch so gutes Publikum wollen! Der Ausdruck „Unterstützung“ meint noch etwas anderes. Was am Begriff „Leistung“ in diesem Zusammenhang stört, ist der Eindruck des „Bewußt-Gewollten“ und des „Hinzutuns“ von etwas Unbestimmbaren, das von der Subjektivität der Zuhörer abgelöst ist.
Vom Zuhörer wird freilich eine besondere „Leistung“, ein Hinzutun im Sinne von „Hingabe“ in einem künstlerischen Sinn erwartet: Er muß sich selbst, mit seiner Subjektivität einbringen, damit Kunst als ein „Medium“ überhaupt erst entstehen, d.h. „existieren“ kann. Das wäre eine kreative „Leistung“, die mit Sensibilität mindestens ebenso viel zu tun hat wie mit Hervorbringung. Wenn „stiure“ in diesem Sinne als „Leistung“ gemeint ist, füllt sie den ersten Teil der Wortbedeutung von „stiure“ tatsächlich aus.
Darüber hinaus ist jedermann, wenn er eine Geschichte hört, daran interessiert, wie und in welche Richtung sie „steuert“, d.h. weitergeht. Mit gleichem Recht könnte man „stiure" in diesem Zusammenhang („welher stiure disiu maere gernt") also auch übersetzen: „welche Richtung die Geschichte einschlagen möchte"; denn dieses maere „vert âne der buoche stiure" (115, 30), wie Wolfram betont. Deshalb ist sie auf kreative, phantasievolle Mitarbeit der Zuhörer angewiesen. Diese „Leistung“ besteht also in der Zusammenarbeit zwischen den Zuhörern und dem maere, ist also nicht nur passives Hören, sondern im recht verstandenen Sinne auch produktives „Hinzu-Hören“. Richtiges „Zu-Hören“ beim „Fall der Worte" ist also die „schanze": Wie die Worte „fallen", können sie nämlich dieses oder jenes oder sogar beides zusammen bedeuten. Welchen Sinn sie letztlich haben, das zu erraten, ist „Aufgabe" der Hörer. Die Motivation für diese Art der künstlerischen Mitarbeit geht vom Kunstwerk und vom Subjekt gleichzeitig aus. Kreatives Hören wird gefordert. - Die Absicht Wolframs scheint es zu sein, die Zuhörer für seine Art der Dichtung zu sensibilisieren. Indem also die Rätselhaftigkeit, Zweideutigkeit oder Zufälligkeit dichterischer Sprache nicht nur geduldet, sondern für wünschenswert erklärt wird, ist der Prolog eine Provokation. Selbst wenn Wolfram nur für sich selbst und seine Dichtung und nicht auch noch für die Zuhörer gesprochen hätte, konnte Gottfried eine solche revolutionäre Veränderung der dichterischen Sprache nicht übersehen und überhören.
Gottfried nimmt also, das war die These Nellmanns, Anstoß am Wort „schanze" und an dem Verstehensprozeß, den Wolfram mit diesem Wort verbindet. Er kritisiert den Dichterkollegen, der im Prolog ein bickelwort (d.h. ein Wort aus dem Bereich des Würfelspiels) zur Charakterisierung der neuen Möglichkeiten seines Textes verwendet hat. „Ist diese Auffassung richtig, so hat sie Folgen für die Interpretation anderer Stellen des Parzivalprologs, auf die Gottfried , nach Meinung vor allem der älteren Forschung, anspielt" (Nellmann, 1994, S. 464). Er erregt sich bei dem Wort „schanze", weil es seiner Meinung nach „Unordnung“, Zufälligkeit und Zweideutigkeit signalisiert, also Nichtübereinstimmung von Wort und Sinn. Diese konzeptionelle Zweideutigkeit im Parzivalroman (neben der Hartmannkritik expressis verbis in 143,21-30!) war wohl der Anlaß für seine Wolframkritik. Für Wolfram allerdings kann ein- und dasselbe Wort die Möglichkeit signalisieren, über einen engeren Wortsinn hinaus etwas zu sagen, das eigentlich „unsagbar“ ist und mit bloßen Worten eben nicht ausgedrückt werden kann oder darf (z.B. ein Tabu).
Nachdem Nellmann anhand eines besonderen „bickelwortes" - nämlich „schanze" - dessen Beziehung zu „bickel“, dem Leitwort der Literaturkritik Gottfrieds, geklärt hat, schließt er, daß der Terminus „bickelwort" sich in erster Linie wohl auf den Prolog bezieht. Er sagt: „Dennoch würde ich zögern, meine These, Gottfried attackiere mit dem Ausdruck „bickelwort" den Prolog , hier vorzutragen, wenn ich mich nur auf zwei isolierte Anspielungen stützen könnte. Es gibt aber eine Reihe weiterer Berührungspunkte“ (1994, S. 464). Das Ergebnis der Untersuchungen Nellmanns lautet positiv gewendet so: Gottfried attackiert mit dem Ausdruck „bickelwort“ den Prolog. In dieser Version sind seine Erkenntnisse die Basis für weiterführende Thesen zum Thema „bickelwort“ als Leitwort der Literaturkritik Gottfrieds .
In eine ähnliche Richtung wie bei Nellmann zielen die Überlegungen von W. Johannes Schröder, die wegen ihrer Ausführlichkeit hier nicht referiert werden können. Er gelangt über die Analyse eines anderen bekannten Schlüsselwortes aus der Literaturkritik Gottfrieds, nämlich „vindaere wilder maere", zu ähnlichen Ergebnissen wie Nellmann. Auf die Frage, ob Gottfried damit den Gesamtroman oder nur den Prolog habe kritisieren wollen, sagt Walter Johannes Schröder, es habe schon früh die Vermutung gegeben „er müsse insbesondere den Prolog gemeint haben"; gerade im Prolog trete die „dunkle, vieldeutige Sprache Wolframs stark hervor" (1958, S. 278); und hier fänden sich auch die Bilder von Hase und Elster, die den Vorwurf der Unklarheit und Mehrdeutigkeit geradezu herausforderten. Schröder stößt bei seiner Analyse auf einen „Leitsatz", der auf dieselbe Textstelle und dasselbe Stichwort hinausläuft, das Nellmann heraushebt:
"swer mit diesen schanzen allen kann an dem hât witze wol getân" (2,13f).
Die Untersuchung Nellmanns, die anstelle des Terminus „bickelwort" Gottfrieds von Straßburg hilfsweise das Bickelwort Wolframs, nämlich „schanze" zum Gegenstand hatte, wie die Analyse Schröders führen, obwohl die jeweilige Ausgangslage und die Gedankengänge beider Autoren verschieden sind, zu einem annähernd gleichen Ergebnis, was die Gewichtung von „bickelwort" als „Leitwort“ der Literaturkritik Gottfrieds am Parzivalprolog betrifft. Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß Schröder (1958, S. 279) von „Zwiedeutigkeit" (sic.) spricht. Sollte hiermit schon eine direkte Beziehung auch zum zentralen Wort des Prologs, nämlich dem „zwîvel" angedeutet werden? Es ist zu vermuten. Der von Schröder und Nellmann angedeuteten Spur, die zum Stichwort „bickel“ führte, möchte ich deshalb folgen, weil sowohl „bickelwort“ (von Gottfried) als auch „zwîvel“ (von Wolfram) die Prototypen von Bickelwörtern zu sein scheinen. Meines Erachtens haben sowohl Gottfried selbst als auch Wolfram sogenannte „Bickelwörter“ produziert.
Trotz der zitierten Untersuchungsergebnisse ist die Frage noch offen, was „bickelwort“ als Kritik bedeutet? Vor allem interessiert, ob in einer solchen Parodie, die immer überzeichnet, möglicherweise sachliche Argumente enthalten sind, die hilfreich sein könnten, Grundstrukturen in Wolframs Dichtung zu erahnen. Die Voraussetzung dafür ist, daß man Gottfrieds Kunstwort als Metapher überhaupt versteht. - Wie sollte man dieses Wort im 20. Jahrhundert als Karikatur oder Kritik verstehen, wenn man nicht einmal den Gegenstand kennt, der dem bildlichen Vergleich zugrunde liegt?
Soviel sei hier schon vorab gesagt: Von der Vorstellung, daß es sich bei den „bickeln“ um „Würfel“ handelt, die nur aus Knochenmaterial hergestellt wurden, wie man sie z.B. heute als regelmäßige kubische Würfel aus Elfenbein kennt, sollte man sich verabschieden. Der „bickel“ ist kein Würfel aus Knochen, sondern ein Knochen als Form des Würfels. Sie bewirkt, daß er im Spiel in einer bestimmten Weise funktioniert[2]. Das ist ein gewaltiger Unterschied! Nicht zählbare „Augen“, sondern plastische Formen bestimmen das Ergebnis eines Wurfes. In welcher Weise positive oder negative plastische Formen dieser Würfel etwas mit der Sprache Wolframs zu tun haben könnten, ist die andere, noch offene Frage.
Der mehr oder weniger glückliche Zufall beim Bickelspiel, dessen Ergebnis ja keinem Zahlenwert entspricht, das aber dennoch einem binären System von positiven und negativen Formen zugeordnet werden muß, ist nur ein Teil des inhaltlichen Verständigungsproblems. Der andere, wie diese Zufallswürfe mit der Sprache Wolframs in Beziehung stehen, ist die schwieriger zu beantwortende Frage. Eine kleinere oder größere Menge von „Augen“, die man beim Würfeln nur zu addieren braucht, ist hier jedenfalls nicht entscheidend. Es gibt in diesem Würfelspiel einen anderen Faktor als den bloßer Mengen. Um also die Sinnrichtung der Kritik im Bild des „bickelwortes“ zu verstehen, muß man versuchen, zunächst über Form und Funktion des Gegenstandes „bickel“ etwas zu erfahren. Erst danach kann die Frage geklärt werden, was der Gegenstand als Metapher im Terminus „bickelwort“ bedeutet.
Wird der Terminus „bickelwort“ in der Forschung als „Würfelwort“, „Kunstwort“ oder sogar als „Kernpunkt der Polemik“ bezeichnet, so bedeutet dies, daß man ein Wort Gottfrieds akzeptieren muß, obwohl man seinen Sinn nicht kennt. In seinem Loblied auf Hartmann von Aue zeigt Gottfried, daß er durchaus über andere verständliche Parameter für Lob und Tadel verfügt: „uzen und innen, wort unde sin, rede und meine“ müssen in kristallener Klarheit übereinstimmen. Warum aber ist sein „bickelwort“ ganz im Gegensatz zu dem, was er sonst von sich selbst und anderen fordert, so verwirrend?
Von Parametern wird gefordert, daß sie als „Maß“ dem zu Messenden entsprechen. Man kann Raum nur mit Raum, Zeit nur mit Zeit, Schönheit nur mit Schönheit, mit anderen Worten, durch Vergleich nur Gleiches mit Gleichem „messen“. Wenn man also davon ausgeht, daß Gottfried von Straßburg Wolframs Dichtung von vornherein für Unsinn hielt, wird er also logischerweise nach einem Parameter für „Unfug“ (etwas, das sich nicht fügt) gesucht haben. Mit „Unsinn“ im engeren Sinne soll hier nur ganz speziell die gleichzeitige „Nichtübereinstimmung“ von Wort und Sinn, das Beisammensein von Sinn und Nichtsinn in einem Wort oder einem Satz gemeint sein. Gottfried sagt: „Wir lassen den Zweig nicht tragen / wessen Sprache nicht sehr klar ist / nicht geglättet, nicht verständlich“ (Tr. 4659 ff. übersetzt von Dieter Kühn, 1991, S. 194).
Es ist nicht abwegig zu vermuten, daß Gottfried in der Kreation des „bickelwortes“ ganz bewußt ein „Unwort“ als „Maßstab“ für die Dichtung seines Kollegen kreierte. Vielleicht sollte es sogar ein Parameter für „Unfug“ sein, um das Beieinander von „Sinn und Unsinn“ zu veranschaulichen? Es liegt auf der Hand, daß Gottfried bei der Neuschöpfung eines solchen Wortes sich der gleichen künstlerischen Mittel bediente wie Wolfram: Zunächst wohl aus methodischen Gründen und in kritischer Absicht, dann aber doch so, daß diese Suche nach einem „Parameter“ für „Unsinn“ ein künstlerisches Ergebnis nicht ausschloß. So entstand das „bickelwort “ als ein literarisches Rätsel . Wenn man es lösen könnte, hätte man damit einen „handlichen“ „Parameter“, um Parodie und Parodiertes in mittelalterlicher Literaturkritik zu beschreiben. Das ist ein Grund mehr, der Entstehung des Wortes auf die Spur zu kommen.
Gottfried von Straßburg ließ also in seiner Literaturkritik an Wolframs Werk durch die Erfindung eines bis heute in der Forschung schwer zu überhörenden „Stichwortes“ die „Würfel" sprechen, um dem Wolfram zugedachten Schicksal des „Erfinders wilder Geschichten“ dadurch ein wenig nachzuhelfen. Er hoffte sicherlich auch, damit das Publikum in seinem Urteil über den Wert oder Unwert der Wolframschen Dichtung beeinflussen zu können. Das „Werkzeug“ dazu war ihm der „Begriff" bzw. das dichterische Bild „bickelwort", in dem das zweifelhafte Verhältnis von Wort und Sinn bei Wolfram kritisiert werden sollte.
1.3 Das Verhältnis von Wort und Bild - ein Verständigungsproblem
Wegen seiner großen Bedeutung in der Literaturkritik hat der Terminus „bickelwort“ in jüngster Zeit bei Kühn eine Reflexion ausgelöst. Darüber hinaus hat es im Titel einer Festschrift für Nellmann, „bickelwort und wildiu maere" (hg. von Dorothea Lindemann, Berndt Volkmann, Klaus-Peter Wegera, 1995), besondere Beachtung gefunden.
Dieses „bickelwort“, das im Gewande eines einfältigen Bildes daherkommt, ist viel hintergründiger, als man auf einen ersten Blick vermutet. Gottfried von Straßburg beanstandet in diesem Kunstwort die willkürliche und zufällige Art des Sprachgebrauchs bei Wolfram, während er expressis verbis - siehe „bickelwort" - nach derselben Methode verfährt: Es verbietet sich an dieser Stelle zu sagen „Quod licet Jovi, non licet bovi“; der Gedanke an eine Parodie bietet sich an. Es mögen aber auch Geltungsansprüche im Spiel gewesen sein, weil Gottfried seine hervorragende Stellung als Dichter seiner Zeit durch Wolfram gefährdet sah. Wichtig ist, daß es im Streit auch um die Sache geht.
Geht man der Dichterschelte auf den Grund, stellt man erstaunt fest, daß trotz einer negativen Tendenz, der dieses Wort seine Existenz verdankt, durch Überzeichnung ein „Mehr" an sachlicher Meinung über Dichtung darin enthalten ist, als vielleicht vorgesehen war. Die Analyse dieses Leitwortes in der Kritik Gottfrieds kann sowohl über den Urheber dieses Wortes als auch den Kritisierten, mithin über die dichterische Sprache des 12. Jahrhunderts Auskunft geben. Hieran besteht im Hinblick auf eine zeitgemäße Interpretation des Parzivalromans sicherlich großes Interesse. Die Frage, was es mit den „Würfeln“ auf sich hat, beschäftigt Kühn im Zusammenhang mit seiner neuen Parzivalübersetzung. Er stellt nachdrücklich fest: „Wolframs Sprache hat ein Spektrum, das kein Autor seiner Zeit erreichte" (Kühn, 1991, 244).
Einerseits angeregt und amüsiert durch den relativ lockeren Umgang mit einem Forschungsproblem, andererseits „irgendwie“ durch die Rede vom „Würfel, der ins Auge geht“, zum Widerspruch animiert, wurde eine Szene aus meiner Kindheit am Mittagstisch meiner Großmutter zu einer klanglichen und visuellen Erinnerung reanimiert, die mit „Würfeln“ zu tun hatte. [3]
Die Bemerkungen Kühns lösten eine Kette von Assoziationen aus, in der sich in kurzer Zeit das sachliche und akustische Inventar o.g. Szene komplettierte: Das Gespräch am Tisch selbst, das Aussehen und die Form der „Würfel“, die „Bickel“ hießen, und die Namen „butje, gatje und stönneke“ für drei von den vier Seiten des Bickels. Die vierte Seite war mit einiger Sicherheit identisch mit dem Wort für das Spiel selbst, nämlich „bickel“, d.h. „Bäuchlein“; ohne weiteres an der Form der Würfel zu erkennen. Ich brauchte eigentlich nur abzuwarten und mir innerlich zuzuschauen, bis sich das Bild vervollständigt hatte und sich der darin liegende Sinn als eine mögliche Lösung meines Problems gewissermaßen von selbst anbot. Daß mir nur drei bzw. vier Namen der Würfelseiten wieder einfielen, brachte mich anfangs in Verlegenheit, denn Würfel haben in der Regel sechs Seiten. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, daß diese tatsächlich nur vier Seiten hatten. Das stellte sich erst später heraus, als ich mir die Bickel beschafft hatte und mit ihnen experimentierte. Jedenfalls ist diese Erinnerung ein „glücklicher Zufall“.
1.4 Auf der „verte“ des „bickelwortes“
Wenn man der akustischen „verte" des „bickelwortes" folgt, kann der Gegenstand selbst" eigentlich nur ein „buckeliges" Gebilde gewesen sein; von den bis zu sechs „Augen“ auf sechs Würfelseiten verteilt, ganz zu schweigen. Jene Würfel, die ich als Kind kennenlernte, hatten nur vier Seiten, so verwunderlich das klingen mag. Wenn man an regelmäßige geometrische Formen denkt, ist es der Tetraeder, der als kleinste, überhaupt mögliche Raumform ebenfalls nur vier Seiten hat; abgesehen von der Kugel, mit nur einer in sich gekrümmten Seite. Der „bickel“ ist eine Form, die zwischen beiden (Tetraeder- und Kugelform) einzuordnen ist. Das altertümliche Würfelsystem aus echten „bickeln“ mag Gottfried im Auge gehabt haben, als er sein „bickelwort“ konzipierte.
Damit soll gesagt werden, daß die Vorstellung von einem regelmäßig geformten kubischen Würfel (bei Kühn u.a.) mit auf sechs Seiten angegebenen Punkten, die bestimmten Zahlenwerten entsprechen, im schöpferischen Sprachprozeß Gottfrieds, in dem sich die Genese des „bickelwortes" abspielte, nicht realistisch gewesen sein kann. Die weiterführende Frage ist also: Was hat Gottfried an der Form des bisher unbekannten „bickel" so gereizt, daß es ihm dienlich war, seinen Ärger mit Hilfe dieses Gegenstandes so zu artikulieren, daß es als dichterisches Bild selbst nach achthundert Jahren noch besondere Aufmerksamkeit erregt? Während der lange Text der Dichterfehde im Grund mehr verschleiert als aussagt, könnte man mit Hilfe der wichtigsten Metapher „bickelwort“ in diesem Streit einer „Ur-Sache“ auf die Spur kommen:
1. durch eine genaue kunst- bzw. kulturgeschichtliche Identifikation dieses Gegenstandes, den man noch nicht kennt,
2. durch die Analyse des daraus entstandenen dichterischen Bildes, um dadurch einen Schlüssel zum Verständnis des „bickelwortes“ und der in diesem Bild kritisierten Dichtung zu finden.
3. Da in einem solchen Bild - das ist hier die These - mehr ausgedrückt ist als im übrigen Text der Dichterfehde, sollte das besondere Augenmerk sich zunächst auf den ausgefallenen Gegenstand „Bickel“ selbst richten, um danach auf das dichterische Bild „bickelwort“ zu schließen.
Die Anregung zu den folgenden Überlegungen gehen, wie bereits gesagt, auf Kühns Gedankenspiele mit Würfeln zurück. Er selbst verabschiedet sich aus der Betrachtung des Dichterstreites mit den Worten: „Wenn Gottfried konkreter, genauer geworden wäre in seinem Pauschalverriß, so hätte er beispielsweise den sehr großen Spielraum kritisieren können, den der junge Ritter Gawan im Parzival-Roman erhalten hat. Mit solch einer Kritik hätte der Straßburger mir den Übergang leichter gemacht zum nächsten Thema" (Kühn, 1991, S. 228).
Das relativ harmlos klingende „bickelwort“ des Dichterstreites läßt sich in sei-ner Bedeutung nur dann entziffern, wenn man es ernst nimmt und sich „tatsäch-lich“ im weitesten Sinne darum bemüht. Obwohl zunächst nicht zu vermuten, ist in diesem komplexen dichterischen Bild - denn um ein solches handelt es sich bei diesem „Begriff“ - eine grundsätzliche Kritik dichterischer Sprache enthalten. Es spielt dabei keine Rolle, ob dieses Kunstwort aus der Perspektive Gottfrieds eine Parodie zum Zwecke der Verspottung seines Dichterkollegen sein soll, oder ob es sich um eine ernstgemeinte Formulierung zum Zwecke sachlicher Kritik handelt.
Seine Literaturkritik, die dazu selbst noch im Gewande von Dichtung erscheint, als „Pauschalverriß“ zu bezeichnen, würde einem Kritiker von der Qualität Gottfrieds sicher nicht gefallen, kann aber auch Wolfram nicht ganz gerecht werden. Wenn Kühn (1991, S. 225) die Summe von Gottfrieds Kritik so zusammenfaßt: „Der andere Autor (bei dem es sich offenbar nicht lohnt, den Namen zu nennen) ist ein mieser Alchimist, ein Scharlatan, ist ein Täuscher, ein Blender, ein Pfuscher," so entsteht durch diese Kommentierung leicht der Eindruck, als ob die Kritik Gottfrieds doch eher ein persönlicher Streit gewesen und im Grunde ohne große Bedeutung sei, mithin zur Sache also wenig oder überhaupt nichts zu sagen habe. Damit blieben der eigentliche Sinn und Inhalt der Intentionen Gottfrieds trotz der verbreiteten Fehdeforschung weiterhin ein Rätsel. Die Frage aber, auf die Fehdetext und „bickelwort“ eine Antwort sind, heißt doch: Was hat Gottfried an der Form und dem Inhalt - nach dem bisher kaum jemand gefragt hat - der dichterischen Sprache Wolframs zum „Überschäumen" gebracht?
Der Angriff Gottfrieds auf Wolfram von Eschenbach wird von einem älteren Forscher (Kläden) „als der bekannte, alles Maß übersteigende (Angriff) in Gottfrieds von Straßburg Tristan" (Bernd Schirok, 1990, S. 121) gekennzeichnet. Da aber der wirkliche Grund des Streites damals wie heute nicht bekannt ist, er-scheint diese Kritik sehr scharf formuliert. Übersteigt der Angriff Gottfrieds wirklich jedes Maß? Oder hatte Wolfram nicht doch härter zugeschlagen, als man es sich vorstellen konnte? Man weiß es nicht. Wenn man Gottfried von vornherein und einseitig Maßlosigkeit unterstellt, brauchte man sich nicht wieter mit ihm zu beschäftigen.
An einer einzigen Stelle, so scheint mir, läßt sich ein Blick hinter die Kulissen des Literaturstreites werfen, und zwar da, wo Gottfried durch die Kreation des Neuwortes „Bickelwort" sein Visier öffnet und sich als Kritiker und Künstler zu erkennen gibt. Weil inzwischen bekannt ist, was ein „Bickel“ ist, kann man, von dieser Metapher ausgehend, eine Spur verfolgen. Die Reaktion Gottfrieds, wie sie in dem o.a. „bickelwort" zum Ausdruck kommt, enthält einen Hinweis auf die besondere Art der Dichtung Wolframs, um die es hier geht. Er soll durch eine bildlogische Analyse am Beispiel des „bickelwort" als spezifisch poetische Struktur deutlicher konturiert und mit der Struktur bestimmter „bickelwörter“ Wolframs verglichen werden.
Diese Analyse erfolgt im „Kontext“ einer volkskundlichen Studie über Formen und Funktionen bestimmter „Bickel“, von deren Existenz die Germanistik bisher keine Kenntnis hatte. Die Gegenstandsanalyse der Sonderform dieses „Würfels“ soll den Sinn des „bickelwortvorwurfes“ erkennen lassen, wie er ihm von Gottfried zugedacht bzw. geplant gewesen sein könnte. Unter Umständen könnten sich mit Hilfe dieses als Karikatur konstruierten Beispiels (und seiner lit. Struktur!) auch dichterische Bilder Wolframs als „bickelwörter“ identifizieren lassen; was nicht heißen muß, daß sie auch Karikaturen im Sinne Gottfrieds sind.
In der Sekundärliteratur hat sich der Sinn dichterischer Bilder durch Anwendung von Sprachlogik nicht immer erschließen lassen, wie die Erfahrung gezeigt hat. Der Grund hierfür ist: Bilder im allgemeinen Sinne des Wortes - aber auch dichterische Bilder - stehen für sich selbst und im Verhältnis zu anderen dichterischen Bildern in einem logischen Kontext sui generis. So besteht ein gravierender Unterschied darin, ob man etwas nur sehend wahrnimmt (z.B. ein Naturereignis) und darüber spricht oder von einer Sache berichtet, die man selbst gemacht hat, seien es nun Sachen oder Sätze. Die Evidenz (als bloßes „Einsehen-Können“ oft schon mit „Intelligenz“ verwechselt) ist vorherrschende Basis der Sprachlogik. Sie ist jedoch der ausgesprochenen Dinglichkeit der dichterischen Sprache Wolframs von Eschenbach nicht immer gewachsen. Nicht ohne Grund plädiert W. Schröder (1974, S. 81) in seinem Beitrag für die Beteiligung der Kunst. In ihr spielt eine besondere Handlungslogik eine Rolle, weil sie die künstlerische Wirklichkeit als eine andere Form der Wahrheit erst hervorbringt. Er stellt jedoch abschließend fest: „Ausgangspunkt und Ziel aller Wolframforschung sind die überlieferten Texte. So weit sie sich im hermeneutischen Zirkel immer wieder von ihnen entfernen muß und nicht durchweg zu ihrem Vorteil immer entfernt hat, ihr Fundament ist und bleibt die Philologie." Gefordert ist also zugleich Engagement und Distanz im Umgang mit der Dichtung, wie dies übrigens auch von andern Wissenschaftlern, z.B. Bumke, gefordert wird. Worin die Unterschiedlichkeit des methodischen Vorgehens bei der Geisteswissenschaft (zu der sich auch Germanistik zählt) und Kunst besteht, soll in der folgenden Überlegung kurz skizziert werden.
1.5 Sprachlogik und Logik der dichterischen Bilder - ihr unterschiedliches Verhältnis zum Phänomen der Zeit
Im Unterschied zum Künstler betont Hans-Georg Gadamer als Geisteswissenschaftler und Historiker immer wieder den notwendigen „Abstand der Zeit als eine positive Möglichkeit des Verstehens“ (Gadamer, 1990, S. 302). Über die moderne Kunst äußert er sich in diesem Zusammenhang: „So ist das Urteil über gegenwärtige Kunst für das wissenschaftliche Bewußtsein von verzweifelter Unsicherheit. Offenbar sind es unkontrollierte Vorurteile, unter denen wir an solche Schöpfungen herangehen, Voraussetzungen, die uns viel zu sehr einnehmen, als daß wir sie wissen könnten und die der zeitgenössischen Schöpfung eine Überresonanz zu verleihen mögen, die ihrem wahren Gehalt, ihrer wahren Bedeutung nicht entspricht. Erst das Absterben aller akuten Bezüge läßt ihre eigene Gestalt sichtbar werden.“ (Gadamer, 1990, S. 302f.)
Gadamer stellt hier ein primär historisches Interesse der Geisteswissenschaft (auch Kunstwissenschaft) an der Sache Kunst heraus, womit er sicherlich recht hat. Damit wird aber auch klar, daß Kunst- und Kulturgeschichte keinen originären Umgang mit Kunst oder Dichtung haben und ihnen der lebenspraktische kreative Umgang mit ihnen jederzeit versagt ist. Als historische Wissenschaften können sie über die künstlerische Einheit von „Bild und Text“, von Form und Inhalt nichts sagen.
Die Erfahrung des „Absterbens“ im Zusammenhang mit eigener Lebenszeit und Geschichte macht jedermann am eigenen Leib. Diese nicht-theoretische Erfahrung ist für die Kunst von grundlegender Bedeutung. Ohne sich ausdrücklich als Philosoph zu verstehen, kann jedermann leicht erkennen, daß er im Grunde überhaupt keine Zeit „hat“ und sie eigentlich auch nicht „haben“ kann. Der kleinste nur denkbare Bruchteil einer Sekunde, der aus der Zukunft heraufsteigt, hat sich im Augenblick des Übergangs schon wieder in Vergangenheit aufgelöst, was bedeutet, daß es ein zeitliches „Interesse“, ein „Dazwischen-Sein“ zwischen Ankommen und Vergehen der Zeit, mithin so etwas wie „Gegenwart“theoretisch nicht geben kann. In jedem Augenblick der sogenannten Gegenwart verliert man, ehe man sich dessen bewußt werden kann, sein Leben, d.h. Lebenszeit als den unwiederbringlichen Teil der eigenen Existenz: Vom Tage seiner Geburt an ist der Mensch ein „Sterbender“.
Ein ausschließlich „vernünftiger“ Umgang mit dem Leben und der Zeit kann also eigentlich nichts anderes als Existenzangst auslösen. Der philosophische Satz „cogito, ergo sum“, führt „denkend und ahnend“ mit gleicher Konsequenz zu dem gegenteiligen Schluß „cogito, ergo non sum“, ich denke, also bin ich nicht! Dieser „Schluß“ wäre, gerade im Umgang mit der Zeit, ebenso „folgerichtig“, d.h. ebenso logisch wie der erste. „Vicos Grundwort, gegen Descartes gerichtet, lautete:´homo non intelligendo fit omnia´“ (Hermann Pongs, 1969, S. 34); ein Wort, das die Kunst für sich reklamieren kann. Man kann schon „ver-rückt“ werden, wenn man bedenkt, wie individuelles Leben und Bewußtsein unablässig von ankommender und vergehender Zeit gespalten wird. Gemeint sind auch jene Existenzängste, von denen kein heranwachsender Mensch im Laufe seiner Entwicklung verschont bleibt. Derartige ganz normale Nichts-Erfahrungen gehören, fernab eines besonders ausgeprägten philosophischen Selbstbewußtseins, zum menschlichen Reifungsprozeß.
In der Kunst tut sich gegen diese „Nichts-Erfahrungen“ eine „ver-rückte“, aber lebensnotwendige Perspektive auf: „ Kunst als Lüge , die uns hilft, die Wahrheit zu verstehen “, wie Everding sagte. Die subjektive Erfahrung von Existenzangst und die Todeserfahrungen ringsum sind das Grundmotiv für die Kunst als eine lebensnotwendige Lüge. Sie ist der himmelschreiende, menschliche Protest gegen das totale Ausgeliefertsein an die Bedingtheit von Zeit und Raum, in die man ohne eigenes Zutun hineingeboren wurde, um darin „von Anfang an“ zu sterben. Gegen ein zwangsläufig vorwegnehmendes, bloß rationales Wissen von der eigenen Endlichkeit und der damit verbundenen Todesahnung, die auch empirisch ringsum immer wieder bestätigt und verstärkt wird, bäumt sich der Mensch mit seiner ganzen Kraft und jeder Faser seines Willens auf: Er will leben und will in der Kunst - wenn auch nur im Vorübergang - eine besondere Verfügungsgewalt über das Leben „haben“; und dieses „künstliche Leben“ will er „darüber hinaus“ in „Fülle“ haben. Die Empörung gegen den Tod ist also das Urmotiv der Kunst. Sie hat sich deshalb in besonderer Weise mit dem Leben verbündet: Indem sie die Zeit als Lebenszeit in einer besonderen Form „verdichtet“, die Zeit „versammelt und durchbricht“:„beidiu samnen unde brechen“ (337, 26).
Aus dieser Perspektive ergibt sich u.U. für die Forschung eine Möglichkeit, die sog. „Lüge“ Trevrizents im „Parzival“ zu deuten. Sie ist die „crux interpretum“ der Wolframforschung, wie Peter Wapnewski formuliert (1955, S. 151ff.). Wenn „Kunst Lüge ist, die uns hilft, die Wahrheit zu verstehen“, kann auch die „Lüge“ Trevrizents „Kunst“ sein: Verbirgt sich hinter seiner „Lüge“ vielleicht eine Wahrheit, die das Gralsgeschehen überhaupt und radikal in Frage stellt, damit die „Frage“ (der Fragen!) nach dem Menschen- und Gottesbild in der höfischen Gesellschaft neu gestellt werden kann? - Kunst kann im positiven Sinne u.U. Ausdruck eines gesellschaftlich kultivierten Verdrängungsprozesses sein, den wir höfisches Leben nennen. Sie möchte als lebensnotwendige „Lüge“ das menschliche Leben und seine Geschichte, die „Knall auf Fall“ (d.h. „schneller als sofort“) zu Ende sein kann, vor banaler Vergänglichkeit über die Gegenwart hinaus retten. Eine „aventiure“ zu sein, bedeutet also formal, immer wieder einen Anfang, d.h. in die Zukunft Weisendes zu erschaffen. Wenn man z.B. meint, der Parzivalroman habe mit dem Königtum Parzivals seinen Höhepunkt und das glückliche Ende erreicht, beginnt das „maere“ bei Wolfram - nicht zuletzt aufgrund der sogenannten „Lüge“ Trevrizents - auf anderer Ebene mit der Lohengrin- und Priester Johannes- Geschichte „umgehend“ wieder neu. Die „Lüge“ Trevrizents ist so gesehen ein Bekenntnis des Dichters über Grenzen und Möglichkeiten seines künstlerischen Schaffens, das er seinen Zuhörern nicht vorenthalten möchte.
In der menschlichen Konstitution, die im o.a. Sinne durch „Reduktion der Zeit“ als an „Allem und Nichts teilhabend“ geschaffen wurde, wie Wolfram dies im Eingang (siehe Interpretation) sieht, hat der Dichter die Möglichkeit, diese Vorgeformtheit „brechend“ - wenn auch nur in statu nascendi - in der Form und Anschauung eines dichterischen Bildes das „Unsagbare“ sinnfällig und erkenntlich zu machen. Ein dichterisches Bild ist also nicht einfach „ablesbar“, sondern bedarf der Mühe des Erkennens. Die doppelte „Spiegelung“ in der poetologischen Aussage am Ende des sechsten Buches steht m.E. in einem inneren Zusammenhang zu den Eingangsversen des Romans. Es ist auch eine Reflexion Wolframs zu deren hintergründigem Verständnis. Aus diesem Grunde wurden die Überlegungen zum Problem der Zeit der Interpretation als eine Art Verständigungsmuster vorangestellt.
Wolfram sieht in der Teilhabe an der Fülle der Zeit die Bestimmung des Menschen. Er ist bestimmt, sich selbst im Angesicht Gottes zu schauen. Der Blick in den Spiegel (1,20-25) ist nur eine Täuschung. Parzival heißt deshalb mit seinem anderen Namen, dem Geschlechternamen, nicht ohne Grund der „Anschouwe“: Er ist „der zur Anschauung bestimmte“. Seine irdische Auserwähltheit als Mitglied des „auserwählten Geschlechtes der Anjou“[4] ist die Bedingung sowohl für seine zeitliche wie heilsgeschichtliche Bestimmung: „Gratia supponit naturam“. Sein „jenseitiges Königtum“ als Gralskönig (durch die Taufe) setzt die Natürlichkeit seiner Existenz voraus. Er ist als Christ zum Königtum auf geschichtlicher und heilsgeschichtlicher Ebene berufen.
Weil diese „Bestimmung“ keine „Vorherbestimmung“ im Sinne von Schicksal ist, an dem der Mensch nichts ändern könnte, er also gar nicht „frei“ wäre, hat Parzival dazu noch einen anderen „bedeutenden“ Namen: Der „Waleise“. Das Wort „Waleis“ ist abgeleitet von „wal“, das eine doppelte Bedeutung hat: 1. wal, wale stn. m. f. schlachtfeld, wahlstatt, kampfplatz, dann allgmeiner: feld, au. 2. wal, wale stf. wahl, auswahl, freie selbstbestimmung, verfügung; besondere weise, lage , schicksal. (Lexer, 1992). Parzival ist derjenige, der in freier Selbstbestimmung und im Kampf sich für oder gegen Gott entscheiden kann; denn Freiheit ist die grundlegende Voraussetzung für Liebe, die Gott von seinen menschlichen Geschöpfen erwartet, selbst auf die Gefahr hin, enttäuscht zu werden: Diese revolutionäre Auffassung von der Freiheit des Christen, daß Gott sogar mit den Menschen ein derartiges Risiko eingeht, unterscheidet Wolfram grundsätzlich vom Dichter der Gregoriuslegende. Von diesem Wagnis (465,5!) zwischen Gott und den Menschen lebt und handelt die Geschichte Parzivals.
2. Ein „bickelwort“ als Literaturkritik
Der Analyseversuch an dem folgenden sehr einfältig scheinenden Terminus „bickelwort“ sollte, was den logischen Zusammenhang von Bild und Wort und seine „Genese“ angeht, als Kristallisationspunkt einer Literaturkritik nicht unterschätzt werden. Das Wort selbst ist zwar ein „bickelwort“, hat jedoch – gerade weil es ein solches ist - eine große Bedeutung für die nachfolgende Interpretation Wolframscher „bickelwörter“.
Einstweilen muß jedoch die Antwort, was denn ein solches Wort bedeutet, noch einmal zurückgestellt werden, weil aus methodischen Gründen einige Vorklärungen notwendig sind. Ziel ist die Aufdeckung der verborgenen Struktur der Metasprache des dichterischen Bildes „bickelwort“ mit seinen sprach - und bildlogischen Implikationen, die in diesem Terminus versammelt sind.
Erst wenn man Form und Funktion des wirklich infrage kommenden Würfels kennt, kann man einen Sinnzusammenhang herstellen und das entsprechende Bild möglicherweise auch als Schlüssel für die Dechiffrierung Wolframscher Bilder verwenden. Die Frage, wie ein „bickel“ wirklich ausgesehen, und wie er funktioniert hat, ist deshalb eine ernstzunehmende Frage, die noch nicht gestellt und beantwortet worden ist. Hier soll eine Antwort gesucht werden.
Könnte man an dieser Stelle einen richtigen „bickel“ vorzeigen, der damals zum Anlaß eines dichterischen Bildes genommen wurde, so wäre damit die Frage, was er mit dem „bickelwort“ selbst, d.h. mit der künstlerischen Anschauung desselben Gegenstandes und seiner Funktion in einem ganz anderen Zusammenhang zu tun hat, noch nicht beantwortet.
Es gibt zwar in der Sprache die Beziehung von Wort und Sache in dem Sinne, daß ein Wort für eine Sache oder die Sache für das „entsprechende“ Wort steht. Die bloße Identifizierung vom Sinn eines Wortes und der dazugehörigen Sache oder umgekehrt vom Sachsinn auf den entsprechendem Wortsinn ist zwar auch ein Art von „Veranschaulichung“. Diese Zuordnung von Wort und Sache (signum et res) ist jedoch völlig ungeeignet, eine zutreffende Vorstellung von der Wirklichkeit eines dichterischen Bildes als einer besonderen künstlichen oder künstlerischen Art von Anschaulichkeit zu vermitteln. Ein dichterisches Bild im engeren Sinne ist kein außer mir befindlicher Sachverhalt, wie z.B. ein wirkliches Ding, das außen, und das dazu vorgestellte Wort, das in meinem Bewußtseinsinnern ist. Ein dichterisches Bild hat keinen vorzeigbaren Sachverhalt, den man mit eigenen Augen sehen und wie einen objektiven Befund oder eine Sache wahrnehmen kann. Es ist ein fiktives, in mir selbst zu erzeugendes Bild in statu nascendi, d.h. im „Vorübergang“ des gleichzeitigen Geborenwerdens und Vergehens: ein vligendes bîspel oder flüchtiges Bild, wie Wolfram sagt, das sich nicht fixieren oder wie von einer Elster auf der Jagd erbeuten, d.h. „begreifen“ läßt. Ein solches Bild wird zwar aufgrund sinnlicher, äußerer Wahrnehmung angeregt, kann aber doch nur mit nach innen gerichteten Sinnen („Augen“) angeschaut werden. Deshalb sind zunächst einige Vorbemerkungen zum Problem der dichterischen Bilder notwendig.
2.1 Diskussion zum Problem der dichterischen Bilder im Parzivalprolog
Es ist ein Kompliment, wenn man einem Schriftsteller bestätigt, seine Sprache sei bildhaft, anschaulich im Ausdruck, plastisch in der Darstellung. Man will damit sagen, sein Werk sei gerade deswegen besonders gut zu verstehen. Im Widerspruch dazu behauptet man für den Parzivalprolog, Wolframs Text sei wegen der dunklen, rätselhaften Bilder nur schwer und zum Teil gar nicht zu verstehen: „Wolfram [..] denkt nicht im Fortgang von Begriff zu Begriff, sondern in Bildgestalten [...] er gerät sofort wieder tief ins Bildliche hinein, Vergleich auf Vergleich in abrupter Reihung häufend, daß der Hörer kaum zu folgen vermag. So ist der Eingang des Pz. (sic.) an vielen einzelnen Stellen dunkel und sprunghaft, wie er auch als Ganzes keinen völlig klaren Aufbau zeigt“ (Heinrich Hempel, 1951/52, S. 162). - Wolfram denkt nicht philosophisch, auch nicht im „im Fortgang von Begriff zu Begriff“, sondern schaut und erschafft einen Sinn in der logischen Abfolge von dichterischen Bildern, an die man sich als Mensch des 20. Jahrhunderts erst einmal gewöhnen muß, d.h. man muß den Umgang mit mittelalterlichen Bildern erst erlernen und einüben, um sie zu verstehen; nicht zuletzt deshalb, weil die materielle und ideelle Ausstattung der mittelalterlichen Welt eine ganz andere war als heute. Eine allgemeine, außerhalb der mhd. Dichtung liegende Lehr- oder Lernmethode zum Verständnis dichterischer Bilder, deren logische Struktur relativ „flüchtig“ ist und daher nur „vorübergehend“ wahrgenommen werden kann, gibt es nicht.
Eine gezielte Recherche in der Sekundärliteratur unter den Stichworten „Logik bzw. Eigenlogik abstrakter dichterischer Bilder“ blieb erfolglos. Wenn man Bilder lediglich als Schmuck (dekoratives Beiwerk), als bloße Veranschaulichung im Sinne traditioneller poetischer Regeln betrachtet oder sie nur allegorisch (d.h. einem „vierfachen Schriftsinn“ entsprechend) deutet, kann man m.E. den existentiellen Sinn, der in allen großen dichterischen Bildern des „Parzival“ enthalten ist, im Kontext des Ganzen nicht erkennen. Insofern klingt es nicht mehr erstaunlich, wenn ein namhafter Wolframforscher, wie W. J. Schröder, im Zusammenhang mit seinem Bildverständnis über Wolframs Bilder im Parzivalprolog erklärt:„[...] durch die Beziehung auf die Farben macht er (der Dichter!) alle Klarheit wieder zunichte“ (W. J. Schröder, 1951/52, S. 133).
Deshalb soll anstelle einer Literaturrecherche die früheste und bedeutendste deutsche Literaturkritik, die das Thema der „eigenartigen Bildlogik“ Wolframs direkt und auf „analoge Weise" anspricht, nämlich die bekannte Literaturkritik Gottfrieds von Straßburg, zum Zwecke des Vergleichs und der Analyse herangezogen werden; und zwar deshalb, weil diese Kritik in einem künstlichen Bild, dem „bickelwort“, einen Hinweis auf den wahren Grund der Kritik und damit auch auf die dichterische Sprache Wolframs geben könnte.
Die Frage, ob es zwischen Gottfried von Straßburg und Wolfram von Eschenbach eine „Dichterfehde" gab, ist in diesem Zusammenhang weniger wichtig. In der Literaturkritik im „Tristan“ (4621-4690) handelt es sich m.E. um eine der frühesten kritischen Aussagen zum vorliegenden und noch immer aktuellen Problem der Bildlogik Wolframs. Selbst wenn diese Auseinandersetzung die Form eines persönlichen „Streites" gehabt haben sollte, was durchaus möglich war, so kann der historische Streit uns heute eine Hilfe bei der Beantwortung der Frage nach Sinn und Form der dichterischen Bilder bei Wolfram von Eschenbach sein; nicht zuletzt deshalb, weil Gottfried nicht nur seine intellektuelle Kritikfähigkeit, sondern auch seine dichterische Potenz mit in die Waagschale wirft. Aus dem Leitwort seiner Kritik („bickelwort“) kann man durchaus inhaltliche und formale Rückschlüsse auf Wolframs Dichtung ziehen.
Eine Analyse der Literaturfehde und die Reduzierung auf ihr „Stich- Wort" läßt u.U. auch solche Strukturen in Wolframs Dichtung erkennbar werden, die der Forderung nach „stringenten Argumenten“, wie sie in der jüngsten Diskussion von Schirok wieder erhoben wurden, zumindest teilweise gerecht werden könnten. Wahrheit im Sinne von Beweisbarkeit und „Stringenz", wie sie von der exakten Wissenschaft gefordert werden, sind nicht gemeint. Es kann nur um eine relative Wahrheit von Argumenten und Belegen gehen. Sie ist auch in der exaktesten Wissenschaft, der Physik, als „Wahrscheinlichkeitstheorie“ und „Unschärferelation“ nicht unbekannt.
Seit die Kunst und das allgemeine Kunstverstehen um die Jahrhundertwende den revolutionären Schritt zur abstrakten Kunst vollzog, wodurch sich das traditionelle Inhalt-Form-Verhältnis radikal veränderte, hat sie ein methodisches Bewußtsein entwickelt, mit dem Strukturen und Wahrscheinlichkeiten im Bereich der bildenden Kunst genauer zu identifizieren sind. Es gelang der „abstrakten Kunst“, sich selbst als eine Art des Beispielverstehens darzustellen und ihre eigene „Wahrheit“ als relative Wahrheit („Wahr-Scheinlichkeit“) innerhalb der Grenzen künstlerischen Gestaltens zu explizieren. Damit steht sie dem Prinzip der „Verifikation“, das eigentlich nur für den Bereich der positiven Wissenschaften gilt, nicht mehr völlig fremd gegenüber. Daß die Revolution der Kunst zu Beginn des 19. Jahrhunderts alles andere als „abstrakt" im wissenschaftlichen Sinne sein wollte, sei nur am Rande vermerkt. Sie war ebensowenig „abstrakt“, wie es die dichterischen Bilder des Parzivalprologs sind. Wolframs Sprache ist „radikal“ im Sinne des Wortes und erscheint deshalb als „abstrakt“. Sie ist aber durch und durch mit Leben und Sinn gefüllt, was manchmal erst auf den zweiten Blick erkennbar wird.
Um Mißverständnisse so weit wie möglich auszuschließen, soll in einer ersten Analyse das Leitwort der Dichterfehde selbst, Gottfrieds „bickelwort“, auf pragmatisch/künstlerische Weise auf seinen Sinn hin befragt werden. Hierbei handelt es sich um eine Studie im Vorfeld des Parzivalromans, die im Hinblick auf die Deutung von Bildern des Parzivalprologs jedoch sehr wichtig ist.
Dieses zeitgenössische und zugleich kritische Dichterwort Gottfrieds ist deshalb von großer Bedeutung, weil er in einem eigens dafür geschaffenen Kunstwort (hapax legomenon) eine Besonderheit im Werk Wolframs verspotten möchte. Indem er seine Kritik in dichterischer Form vorträgt, gleicht sich Gottfried „methodo-logisch" der Sache, d.h. der Dichtung Wolframs und seinen dichterischen Bildern nach dem Prinzip an, daß man Gleiches nur mit Gleichem vergleichen, m.a.W. Dichtung nur an Dichtung messen kann. Aus dieser Methode, die man für sich selbst durch eine künstlerische Analyse seines „bickelwortes“ erschließen kann, ergibt sich jedenfalls die Möglichkeit einer sachlichen Information über Wolfram von Eschenbach.
Eine positive Anwendung seines „bickelwortes“ als „Maßstab“ für Wolframs Dichtung entspricht sicherlich nicht der ursprünglichen Absicht Gottfrieds von Straßburg. Wenn man es in der Weise benutzen will, wie das hier vorgesehen ist, müßte man also zuerst wissen, was mit dem „bickelwort“ selbst gemeint ist. Aus der Kenntnis des Gegenstandes, der dem Ausnahmewort zugundeliegt, ergeben sich u.U. der Sinn des Gemeinten und die Erkenntnis, wie dieses Wortbild auf Wolframs Dichtung angewendet werden könnte. Damit hätte man ein relatives Kriterium sowohl für sprachwissenschaftliches Verstehen als auch für literarisches Wahrnehmen.
In der Rezeptionsgeschichte des Parzivalstoffes sowie der sie begleitenden Sekundärliteratur gibt es neben der immer wieder zitierten Literaturfehde jenen unüberhörbaren, hartnäckigen, kritischen und heute noch zu hörenden unangenehmen Begleitton, der im Vorwurf der Unverständlichkeit Wolframscher Bilder liegt. Man hatte sich im Laufe von 150 Jahren daran gewöhnt, wird aber beim aktuellen Studium der Sekundärliteratur zum „Parzival“ wieder daran erinnert, daß der immer noch nicht recht verstandene Literaturstreit im 12. Jahrhundert mit ziemlich lautem verbalen Getöse seinen Anfang nahm. Wer den Skandal ausgelöst hat, weiß man nicht. Anzunehmen ist jedoch, daß Wolfram von Eschenbach sicherlich einen Anlaß dazu gab, wenn auch die Form, in der es tat, noch nicht bekannt ist. So wettert vor rund achthundert Jahren Gottfried von Straßburg im „Tristan“ über Wolfram von Eschenbach als Dichter:
„ihre Sprache ist nicht so, daß sich edle Menschen freuen. Die erwähnten Märenfänger brauchen auch noch Exegeten als Begleiter ihrer Geschichten- unsereins versteht sie nicht, wenn man sie nur hört oder liest. Doch haben wir auch nicht die Zeit, nach dem Kommentar zu fahnden in den schwarzen Zauberbüchern" (Tr. 4681 - 4690); übersetzt von Dieter Kühn.
Wenn sich in der Zwischenzeit auch vieles aufgeklärt hat, so wird man mit der Dichtung Wolframs auch nach dem Jahre 2000 noch seine Probleme haben: „Unsereins versteht sie nicht", sagt Schirok analog zu Gottfrieds Kommentar: „ Über das tertium comparationis der Unfaßbarkeit verwandelt Wolfram nun die Elster (in den Augen der tumben) in einen aufgescheuchten Hasen:[...] Wem aber eine Elster wie ein Hase erscheint, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen" ( Schirok, 1990, S. 125). Er bezeichnet beide Bilder in ihrem Verhältnis zueinander - wörtlich - als „skurrile Überblendung" (1990, S. 125) . Der Tenor beider Kommentare, von Gottfried von Straßburg und Schirok, liegt sinngemäß auf einer Linie. Daß etwa achthundert Jahre dazwischen liegen, tut eigentlich wenig zur Sache.
Die Frage, die hier gestellt werden muß, lautet : Welche Rolle spielt ein dichterisches Bild im Kontext des Romans bei Wolfram von Eschenbachs Parzival? Ist der Ausdruck „dichterisches Bild" nur eine Metapher oder mehr? Dient es zur Verschleierung (siehe Parzivalprolog) oder Veranschaulichung; ist es eher eine Versinnlichung oder eine Abstraktion? Ist das dichterische Bild dekoratives Element oder wesentlicher künstlerischer Ausdruck an Stelle einer bestimmten „Aussage“, die im Medium diskursiver Begrifflichkeit überhaupt nicht, oder nur mit größtem sprachlichen Aufwand gemacht werden kann? Wolfram gibt darauf eine Antwort:
„Solt ich nu wîp unde man ze rehte prüeven als ich kan, da vüere ein langez maere mite. nu hoert dirre âventiure site“ (3,25-28).
Ein nahezu unlösbares Problem für die Philologie besteht z.B. darin, daß sie, um auf Wissenschaftlichkeit zu beharren, von der Prämisse ausgeht, daß für ihren Bereich die Inhalt-Form-Beziehung von sprachlichem Ausdruck und dichterischem Bild vorab schon geklärt ist. Im Bereich der Kunst sind sogenannte Inhalte - das gilt für jede Kunstgattung, also auch für Dichtung - nie bloße Inhalte im groben Wortsinn. So kann die Logik eines dichterischen Bildes im Hintergrund eines Textes, vorausgesetzt, daß es als Bild erkannt wird, den Sinn des sprachlich Gemeinten durchaus ins Gegenteil verkehren. Jeder kennt diesen Effekt durch das Stilmittel der Ironie. Ob etwas wahr oder nicht wahr ist, wird nicht allein dadurch entschieden, was gesagt, sondern wie es gesagt wird! Man kann hier sogar von einer changierenden Beziehung zwischen Inhalt und Form sprechen: Begriffe erhalten durch bildhafte Ausdrucksweise einen wahrnehmbaren „Sprachleib", und Bilder umgekehrt durch ihre sprachliche Form relative Abstraktheit. Indem so Inhalt und Form eine Einheit bilden, fungieren sie wie ein sinnfälliges Übergangsschema zwischen Begriff und Bild und „suggerieren" einerseits ein Sicht- und Hörbares, also eine gewisse Positionalität, und andererseits Unerhörtes, Unsichtbares und Unsagbares mit der Tendenz des Außergewöhnlichen, der Exzentrizität. Eine solche gegenläufige Bewegung von Bildern und Begriffen durchzieht den gesamten Parzivalroman wie ein roter Faden und zwar so, daß die Logik der dichterischen Bilder gegenüber der Sprachlogik teilweise die Oberhand gewinnt. Man muß schon genau hinhören und viel Phantasie mitbringen, um zu ahnen oder zu schauen, was wirklich gemeint sein soll. Dann kann man allerdings erleben, wie dürre Begriffe plötzlich Farbe und eine leibhaftige Existenz bekommen und sogar ganz einfältig erscheinende Bilder, von keinem noch so anspruchsvollen Begriff in der Fülle ihrer Bedeutung übertroffen werden. Was hier angedeutet wird, läßt sich an vielen „dunklen Bildern" des Parzivalprologs belegen, wenn man sie auf literarische, um nicht zu sagen künstlerische Weise analysiert.
W. Schröder äußert sich zu dieser Problemlage in seinem Bericht über die Tagung der Wolframgesellschaft aus dem Jahre 1972 in Schweinfurt so: „Die Interpretation von Dichtung ist - nach Erledigung der im engeren Sinne philologischen Vorarbeiten, die im mediävistischen Bereich besonders aufwendig sind - mehr eine Kunst als eine Wissenschaft und nur bis zu einem gewissen Grade verifizierbar. Ist die Hoffnung vermessen, daß sich alle Interpreten dessen bewußt sein und neben der eigenen noch so gut begründeten auch andere Auffassungen immerhin als denkbar möglich gelten lassen möchten?" (W. Schröder, 1974, S. 81). Dies ist eine bemerkenswert selbstkritische Aussage, die fast einer Wende im Selbstverständnis der Philologie gleichkommt. Die Frage, was denn diese „Interpretationskunst“ selber ist, wird freilich damit noch nicht beantwortet.
Weil also der immer wieder behaupteten „Ausgefallenheit“ der dichterischen Bilder im Parzivalprolog bisher keine besondere Aufmerksamkeit im o.a. erweiterten Sinne gewidmet wurde, sollen hier einige Wort-Bild-Beispiele des Prologs untersucht werden, um das Verhältnis von Bild und Text in der Dichtung Wolframs etwas besser zu verstehen. Die vorangestellte Bickelwortanalyse mag als eine Vorübung dazu betrachtet werden.
2.2 Der „bickel“, ein unbekannter Gegenstand als literarisches Bild
Für den Terminus „bickelwort", der sowohl Bild als auch Begriff zu sein scheint, gibt es keine sachlich angemessene Vorstellung: Würfel oder Würfel aus Knochen sagen über Form und Funktion des Gegenstandes nicht so viel aus, daß man davon auf die Gleichnishaftigkeit des damit verbundenen dichterischen Bildes Rückschlüsse ziehen könnte. Wenn der zugrundeliegende Sachverhalt nicht hinreichend geklärt wird, läßt sich das damit verbundene Bild nicht richtig verstehen. Die Festlegung auf eine Würfelform, wie sie heute bekannt und gebräuchlich ist, und der Versuch, diese Form und Funktion dem dichterischen Bild zu unterlegen, sind nicht überzeugend.
Dennoch scheint sich hinter bzw. in diesem noch unverstandenen Bild – vielleicht als Vorwurf oder Parodie gedacht - exemplarisch eine grundlegende Art dichterischen Sprechens bei Wolfram zu verbergen, obwohl das „bickelwort“ von Gottfried von Straßburg stammt. Ein möglicher Schwebezustand von Bild und Begriff, der ohnehin viele Bilder als dunkel und zusammenhanglos erscheinen läßt, wird also noch dadurch kompliziert, daß der Gegenstand, der für das dichterische Bild Pate stand, nicht oder nur ungenau bekannt ist. Andererseits spürt man eine Art Richtungsangabe in diesem Wort, in der ein Sinn zu finden wäre.
Daß es lohnt, sich um einen so schlichten Gegenstand zu bemühen, lehrt der Umgang mit anderen dichterischen Bildern: Man kann sogar behaupten, daß sich die Einfachheit der Bilder umgekehrt proportional zur Abstraktheit ihrer Bedeutung verhält. Das gilt z.B. für das Bild der Elster, des Zwîvels, des Hasen, des Spiegels u.a., die Wolfram selbst gebraucht. Es gilt gleichermaßen für das dichterische Bild Gottfrieds von Straßburg, mit dem er seine Kritik an Wolfram „auf den Punkt“ bringt. Wie sahen also „bickel“, die Gottfried und Wolfram kannten, in Wirklichkeit aus?
Würfel, wie Gottfried sie für sein dichterisches Bild benutzte, waren nach Form und Funktion wahrscheinlich ganz anders, als jene, die wir heute kennen. Mit einiger Sicherheit läßt sich schließen, daß auch der Sinn des „bickelwortes" nicht der ist, den wir ihm heute aufgrund einer ungenauen Vorstellung, etwa von einem sechsseitigen Würfel, unterlegen. Wenn man schon im 12. Jahrhundert mit „bickeln“ würfelte und für die Formen bzw. Seiten der Würfel derart plastische Bezeichnungen erfand, daß man sie noch heute ohne Schwierigkeit an dem wiederentdeckten „bickel“ identifizieren kann, so hat Gottfried mit seinem dichterischen Bild auf diese Eigenart der Form und des Namens dieser Würfel sicherlich Bezug genommen. Wie sah er also aus?
Was die folgende Analyse betrifft, so möchte ich dem möglichen Mißverständnis vorbeugen, daß es sich nur um eine Art volkskundlicher Betrachtung aus subjektiver Perspektive handelt, auf die man ebenso gut verzichten könnte, weil Volkskunde und Philologie in der Regel wenig miteinander zu tun haben: Nicht nur das Aussehen, sondern die Form- und Funktionsbestimmung des Bildinhaltes „bickel“ dienen der Vorbereitung der sich daraus ergebenden künstlerischen Formanalyse des dichterischen Bildes und sind damit unerläßliche Vorbedingung zu seinem Verstehen.
2.3 Volkskundliche Analyse der Form und Funktion des „bickels“
Konkrete Erfahrungen im Umgang mit Dingen entsprechen der Forderung nach Überprüfbarkeit im Sinne von „Stringenz der Argumente“, wie sie von Schirok erhoben wurde. Die Aussagen über Form und Funktion der Bickel und ihre Bedeutungen können an dem von mir identifizierten Gegenstand „Bickel“ im praktischen Spiel verifiziert werden.
In einem zweiten Schritt wäre es möglich, auch die Folgerungen, die aus der Darstellung des Sachverhaltes gezogen wurden, zu überprüfen, wobei gefühlsmäßige Assoziationen, die auf künstlerische Wahrnehmung abzielen und für die Interpretation eine wichtige Rolle spielen, wiederum nicht wie Argumente „überprüfbar“ sind, sondern nach dem „Prinzip der Wahrscheinlichkeit“ für möglich gehalten oder auch abgelehnt werden können. Was den Nachvollzug von künstlerischen Äußerungen, Assoziationen und Kriterien betrifft, so hat das eher etwas mit einer geübten bzw. gesteigerten Sensibilität und dem ästhetischen Regelsystem unserer Sinne zu tun. Wenn man ein Analyseverfahren nach bildlogischen bzw. künstlerischen „Regeln" auf ein Kunstwerk - welcher Art auch immer - anwendet, kann man also nur von „relativer Stringenz" bzw. „Wahrscheinlickeit“ reden.
Die Suche nach dem Sinn von „Bickelwörtern" führte mich im Gefolge der Überlegungen Kühns zum Thema „bickel“ und Würfel spontan auf die Spur des bereits erwähnten Erlebnisses (s.S. 29) aus meiner Jugendzeit: Ich mußte die „Bickel“ wiederfinden! Zu diesem Zweck begab ich mich in die Fleischereiabteilung eines Kaufhauses. Dem zuständigen Fachmann erklärte ich mein Interesse an einer ganz besonderen Form von kleinen Knöchelchen. Für eine hypothetische „Mahlzeit“ kaufte ich also vier Schweinefüßchen. Sie wurden so lange gekocht, bis sich alles voneinander gelöst hatte. Das Ergebnis dieser „Analyse“ überraschte nicht. Es fanden sich tatsächlich jene Knochen wieder, nach denen ich gesucht hatte: acht „Bickel“. Nach einigen Durchgängen in der Spülmaschine waren sie so gebleicht, daß es geradezu reizte, sich auf ein Spiel mit ihnen einzulassen.
Bild 1: Würfelpositionen „stönneke“ und „bickel“ (Streichholzschachtel zum Vergleich).
Seltsamerweise haben wir als Kinder dieses Würfelspiel weder richtig beachtet noch begriffen, wie man es spielte. Wir bevorzugten die „richtigen“ Würfel. Außerdem war uns das Bewertungssystem dieser altertümlichen Bickel zu kompliziert und rätselhaft. Dennoch darf man es als Glücksfall betrachten, im un-mittelbaren Lebenszusammenhang des Elternhauses die eindrucksvolle Form der historischen „Würfel" überhaupt kennengelernt zu haben. Wichtige Einzelheiten, wie die Formen und die folgenden Namen der Seiten des „Würfels" sind mir mit völliger Gewißheit ebenfalls bis heute im Gedächtnis geblieben. Weil man selbstverständlich davon ausgeht, daß ein „Würfel“ sechs Seiten hat, war ich anfangs verunsichert, weil mir nur die Namen für vier Seiten eingefallen waren. Beim Spiel mit den Bickeln stellte sich aber heraus, daß sie tatsächlich nur vier „Seiten“ hatten. An diese Vorstellung muß man sich erst gewöhnen.
Die niederdeutsch bzw. holländisch klingenden Namen „bickel, butje und gatje und stönneke", die man ohne weiteres als Verkleinerungsformen erkennt, waren ohne Probleme den im Fleischerladen wiedergefundenen Knöchelchen zuzuordnen: „bickel“ („Bäuchlein“) als die größte sich vorwölbende Teilform einer Würfelseite und „gatje" als deren Gegenseite, anatomisch aussehend wie ein kindliches Hohlkreuz mit den Rundungen eines „Po“ und dem dazugehörigen „Löchlein", unschwer als „gatje“ zu erkennen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 2: Würfelpositionen „stönneke “ und „gatje“
Zieht man nun bei den drei Wörtern die Verkleinerungssilben ab, so verbleiben als die Hauptsilben „but" „gat" und „stone". Diese Stammwörter sind niederdeutsche Wörter, die noch heute im niederdeutschen Dialekt und im Holländischen so gebraucht werden. Das Wort „gat" findet sich bereits in der gleichen Form im Mittelhochdeutschen vor: „gat, stn. öffnung, loch, höhle“ (Lexer, 1992).
Das niederdeutsche Wort Knochen lautet „but". In seiner Verkleinerungsform „butje“, d.h. Knöchelchen ist dies der Name für die Seitenlage, bei der das Knochige und die Rundungen des Würfels stark hervortreten.
Eine ursprünglich klingende Wortbedeutung, die mit den größeren Rundungen des Knöchelchens zu tun hat, taucht in dem Wort „bickel“ auf. „Bickel“ kommt von „biuchelin, biuchel stn. kleiner bauch“, heißt also „Bäuchlein“. Genau das ist die Form jener Würfelseite, die mit dem Wort „bickel“ beschrieben werden kann. Interessant ist das mittelhochdeutsche Wort „bickel", das im „Original-Taschenlexer“ (Lexer, 1992) mit Spitzhacke und Picke, aber auch mit „Knöchel" und „Würfel" übersetzt wird.
Am Beispiel von Seite und Gegenseite („biuchel“ und „gatje“) des alten Würfels sieht man, daß es sich bei den „Werten" des Würfels nicht um Mengen oder Zahlenwerte, sondern um „Werte“ als Bezeichnungen für plastische Formen handelte: mehr oder weniger konkav oder konvex, gerichtet oder liegend etc. Ohne im einzelnen darauf einzugehen, was „plastische Werte“ im bildhauerisch-künstlerischen Sinne bedeuten, kann man sagen, daß es um Formen bzw. „Werte“ geht, die man primär nur mit dem Tastsinn, mit dem Auge nur sekundär wahrnehmen kann (aufgrund der Vorerfahrungen des Tastsinnes), d.h. mit dem Auge nur bedingt oder gar nicht. Wichtig ist weiter, daß dieser Sinn nur durch Berühren Wölbungen und Höhlungen wahrnehmen, im Grunde also nur zwei „Grundwerte“ räumlicher Ausgedehntheit von Materie „begreifen“ kann: Positive und negative Formen (natürlich auch Texturen als deren Differenzierung). Nicht nur abstrakte, sondern auch „inhaltlich“ festgelegte Plastiken lassen sich auf diese Grundmöglichkeiten der Gestaltung von Raum im Medium der Materie reduzieren. Auf „binäre“ Weise kann der Tastsinn, wie bei der Blindenschrift, sogar die kompliziertesten positiv-negativ-Unterscheidungen machen, mit dem Erfolg, daß ein Blinder sogar lesen kann.
An das Bewertungssystem des Bickelspiels konnte ich mich nicht erinnern; vielleicht hatte ich es damals auch gar nicht verstanden. Jedenfalls stand ich nun vor der Aufgabe, die Regeln dieses Spieles wiederzufinden. Aufgrund zahlreicher Wurfversuche stellte sich zuerst heraus, daß es nur vier Positionen des Würfels gibt, daß diese organische Form des „Bickels" also nur vier Seiten hat, es also - wie bereits oben erwähnt - nur vier „Wertungen“ im Einzelfall geben kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 3: Die vier möglichen Würfelpositionen von links nach rechts: „gatje“, „bickel“, „butje“ und „stönneke“ („Venuswurf“)
Die Position des Würfels, die mit „stönneken" bezeichnet wurde, trat beim Spiel höchst selten auf und zwar deshalb, weil er in dieser „Lage" senkrecht steht, vom Eindruck „en miniature" vergleichbar mit den stehenden Steinen von „stone henge"; weshalb es nahe lag, dieser seltenen Position den heute etwas seltsam klingenden Namen „stönneken" zuzuordnen. Dies mag „kleines Steinchen“ heißen; im Namen schwingt aber auch die Bedeutung des niederdeutschen Verbs „staon“ (stehen) mit.
Durch viele weitere Versuche stellte sich als eine zweite Erkenntnis heraus, daß diese „Würfel"überhaupt nicht mit Regelmäßigkeit nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit funktionieren wie die heute üblichen kubischen Würfelformen mit dem Zahlensytem von eins bis sechs. Nach diesem Gesetz - und das kann man durch viele Versuche bestätigen - treten bei der regelmäßigen kubischen Würfelform alle Zahlenwerte von eins bis sechs nach einer großen Anzahl von Würfen in gleicher Verteilung auf: also die „sechs“ kommt im Prinzip genau so oft vor, wie die „eins“ und jede andere Zahl. - Weil dies bei den altertümlichen Würfeln absolut nicht der Fall war, veranlaßte mich diese Erfahrung, systematisch nach einer anderen „Regelmäßigkeit“ zu forschen. Ich machte mir also eine Liste mit vier Spalten und trug am Kopf die vier verschiedenen Namen der Würfelseiten ein. Auf diese Weise wollte ich empirisch nach anderen möglichen Gesetzmäßigkeiten beim Vorgang des Würfelns suchen. Acht Knöchelchen, jene „Bickel“ also, fanden sich in den Fußknochen eines Schweines, was nicht heißt, daß früher auch mit acht gewürfelt wurde. Für meine Untersuchungsreihe war jedoch die größere Zahl der Würfel insofern von Vorteil, als die statistischen Ergebnisse über die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Positionen, nach denen ich suchte, schneller zur Hand waren. Bei ersten spielerischen Versuchen mit Bickeln fiel nämlich eine gewisse Unregelmäßigkeit der Würfelpositionen sofort ins Auge. Was zunächst als Willkürlichkeit empfunden wurde, stellte sich jedoch im Laufe systematischer Versuchsserien (siehe Statistik im Anhang) als eine besondere Form von stastistisch zu erfassender Regelmäßigkeit heraus.
Die Ergebnisse wurden in Listen eingetragen. Es galten die jeweils oben liegenden Seiten, so wie beim bekannten Würfelsystem auch. Ihre Positionen wurden addiert, also beispielsweise: viermal „gatje"; zweimal bickel, einmal butje; höchst selten einmal „stönneke". Diesem Schema entsprechend machte ich also Eintragungen in die Liste, um zu ermitteln, ob sich aus der Häufigkeitsverteilung bestimmter Bilder Rückschlüsse ziehen ließen. Wie bereits gesagt, waren die Formen nur durch ihre mehr oder weniger positiven plastischen Wirkungen - wobei ich die stehende Form des Würfels auch als eine solche verstand und durch ihre negative Seite zu unterscheiden. Das Ergebnis mehrerer spielerischer Versuchsreihen war in der Tat überraschend:
Die am häufigsten erscheinende Position des Würfels war „gatje", d.h. die Seite mit der Negativform des Würfels lag am häufigsten oben. Danach kam die Position des „bickel" als Positivform (Wölbung), die nicht zu übersehen war. Weniger oft erschien der Würfel in seiner Seitenlage, in der das „Knochige“ an ihm besonders zum Vorschein kam, nämlich „butje“. Die höchst seltene Position, sozusagen die Ausnahmeposition, war aber die des „stönneke", also des hochkant stehenden Würfels. Diesem sehr seltenen „Fall" muß deshalb m.E. ein besonderer Wert, vergleichsweise ein „Ass“ zugeordnet worden sein.
Mit acht Bickeln machte ich mehrere Versuchsserien von jeweils zwanzig Würfen in einem Durchgang. Mit dieser relativ großen Anzahl wollte ich mir zu-nächst einen groben Überblick über das Verhalten der Würfel überhaupt verschaffen, ob sich etwa Besonderheiten herausstellten oder ob sie so regelmäßig reagierten, wie die bekannten kubisch geformten Würfel mit Augen. Für jede einzelne Serie ergaben sich somit (20 x 8 =) 160 „zufällige“ Positionen. In jedem Durchgang zeichnete sich eine auffallende Schwerpunktbildung zugunsten der (oben liegernden) „gatje“-Seite der vier Würfel ab. Beim folgendem „Schema“; handelt es sich um die tatsächlichen Ergebnisse einer einzelnen Serie:
- gatje, also die Negativform: 78 mal
- bickel, die Positivform: 52 mal
- butje, Seitenlage: 27 mal
- stönneken, der Ausnahmefall des stehenden Würfels: 3 mal.
Das o.a. Verhältnis von 78:(52+27+3)= 78:82 näherte sich auch in den folgenden Serien in auffallender Weise immer wieder den angegebenen ersten Zahlenverhältnissen und pendelte sich auf einen Durchschnitt von 80:80 zu ein. Das war in der Tat erstaunlich! Auch bei weiteren Versuchsserien stellten sich immer gleiche Ergebnisse ein. In dieser empirisch spielerisch ermittelten Häufigkeitsverteilung ließ sich nun eine für die weitere Untersuchung wichtige Entdeckung machen: Die Anzahl der Würfe, bei denen sich die Negativform des Würfels an die Oberfläche kehrte, war im Durchschnitt in allen Serien genau so groß, wie die Summe aller Formen mit positiven plastischen Werten zusammen, so daß man von einem Gleichgewicht in der Häufigkeitsverteilung von positiven und negativen plastischen Werten beim Würfeln mit Bickeln sprechen kann.
Die Ergebnisse der Spielversuche waren nicht nur überraschend; sie erschienen sogar etwas „unheimlich“, denn solche „Regelmäßigkeiten“ waren bzw. sind überhaupt nicht zu erklären! Zum erstenmal drängte sich der Verdacht auf, daß das Spiel, dem ich auf der Spur war, einen ganz anderen Charakter haben könne als das Kinderspiel, von dem ich ausgegangen war. - Ein dazu passender Kupferstich aus der Zeit des 30-jährigen Krieges (Helmut Lahrkamp 1997, S. 229) fiel mir in die Hand. Auf ihm waren zwei Landsknechte zu sehen, die auf ihrer Trommel mit den gleichen Bickeln, wie ich sie kannte, um Leben und Tod gefangener Bauern würfelten[5]. Handelte es sich um ein Glücks- oder Unglücksspiel? San Marte (A. Schulz), der erste Übersetzer des Parzivalromans, gab einen Hinweis darauf, daß nur mit vier Würfeln gespielt wurde.
Nach ersten Annäherungsversuchen und den o.a. Erfahrungen setzte ich also die Spielversuche mit vier Bickeln fort. Die Ergebnisse der Einzelwürfe trug ich in eine Liste ein, die als Kopie (im Anhang) beigefügt ist. Von den fünf Serien fällt die mittlere hinsichtlich ihrer Ergebnisse etwas aus dem Rahmen; dennoch spricht das Verhältnis von 53 zu 66 (in der Summe von 66 sind die Positionen von drei Würfelseiten enthalten!) eindeutig für das Übergewicht der Negativformen des Würfels. Wenn man die Ergebnisse der vier anderen Serien (die beiden ersten und letzten) zusammenzählt und zueinander in Beziehung setzt, erreicht man im Durchschnitt das annähernd ideale Verhältnis von 241:240 =1:1, also:
62+58+64+57=241; Gatje-Positionen, also Negativformen. 57+62+58+63=240; Summe der drei anderen positiv geformten Würfelseiten. („Positiv“ sind drei gewölbte Würfelseiten, „negativ“ deren eine hohle Seite.)
Die Gesamtergebnisse sind in zwei Listen zur Überprüfung beigefügt (siehe Anhang). Die Signifikanz 240:241 ist nicht zu übersehen. Bei jeweils dreißig Würfen, d.h. 30x4 Positionen in jeder Serie, müßte unter dem Strich die Summe der Wurfpositionen theoretisch immer 120 ausmachen. Ich erlaube mir jedoch, die Statistik, wie sie in der Praxis entstand, trotz zweier kleiner Additionsfehler als Tabelle vorzulegen. Wenn man die Serie um einige hundert Würfe erweiterte, würde sich mit hoher Wahrscheinlichkeit das Verhältnis der einen Negativform (gatje) zu den drei positiven Gegenformen (bickel-butje-stönneke) auf exakt 1:1 bzw. 100: 100 einpendeln.
Wenn mir das Bewertungssystem aus meiner Kindheitserinnerung auch nicht mehr bekannt war, so ließe sich auf dieser Basis sicherlich ein solches entwickeln, entweder dadurch, daß man für die seltener auftretenden „Fälle", z.B. den aufrecht stehenden Würfel, einen höheren Wert etwa ein „Ass", oder eine „Sechs“ ansetzt, und für die häufiger auftretenden „Fälle" entsprechend weniger, gemäß dem uns bekannten System, also die Zahlen von eins bis vier. Man hätte dann allerdings nichts anderes, als das bekannte Würfelsystem, nun aber mit vier Zahlenwerten.
Gefühlsmäßig sträubte sich aber etwas in mir gegen diese Fixierung auf bloße Mengen bzw. Zahlenwerte. So werden auch in der Literatur im Zusammenhang mit dem „topelspiel“, wobei es sich um das Spiel mit Knochenwürfeln handelt, niemals Zahlen oder Mengen genannt. Es ist stets nur die Rede von besonderen Bildern, die beim Spiel mit Bickeln auftauchen, und die entweder als Glücks- oder Verlustwürfe bezeichnet werden, beispielsweise „Hundswurf“ oder „Venuswurf“. Ist Venus, die Glücksgöttin „mit im Spiel“, dann ist es auf der Gegenseite Zerberus als Höllenhund, der den Eingang zur Unterwelt bewacht.
Weil der Würfel vier Seiten hat, ergeben sich bei einem Spiel mit vier Würfeln 4x4x4x4 mögliche Kombinationen, also 256 Wurfbilder. Selbst wenn man einmal weniger potenzierte, blieben theoretisch noch immer 64 Würfelkonstellationen übrig. In der Spielpraxis mit diesen Bickeln sieht die Sache jedoch ganz anders aus. Ich habe die Liste mit den fünf Serien nach der Häufigkeitsverteilung verschiedener Positionen ausgewertet. Dabei stellte sich heraus, daß es bei den 5x30= 150 Würfen (Liste im Anhang) etwa sechs „Bilder“ gibt, die immer wieder kehren und wenige, die sich fünf bis sechs mal wiederholen, insgesamt aber nur 28 Wurfbilder auftauchen.
Die Würfelkombinationen, bei denen überhaupt keine Negativseite („Gatjeposition“) auftaucht, liegt bei nur zwölf an der Zahl. Dieser Extremposition von 12 ausschließlich positiven Wurfbildern steht mit elf ausschließlich negativen Wurfbildern (11x4 ausschließlich gatje) - zahlenmäßig fast im Gleichgewicht - die andere Extremposition gegenüber. Aus den statistischen Daten läßt sich also eindeutig belegen, daß das Verhältnis von positiven und negativen Formen das Spiel bestimmen muß, selbst, wenn man die Spielregeln nicht kennt. An diesen überraschenden Effekt kann man kaum glauben, wenn man nicht selbst die Probe aufs Exempel macht. So viel läßt sich jedenfalls vorab schon sagen, daß im Spiel mit den Bickeln das Verhältnis von „Alles und Nichts“ reflektiert wird, das bei der Interpretation des Eingangs und des Elsterngleichnisses im „Parzival“ von existentieller Bedeutung ist. Insofern hat Gottfried exakt die Struktur Wolframscher dichterischer Bilder getroffen: Fast alle wichtigen Bilder sind im positiv -negativen Sinne mehrdeutig; wie Wolfram selbst über sein „maere“ sagt: „lasternt unde êrent“ (2,12).
Wenn also Gottfried von Straßburg im „Stichwort“ seiner Kritik, diesen selbstverständlichen Spielhintergrund zitiert, „reflektiert“ er z.B. im „Bickelwortvorwurf“ metakritisch das paradoxe „felix culpa-Motiv“ (1,7) mit. Im „vligenden bîspel“ verborgen ist der Widerspruch von „Schuld und Glück“ für Wolfram Grund zur (österlichen) Freude, wenn er sagt: „der mac dennoch wesen geil: wande an im sint beidiu teil, des himels und der helle“ (1, 7-9). Freilich hat der allem anderen „übergeordnete Gesichtspunkt“ von Erlösung im christlichen Sinn, der in Wolframs Text eine Affinität zur Wahrheit der dichterischen Form überhaupt zu haben scheint, mit dem realen „Bickelspiel“, von dem in der Analyse die Rede war, unvermittelt nichts zu bedeuten. Erst als literarisches Bild kann es im Sinne Gottfrieds seine kritische Funktion übernehmen. In den stets wiederkehrenden „Spielbildern“ des Bickelspiels gibt es nur die schicksalhaften Alternativen „Ja oder Nein“, „Glück oder Unglück, „Alles oder Nichts“.
Die statistisch auffallenden, d.h. am häufigsten vorkommenden Positionen sind 3:1 (gatje: bickel) und 2:2 (gatje: bickel + butje). Ob es sich hierbei um zwei Würfelkonstellationen handelt, die eine besondere Bedeutung haben, läßt sich nicht entscheiden; es könnte sein. Mit Sicherheit gibt es aber bei verschiedenen anderen „Zufällen“ Würfelbilder, die zwischen dem höchsten Gewinn und dem tiefsten Verlust differenzieren können. Aus den beigefügten Belegen über die Serien kann man nämlich erkennen, daß es von 28 überhaupt vorkommenden Würfelkonstellationen statistisch etwa zwanzig Würfelbilder gab, die sich - mehr oder weniger häufig - immer nur wiederholten. An die rechnerische Möglichkeit von 4x4x4x4 Würfen, also von 256 möglichen Konstellationen der Würfel, ist, wie die Statistik belegt, nicht im Entferntesten zu denken. Wie im o.a. Fall der Zuordnung von drei positiven zu einer negativen Würfelform gibt es auch für das Phänomen von immer wiederkehrenden Würfelkonstellationen keine Erklärung! Wohl aus diesem Grund gab es schon in der Antike für die begrenzte Zahl sich wiederholender Wurfbilder eigene Namen, von denen in der Literatur bei Gerhard Rohlfs (1963, S. 8) die zwei wichtigsten, nämlich der Venus- und der Hundswurf, als der beste und der schlechteste, erwähnt sind. Was bis hierher empirisch und spekulativ über mögliche Spielregeln erarbeitet wurde, reicht m.E. für den Fortgang der Überlegungen aus.
Bevor die Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf das „bickelwort“ interpretiert werden, sei zur Bestätigung eigener Erfahrungen an San Marte erinnert, der einige interessante Bemerkungen zum historischen Würfelspiel macht. „Die Griechen und Römer hatten zweierlei Würfelspiele. Eine Art Würfel wird von den [..] Römern talus oder taxillus genannt. Die andere Art heißt [...] tessera. Die tali hatten nur vier Seiten. Die tessera glichen ganz den heutigen Würfeln, daher man auch mit 3 tessaris oder 4 talis spielte“ (San Marte 1826, 194 ff.) Die „tali“ werden als Würfel mit vier Seiten, deren Seiten „rund gewölbt“ sind, beschrieben. Sie werden zwar nicht expressis verbis identifiziert. Mit einiger Gewißheit handelt es sich um jene Knochen-Würfel, die volkstümlich „bickel“ genannt werden. Die Aussage, daß bei einem „Venuswurf“ alle vier Würfel eine verschiedene „ Zahl “ zeigen, läßt darauf schließen, daß ihm die vierseitigen „Würfel“ als „bickel“ nicht wirklich bekannt waren; denn diese „Würfel“ haben keine Zahlen. In der o.a. eigenen Statistik von 5x30 Würfen taucht der sog. „Venuswurf“ relativ selten auf. Wenn man analog der Aussage von San Marte davon ausgeht, daß sich bei diesem Wurf vier verschiedene Seiten (und nicht Zahlen) zeigen, weiß man theoretisch, wie der „Venuswurf“ beim Bickelspiel aussieht.
Wenn das Würfelspiel überhaupt für die Ritterschaft von so großer Bedeutung war, wie Segramors voller Ärger von sich gibt, als Parzival ihn aus dem Sattel hob, mögen die folgenden Überlegungen, die den engeren Zusammenhang des Ritterdaseins mit diesem Spiel betreffen interessant genug sein:
„er sprach’ ir habt des vreischet vil, ritterschaft ist topelspil, unt daz ein man von tjoste viel“ (289, 23-25).
2.4 Das dichterische Bild Gottfrieds und seine Bedeutung für Wolfram
Die Analyse hat bis hierher den Punkt erreicht, der für die Frage entscheidend sein kann: Welche Bedeutung hat ein Würfel in der alten Form für den Sinn eines dichterisches Bildes? Diese Frage und die Antwort darauf sind für die literarische Analyse des „bickelwortes“ entscheidend. Das auffälligste und interessanteste Ergebnis der Testreihe ist, daß die Summe der Würfe, welche die Negativseite des Würfels oben erscheinen lassen, der Summe der drei anderen möglichen Positionen bzw. Formen entspricht.
Beide Formen stehen beim Spiel logisch gesehen in einem ausgeglichenen negativ-positiv Verhältnis zueinander. Diese besondere Art von Gleichgewichtigkeit kann bedeuten, daß zwischen Positiv- und Negativformen der „Grenzbereich" für ein durchlässiges Bewertungssytem liegt, so daß man alle Werte als ein Positiv-Negativ-Verhältnis betrachten und in bestimmten Bildern vergleichen könnte. Die drei positiven Seiten bzw. ihre „Werte“, gleichen dann zusammengenommen die Negativseite („gatje“) aus. Sicher ist nur, daß man aufgrund der besonderen Form der „bickel“ ein Bewertungssystem hatte, das die plastischen Werte der „Würfel-Form“ selbst zur Grundlage hatte. Für die weiterführenden Überlegungen ist die Tatsache wichtig, daß in diesem Spiel fortwährend positive und negative Formen erscheinen. Sie treten miteinander in Beziehung und bestimmen durch ihren plastischen Wert (mehr oder weniger starke Wölbung) und Gegenwert (Höhlung) den Charakter des Spiels. In der von Gottfried auf die Sprache Wolframs übertragenen Bedeutung heißt das, seine Sprache produziere wie beim Fall der „bickel“ in einem Wurf Wert und Unwert, Sinn und Unsinn.
Wer immer mit solchen „Würfeln" spielte, dachte nicht in Zahlen und Mengen, sondern in Bildern. Die entsprechende Mentalität läßt sich heute kaum noch vorstellen. Andererseits läßt sich der Umgang mit Dingen, wenn sie denn in ihrer gegenständlichen Form und Funktion zur Metapher verdichtet wurden, noch am ehesten vom 12. in das 20. Jahrhundert vermitteln. Die Mentalität bezüglich der Wahrnehmung von Sprache hat sich seit dem 12. Jahrhundert sicherlich stärker verändert als die von gegenständlichen, plastischen und bildhaften Formen oder Sachen. Die von ihnen ausgehenden Wirkungen sind im 12. und im 20. Jahrhundert annähernd die gleichen. Deshalb war es für die Interpretation des „bickelwortes“ wichtig, daß nicht nur die Namen „bickel- butje- gatje- stönneke“ authentisch, wenn auch nur mündlich überliefert wurden, sondern auch der Gegenstand „bickel“ selbst in seiner Form und Funktion - zwar nicht inhaltlich - aber doch theoretisch als möglicher Entscheidungsträger für positive und negative „Fälle“ im Spielgeschehen identifiziert werden konnte. Durch verstehenden Umgang mit dem historischen Gegenstand selbst kann so ein altes Wort „bickel“ in seinem zeichenhaften, übertragenen Sinn verstanden und damit u.U. eine Sprachbarriere zwischen den Jahrhunderten überwunden werden.
Die für den Fortgang der Überlegungen wichtigste Erfahrung ist, daß es sich im Bickelspiel grundlegend um das Mit- bzw. Gegeneinander von Positiv- und Negativformen handelte. Diese Erfahrung ist deshalb wichtig, weil in der ausdrücklichen Polarität beim Spiel mit dem „Bickel“ jener Widerspruch sinnfällig wird, den Gottfried in seinem „bickelwort“ Wolfram zum Vorwurf macht, auf den Wolfram seinerseits im Eingang des Parzivalprologs bewußt abhebt, nämlich den Gegensatz von „Alles und Nichts“ in einem Ganzen. Ob Gottfried hinter der Polarität von relativem „Sinn und Unsinn“ - so wird er es gesehen haben - auch eine neue, künstlerische Einheit erkannt hat, läßt sich nicht entscheiden. Anerkannt hat er sie jedenfalls nicht. Er wollte seinen Dichterkollegen im Bild und Begriff des „bickelwortes" parodieren und gleichzeitig kritisieren.
Um Wolfram lächerlich zu machen und ihn dadurch gleichzeitig zu tadeln, reichen nach unserem Empfinden der „buckelig“ banale Klang des „bickelwortes“ und die in einem kindlichen Würfelspiel assoziativ auftauchenden Namen, wie bickel, butje, gatje und stönneke nicht aus. Die Hauptabsicht Gottfrieds war es sicherlich nicht nur, jemanden lächerlich zu machen. Dafür ist die Idee, die der Kreation des „bickelwortes“ zugrundeliegt, zu raffiniert. Was an dieser Kritik sachlich gemeint ist, lohnt sich zur Kenntnis zu nehmen. Der Hauptgrund seiner Kritik scheint zu sein, daß Wolfram in seiner Sprache und seinen Bildern bewußt zweideutig sein will, indem er z.B. auf Sinn und Unsinn in einem Wort und Bild (siehe hier auch die Äquivokation als Stilmittel) gleichzeitig reflektiert: „lasternt unde erent“ (2,12) etwas verspottend und gleichzeitig verehrend.
Gottfried von Straßburg wollte im „bickelwort“ die Verbindung von positiven und negativen Aussagen in ein und demselben Wort als unvereinbar kritisieren. Was er als Fehler identifiziert, ist jedoch bei Wolfram keineswegs blinder „Zufall“, sondern künstlerische Idee. Die Einheit von „Sinn und Unsinn“, wie z.B. in der Erec-Satire, ist keineswegs „zufällig“ und deshalb auch nicht mit der „Zufälligkeit“ des Ergebnisses im Bickelspiel zu vergleichen.
Andererseits zeigt sich im Bickelspiel eine Besonderheit, die sich sinngemäß auf die Bilder Wolframs übertragen läßt: Es gibt keine, in einer linear aufsteigenden Wertskala von eins bis sechs geltenden Werte, sondern nur Wert oder Gegenwert, Alles oder Nichts! Auf diese Weise ist in dieser Wertskala die Vorstellung einer „Grenze“ und die Bewegung des Hin und Her um einen Grenz- oder Mittelwert „Null“ enthalten. Man hat also in diesem Wertsystem nicht die Vorstellung von „eins“ als kleinstmögliche Menge, sondern eine von „ Einheit“, die um eine Mitte pendelt, also Wert und Gegenwert umschließt. Jeder einzelne Wurf hat insofern eine „Orakelfunktion“. Auf eine schicksalhaft gestellte Frage wie die:„Soll ich, Caesar, den Rubikon überschreiten oder nicht?“, gibt ein einziger Wurf die Antwort: „Ja oder Nein“. Deshalb soll Caesar nach der Befragung des Orakels gesagt haben: „Alea iacta sunt“.
Wenn dies also die Funktionsweise der traditionellen „bickel“ war, woran kein Zweifel besteht, hat die mit dem „bickelwort“ verbundene Kritik eine genauer zu bestimmende inhaltliche und formale Bedeutung: Die elementare Behauptung Gottfrieds nämlich, daß in Wolframs Sprache Sinn und Unsinn eine vorübergehende Einheit bilden, je nachdem wie der Zufall es will oder man selbst es verstehen möchte.
Was als Vorwurf gedacht war , läßt sich auch positiv deuten. So zum Beispiel , wenn im Eingangsvers des Parzivalprologs das Wort „zwîvel“, sowohl „Zweifel“ als auch „zwei Fell’“, oder das Wort „gebur“ etwa „nächstliegender Bauer“ („Nachbar“) oder gleichzeitig „Bauer“ (Vogelkäfig) bedeuten könnte. Wolfram bedient sich der Doppeldeutigkeit (Äquivokation) einiger Wörter als stilistischen Mittels. Nach Gottfrieds Ansicht handelt es sich nicht mehr um die durch die traditionelle Poetik geforderte Übereinstimmung von „wort unde don“, sondern um die Einheit von Sinn und Unsinn.[6]
Man darf unterstellen, daß eine Verbindung von Wort und Bild in einem so komplexen Sinn im 12. Jahrhundert derart überraschend war, daß man Wolframs Sprache nicht ohne weiters als Dichtung anerkennen wollte. Sicher ist jedenfalls, daß diese neuartige „Bildersprache“ Gottfrieds Vorstellungen nicht entsprach und wegen ihrer Fremdartigkeit aus dem Rahmen literarischer Vorstellungen des 12. Jahrhunderts herausfiel.
Wenn man Wolframs Dichtersprache akzeptiert, bedeutet es, daß z.B. ein derart wichtiges Wort wie der „zwîvel“ sowohl Begriff als auch Bild, sowohl abstrakt als auch sinnfällig, sowohl etwas Bestimmtes als auch Unbestimmtes sein kann. Es bedeutet, wie viele Beispiele zeigen, daß mit einem Wort gleichzeitig positive und negative Aussagen, „lasternt unde erent“, gemacht werden können, je nachdem, wie man sie versteht. Im Spannungsverhältnis größtmöglicher Gegensätze kann auf diese Weise sogar „Unaussprechbares“ in einer sinnhaften Weise vermittelt werden. In dieser Zuordnung und dem daraus entstehenden Spannungsverhältnis des sprachlichen Ausdrucks handelt es sich aus heutiger Sicht um eine revolutionäre Veränderung der dichterischen Sprache. Ob es sich um jenen „wilden vunt“ handelt, wie Wolfram in Vers 4,5 sagt, läßt sich nicht erkennen. In ihrer freischwingenden Form wirken diese Bilder jedenfalls wie eine Spiegelung des Verhältnisses von Subjekt und Welt; wie ein sinnfälliges übergeordnetes tertium comparationis: als Form eine „vorübergehende Erscheinung“, aber eine künstliche und künstlerische Wirklichkeit. Sie „entsteht“ als flüchtige Begegnung des „Hin und Her“ immer erst dann, wenn man sie als Form in „statu nascendi“, im „Vorübergang“ wahrnimmt: „niht anders ich geleret bin: wan han ich kunst, die git mir sin“ (Willehalm 2,21-22).
Im „Elsterngleichnis“ ist die Elster nicht einfach den Menschen gleich: vergleichsweise schwarz oder weiß, wie sie böse oder gut sind. Beide „gleichen“ sich nur in ihrem Verhältnis zum „tertium comparationis“ (einem zu vermittelnden bzw. vermittelten Dritten), nämlich ihrem Verhältnis zu „Allem und Nichts“: So ist die Elster nicht einfach schwarz und weiß anzusehen. Davon steht im Text expressis verbis überhaupt nichts! Sie „tuot“ etwas mit Farbe, was wohl heißen soll, daß sie sich ihre Farben nach dem Prinzip von „Alles und Nichts“ auswählt: Das Weiß („ so habet sich an die blancen“ 1,13) als ein Alles an Farbe, wie das Tageslicht; das Schwarz als ein Nichts an Farbe, nämlich Lichtlosigkeit oder Finsternis (1,11-12). Dem Text gemäß handelt sie so. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich sage: „Weiß bedeutet gut, und schwarz bedeutet böse“, oder „Weiß ist „Alles“ an Farbe und schwarz ist das „Nichts“ an Farbigkeit.
„zwîvel“ heißt wörtlich übersetzt: „einen gespaltenen Sinn habend“, aber dennoch frei seiend: Der Mensch (als „Waleise“) kann, wie die Elster (es „tuot“) ebenfalls wählen, ob er an „Allem und Nichts“ teilhaben möchte. In einem neuen Verständnis werden bei Wolfram Sprache und Bilder nicht mehr analog interpretiert, etwa im traditionellen vierfachen Schriftsinn. Sie entsprechen in ihrer künstlerischen Form vielmehr der Existenz des Menschen, weil sie als dichterische Bilder durch seine „Teilhabe“ - Wolfram spricht davon als „stiure“, d.h. Beisteuer - als Form im Wahrnehmungsvorgang erst „existent“ werden. Das Realitätsverhältnis zur Dichtung als Kunsterfahrung wird durch Wolframs Werk auf eine „radikale“ Weise verändert und auf lebensweltlicher Ebene außerordentlich intensiviert. Das naheliegendste Beispiel für diese Behauptung ist der Eingang des Parzivalprologs (1,1-2), der im Fortgang der Überlegungen analysiert werden soll. Wie die Forschung vermutet, ist es nämlich der Prolog mit seinen vielen fremdartigen Bildern, auf den sich Gottfrieds Kritik richtete. Er behauptet jedenfalls direkt und indirekt, Wolframs Dichtung sei weder mit Vernunft noch mit Kunst vereinbar. Wort und Sinn seien in seiner Sprache verschiedene Dinge.
Der Vorwurf im Medium des „bickelwortes" an die Adresse Wolframs ist keineswegs oberflächlich, wie es auf einen ersten Blick erscheinen mag: Gottfried kommt im Bild seines „bickelwortes“ wirklich zur Sache. Seine Kritik zielt auf die künstlerische Autorität Wolframs als Dichter. Allerdings verfehlt sie ihr Ziel, weil sie den Gestaltwandel der Worte und die damit einhergehende Metamorphose des Sinnes in Richtung auf eine völlig „andere Qualität“, nämlich die relative „Wirklichkeit des Unsagbaren“, als künstlerische Form nicht oder noch nicht anerkennen wollte. Aus der Perspektive des 20. Jahrhunderts erscheint Gottfrieds Kritik, obwohl das sicher nicht beabsichtigt war, wie ein ausgesprochenes Lob für seinen Kollegen; umso mehr, weil sie ihn in seiner künstlerischen Potenz nicht treffen konnte.
In seiner Kritik, vor allem in der Verwendung seines raffinierten dichterischen Bildes „bickelwort", changiert Gottfried selbst in seiner Argumentation zwischen Bild und Begriff. Er kritisiert bei Wolfram das, was er selbst, wie das Beispiel zeigt, vorzüglich beherrscht und in diesem künstlerisch ausgetragenen Literaturstreit auch anwendet, nämlich die Kunst einer begrifflichen Aussage und ihrer gleichzeitigen Verschleierung in einem dichterischen Bild. In dieser Hinsicht zeigt er sich Wolfram durchaus ebenbürtig. Die Nicht-Eindeutigkeit der Sprache ist für Wolfram typisch. Die Rätselhaftigkeit des Textes wird dadurch erzeugt, daß er äquivoke Wörter verwendet und - was ganz ungewöhnlich ist - beide Bedeutungen im Rahmen eines dichterischen Bildes sinnbildend aufeinander bezieht. Was sie im Zusammenhang des neuen Ganzen bedeuten und welche Funktion die Doppeldeutigkeit von Wort und Bild hat, ist die Frage, die weiterhin untersucht werden soll. Wie sich das Verhältnis von Sprache und dichterischen Bildern bei der Interpretation des „Parzival“ auswirkt, werde ich am Eingangsvers Prologs zu analysieren versuchen.
Man könnte mit Recht die Frage stellen, ob die Zuspitzung der Dichterfehde auf das Bild eines Würfelspiels - wie Gottfried es macht - und der vorliegende Versuch einer Deutung dieses Bildes der literaturtheoretischen Diskussion des 12. Jahrhunderts gerecht werden kann. Diese Studie kann das natürlich nicht[7]. Es handelt sich lediglich um den Versuch, ein als dichterisches Bild erhaltenes Element dieser Diskussion nach Form und Funktion an der richtigen Stelle einzuordnen. Denn ebenso interessant wie der rätselhafte Gegenstand selbst, dessen besonderer Charakter im Spiel gedeutet wurde, ist seine übertragene Bedeutung als literarisches Mittel der Kritik. Das „bickelwort“ Gottfrieds ist ein komplexes dichterisches Bild, dem eine Schlüsselrolle im Dichterstreit des 12. Jahrhunderts zukommt.
2.5 „Bickelwortkritik“ im Literaturstreit - „Kinderkram“ in der Deutung
Es ist nicht auszuschließen, daß Gottfried von Straßburg mit seiner Bickelwortkritik die Dichtung Wolframs u.a. auch als „Kinderkram“ lächerlich machen wollte. Außer dieser Bedeutungsnuance des bekannten Literaturstreits weiß m.E. kein Wissenschaftler genau, was die Parodie Gottfrieds inhaltlich zu bedeuten hat. In der Fehdeforschung hat man u.a. diskutiert, ob Gottfried und Wolfram befreundet waren, in einer Hausgemeinschaft lebten, später gegeneinander polemisiert oder sich gar bis aufs Messer bekämpften. Das mag interessant sein. Meiner Meinung nach kommt es jedoch ausschließlich darauf an, in welcher literarischen Weise ein möglicher Streit auf dichterischer Ebene seinen Ausdruck fand. Eine solche sinnlich wahrnehmbare Form ist die Bickelwort-Polemik Gottfrieds. Nur darauf kann die Frage nach einem möglichen Inhalt (des Streites) gerichtet sein, der für die Deutung von Wolframs Dichtung aufschlußreich wäre.
In diesem Zusammenhang mögen die Erinnerungen an Bickelspiele der eigenen Kindheit, die Erörterung der Regeln dieses Spiels und die Beurteilung von Formen und Funktionen von ausgefallenen Würfelformen, die im Spielsystem eine entscheidende Rolle spielen, einen Literaturwissenschaftler zunächst irritieren. Man muß zugeben, daß die Diskussion derartigen „Kinderkrams“ im Zusammenhang mit den Regeln philologischer Argumentation widersprüchlich zu sein scheint; aber nur auf den ersten Blick. - Darüberhinaus kann auch die hier vorgelegte wissenschaftlich und statistisch exakte Ermittlung der Häufigkeitsverteilung verschiedener Würfelpositionen in zahlreichen Versuchsserien einen philologisch geschulten Wissenschaftler abschrecken.
Bevor man sich jedoch leicht amüsiert oder uninteressiert abwendet, sollte man zumindest die Ergebnisse, durch welche „ tatsächlich“ die Regelhaftigkeit eines möglichen Systems der Bickelwürfel nachgewiesen wurde, eigenhändig - d.h. im Spiel selbst- verifizieren. Wie dabei zu verfahren ist (s.S. 45 ff.), wird genau beschrieben. Nur dadurch erhält man eine auf eigener Erfahrung gegründete Vorstellung von einer „schanze“ im Würfelspiel mit Bickeln, von der sowohl Gottfried als auch Wolfram sprechen. Sie kann anders gar nicht vermittelt werden als im Spiel selbst. Mit folgenden Textstellen aus Wolframs Dichtung erinnert Ernst Martin an die typische Seite dieses Spiels, nämlich „den Fall der Würfel, [dem] Glücksfall, überhaupt [an] jede Entscheidung, die Gewinn oder Verlust bringt: 13,5/ 60,21/ 272,18/ 320,2 (s. dazu) 494,3/, 747,18/ W. 87,20/ 368,14/ 415,16“ (1903, S. 9). - Wenn man weiß, daß von ritterlichen Kampfspielen her Metaphern (z.B. „stehen und fallen“) auf das Würfelspiel übertragen (Lexer, Stichwort „topel) wurden, darf man davon ausgehen, daß mit „topeln“ das Glücksspiel mit Knöcheln gemeint sein könnte. Nur bei ihnen kann man entsprechende Stand-oder Liegepositionen unterscheiden, die über Sieg oder „Niederlage“ bzw. Leben oder Tod entscheiden. „ritterschaft ist topelspiel / unt daz ein man von tjoste viel“ (289,24), sagt Segramors, nachdem er von Parzival vom Pferd gestochen worden war.
Mit der Analyse des Bickelwortvorwurfes wurden also nicht nur mögliche „Nuancen“ eines Literaturstreites im engeren Sinne angegeben, sondern ein Sachverhalt aufgeklärt, der selbst zu Literatur wurde und im Streit zwischen den Dichtern eine Rolle spielt. Daher sind die wiedergefundenen Bickel nicht nur „Erinnerungen an die Bickel einer Kindheit“, wie man diesen „wilden Fund“ ironisch kommentieren könnte . Ihre Form und Funktion wurden hier nur als Werkzeuge benutzt, um dem Sachverhalt einer historischen Literaturkritik, d.h. seinem möglichen „Inhalt“ auf die Spur zu kommen. - Weil man in der Forschung schon immer versuchte, mit Hilfe des Literaturexkurses im „Tristan“ etwas über die dichterische Struktur des „Parzival“ zu erfahren, lag es nahe, aus methodischen Gründen ebenso zu verfahren. Das führte ebenso „zufällig“ wie logisch zu den Versuchen mit Bickeln und den Untersuchungsergebnissen. Von ihnen war in der Forschung wiederholt die Rede. Jedoch waren weder sie selbst noch ihre Spielweise bisher bekannt.
Trotz der eingehenden Beschäftigung mit einem relativ „handfesten“ Gegenstand des Literaturstreites soll jedoch keineswegs behauptet werden, daß es einen inneren Zusammenhang zwischen dem literarischen Bild Gottfrieds und der Dichtung Wolframs geben müßte. Das Gegenteil könnte ebensogut der „Fall“ sein: der Bickelwortvorwurf ist nach Inhalt und Form eine Karikatur des Wolframschen Stils und damit dem Sinn seiner Dichtung diametral entgegengesetzt. Es handelt sich also eher um eine „Spiegelung“, die nicht nur wegen ihrer Ähnlichkeit, sondern auch ihres Gegenteils, d.h. der virtuellen und polaren Entsprechung, indirekte Rückschlüsse auf den „dunklen Stil“ Wolframs zuläßt. Ein unmittelbarer logischer Zusammenhang, demzufolge man die Dichtung Wolframs aufgrund der Analyse der Bickelwortkritik besser verstehen können muß, soll hier nicht angedeutet oder konstruiert werden, er wäre in der Sache auch ein Mißverständnis.
Was allerdings die Wissenschaftlichkeit und die Bedeutung des Spiels und der Spielexperimente selbst betrifft, um das Regelsystem des Bickelspiels zu ermitteln, so sollte man sie nicht voreilig unterschätzen. Man kann sich in diesem Zusammenhang auf den Protagonisten der modernen Geisteswissenschaft, Gadamer, berufen. Der erste Teil seines Werkes „Wahrheit und Methode“, der die Überschrift trägt „Freilegung der Wahrheitsfrage an der Erfahrung der Kunst“ befaßt sich im Gliederungspunkt II mit nichts anderem als dem Spiel (S. 107-169) als Methode in der Geisteswissenschaft. Dort wird erklärt: „[...], warum uns der Begriff des Spieles so wichtig ist“ (s.S. 112 Stichwort „Faszination“ durch das Spiel). Weitere Nachforschungen nach dem Wort und Gegenstand „Bickel“ und den Regeln des Bickelspiels sind sicherlich interessant, m.E. aber für das Verständnis der vorliegenden Studie nicht unbedingt notwendig.
In der Lexikon-Literatur fanden sich bis zum Abschluß der vorliegenden Arbeit relativ wenige Hinweise auf Bickel und Bickelspiel. Im niederdeutschen Lexikon wird es lediglich als Spiel mit Schafsbickeln und einem Ball als bloßes Geschicklichkeitsspiel der Mädchen erwähnt. Das Lexikon des Mittelalters gibt unter dem Stichwort „Spiele“ bzw. „Glücksspiele“ folgenden Hinweis auf Schafsknöchel, die für Glücksspiele der Erwachsenen gebraucht wurden: „Die echten Glückspiele (Hazard-spiele) sind bei allen Kulturen magischen Ursprungs, und ihr Ausgang wird oft als Gottesurteil gewertet; die Könige von Schweden und Norwegen entschieden über die Zugehörigkeit einer Provinz durch Würfeln (1200). Das Glücksspiel mit einer Alternative, wie Halm („den Kürzeren ziehen“), mittels Münze (Wappen oder Schrift) oder Gerade-ungerade (Trimberg 13. Jahrh.), sind gang und gäbe. Mehrere Variationen bot das Würfeln mit Schafsknöcheln u. dem Tetraeder. Die echten Würfelspiele wurden mit 2-4 Würfeln gespielt. Johannes von Salisbury zählt zehn Spielarten.“
In seinem Buch 1934 erschienenen Buch „Land und Leute in Niederdeutschland“ berichtet Otto Lauffer im Kapitel „Niederdeutsches im Volksbrauch“ über die internationale Verbreitung des Bickelspiels seit über zweitausend Jahren: „Als besondere Einzelheit erwähnen wir noch das schon in der Antike weit verbreitete Spiel mit Würfelknochen aus der hinteren Fußwurzel der Zweihufer, Schaf und Ziege. In der Antike hießen sie Astragali. Dieses heute auch in England noch volkstümliche Spiel ist in ganz Niederdeutschland unter mannigfachen Namen verbreitet. Ein zugehöriger Würfelknochen hat sich schon in einer sächsischen Urne aus Altenwalde gefunden. Am Niederrhein und um Emden heißen sie ‘Bickel’“ (Lauffer, 1934, S. 227).
Auch in den Niederlanden ist das Spiel mit Knöcheln bekannt: „BIKKELSPEL, 1. het spelen met bikkels; - 2. Vier bikkels waarmede dat dat spel gespeelt wordt: WAAZEGGER m. WAARZEGSTER.“ Das unmittelbar folgende Stichwort lautet: „BIKKELWAARZEGGEREIJ, v. waarzeggereij uit het lot, uit dobbelsteenen of bikkels“. Aus dieser Zuordnung wird erkenntlich, daß die Bickel eine magische Funktion als Orakelspiele hatten. Das WAARSEGGEN selbst wird interessanterweise so vorgestellt: „iem. waarzeggen, hem de toekomst voorspellen.“ Jemandem mit Hilfe der Bickel wahrsagen heißt also wörtlich übersetzt, „ihm die Zukunft vorspielen“ (Vorhergehende Zitate aus: van Dale’s GROOT WOORDENBOEK der NEDERLANSCHE TAAL Spalte 274 und 2041).
Tacitus wundert sich über die Germanen „wie ein sonst so tüchtiges und reines Volk das Würfelspiel sogar im nüchternen Zustand bis zur Leidenschaft treiben könne; [...] so setzten sie auf den letzten Wurf Leib und Freiheit; der verlierende wird sammt Weib und Kind Sklave und darauf von dem Gewinner möglichst bald verkauft, der die Schmach eines solchen Gewinnstes sich gern aus den Augen rückt (Germ. 24)“ (Karl Weinhold, 1897 S.103). Das ist die andere Seite des Bickelspiels, vom Geschicklichkeitsspiel der Mädchen als „Kinderkram“ weit entfernt.
Die Frage, ob man in Wörterbüchern oder anderen Quellen entsprechende Belege fände, daß zur Zeit Wolframs tatsächlich ein ähnliches Bickelspiel gespielt wurde und damit ein Spielverständnis denkbar wäre, wie es in der vorliegenden Studie vorgeführt wurde, ist deshalb relativ unwichtig, weil Wolfram im Parzivalroman (siehe Angaben von Martin S. 57!) selbst Hinweise auf eben diese Struktur des Topelspieles als Gewinn- und Verlustspiel - auf die hier allein abgestellt wurde - gegeben hat. Entscheidend ist eigentlich nur, daß die Struktur des Topelspiels in den dichterischen Bildern Wolframs als Spiel mit dem Zufall im weitesten Sinne des Wortes wiederkehrt. Das könnte die Auskunft Gottfrieds sein, auf die es ankommt. Diese Information kann man indirekt auch der Form einer Satire entnehmen, deren erstes Ziel es allerdings ist, die kritisierte Dichtung lächerlich zu machen. Entscheidender als unmittelbare Folgerungen aus einem Literaturstreit zu ziehen, ist die Deutung des Eingangs (1,1-2) und des Elsterngleichnisses aus der Perspektive Wolframs von Eschenbach.
Eine Schwierigkeit besteht nun darin, darzustellen, wie im Eingang des Parzivalprologs die sprach- und bildlogische Seite dichterischer Sprachformen durch „Brechung“ miteinander in Beziehung stehen, d.h. sich einerseits widersprechen und andererseits, „darüber hinaus“ im Medium der Form, wieder ergänzen. Bevor im Anschluß an die oben gemachten Ausführungen eine Interpretation einiger Bilder des Prologeingangs versucht wird, soll eine kurzgefaßte Recherche die Hauptrichtung angeben, welche die Wissenschaft selbst bei der Erforschung und Interpretation des „Eingangsverses“ des Parzivalprologs einschlug.
3. Der „zwîvel“ des Parzivalprologs in der Forschung - Literaturreferat
Wie bereits gesagt, ist der „Parzivalprolog [..] eins der am schwersten verständlichen Stücke mittelhochdeutscher Dichtung", was man schon an „der Fülle der Versuche, ihn zu erklären" ablesen könne, sagt Rupp (1961, S 29). Seit Lachmanns Zeiten werde versucht, auf zwei Wegen dieses Ziel zu erreichen und zwar durch:
„1. Die Deutung des Prologs mit Hilfe der mittelalterlichen Philosophie und Theologie und
„2. die Deutung, daß ein großer Teil des Prologs aus einer Polemik gegen Gottfried von Straßburg bestehe“ (Rupp, 1961, S. 31).
Rupp stellt die Frage: „Ist dieser Prolog wirklich so widerspruchsvoll, oder ist er nicht bei genauem Zuhören und Hinhören und zwar naivem [...] als sinnvoller Parzivalprolog verständlich" (Rupp, 1961, S. 31). Diese Formulierung erweckt die Hoffnung, daß man mit einer gewissen Genauigkeit des Zuhörens, die das übliche Maß überschreitet, das, was an diesem Text einander widerstrebend ist, so vereinen könne, daß es einen Sinn ergäbe. Nun ist der Prolog nicht deshalb so widerspruchsvoll, weil es sich um einen künstlerischen Text handelt, denn ein solcher tendiert auf Einheit, und mit bloßer Genauigkeit kann man seine literarische Form wohl kaum erkennen. Gleichzeitig genau und naiv hinzuhören, ist schon ein Kunststück. Man darf jedoch vermuten, daß Rupp an eine bestimmte Art künstlerischer „Naivität“ gedacht hat, die als „naiv“ erscheint, es aber nicht ist ! Ebensowenig wie das Vorgehen Rupps „naiv“ ist, obwohl er „Naivität“ dafür in Anspruch nimmt. Es ist also zu fragen, was mit der Verbindung von „Genauigkeit“ und „Naivität“ gemeint sein könnte. Oberflächlich gesehen erscheint das, was trotz „naiven und genauen“ Vorgehens als Übersetzung des Eingangs, von Rupp, „nüchtern übersetzt" angeboten wird, sich kaum von anderen Übersetzungs- bzw. Deutungsversuchen zu unterscheiden. Die zwei Verse lauten:
„Wenn der zwîvel Nachbar des Herzens ist, dann muß das der Seele große Schwierigkeiten bereiten" (Rupp, 1961, S. 33).
In dieser Form der Übersetzung ist „ zwîvel [..] dann zwîvel in der ganzen Weite seines Inhalts, Ausdruck für eine Haltung, die beim leisesten Zweifeln beginnt und zur radikalen desperatio führen kann" (Rupp, 1961, S. 36f.). Das entscheidende Wort zwîvel wird notgedrungen oder bewußt der Vielfalt seiner möglichen Bedeutungen überlassen, also - im Grunde - nicht „übersetzt“. Indem so die Entscheidung, was „zwîvel“ bedeutet, offen bleibt, distanziert sich Rupp indirekt von den späteren „zwei Hauptpositionen der Forschung“, die sich hinsichtlich des „zwîvel“ unterscheiden lassen: „Einmal wird zwîvel aufgefaßt als religiöser Zweifel, zum andern als „Schwanken“, entweder mehr im Sinne des Wankelmutes oder, umfassender, als Ungewißheit und Unschlüssigkeit in den letzten Fragen des menschlichen Seins überhaupt, als allseitiges Erschüttertsein.“ (Werner Hoffmann, 1963, Definition von „zwîvel“ als Lexikondefinition in: Gottfried Weber, Gottfried von Straßburg).
Von einem Dichter erwartet man jedoch, daß sein Wort auf irgendeine Weise auch „prägnant" ist, daß er in seiner Aussage etwas „verdichtet", was vorher in den Umrissen nicht so „dicht“ war, als daß man es hätte erkennen können. Diese Forderung muß man auch an den Interpreten stellen, selbst dann, wenn man weiß, daß „im Mittelhochdeutschen [..] oft mehrere Bedeutungen ein und desselben Wortes nebeneinander oder gegeneinander stehen, und mehr noch: Bedeutungen und Bedeutungsschichten ineinandergreifen“ (Hoffman, 1963, S. 947).
Positiv gesehen steht in der Übersetzung von Rupp das Wort „zwîvel" gemäß der o.a. Übersetzung nach wie vor in einem ursprünglichen Sinnzusammenhang des Textes, der noch immer irgendwie verhüllt zu sein scheint. Auch das entscheidende Wort „nachgebur“ ist in seiner Übersetzung erhalten geblieben. Der „Nachbar des Herzens“ klingt zwar nicht sehr poetisch. In dieser Übersetzung werden jedenfalls keine Festlegungen oder Auslassungen vorgenommen. Insofern kann man von Texttreue sprechen, als das akustische Material, das bei der Deutung eine große Rolle spielt, vollständig erhalten blieb.
Liegt das, was Rupp „Genauigkeit“ nennt, was ich selbst lieber als „Prägnanz einer künstlerischen Form“ bezeichnen möchte, nicht teilweise oder „ganz“ auf einer anderen als wissenschaftlichen Ebene? Rücken die „Mitgegenwart“ bzw. ein „Mitklingen der einen Bedeutungssphäre in der anderen“, wie Hoffmann in seinen „Worterklärungen“ sagt, nicht auch die Worte des Parzivaleingangs zugleich in eine andere Interpretationsebene, die neben den zwei zitierten Hauptrichtungen der Wolframforschung (Rupp, 1961, S. 31) Geltung haben? Die andere Art von Genauigkeit, daß dem Text nichts hinzugefügt oder weggenommen werden darf, ist selbstverständlich.
Ein weiterer Vorteil dieser „naiven“ Übersetzung Rupps besteht darin, daß das „auffällige nâchgebûr" als „Nachbar" mit seinem ganzen Gewicht im Versgefüge aus der Fülle historischer und zeitgemäßer Glättungsversuche bei Übersetzungen wieder auftaucht. In zahlreichen anderen Übersetzungen wurde das „sperrige“ Wort „nâchgebûr“ trotz oder gerade wegen seiner Auffälligkeit immer wieder bereinigt, „raffiniert", reduziert, „geglättet“ oder ganz aus dem Text eliminiert. Der Ehrlichkeit und dem sog. naiven Umgang mit dem Text ist es zu verdanken, daß dieses Wort überhaupt wieder auf der Bildfläche und vor allem akustisch erscheint.
Andererseits kommt dadurch die Un-Stimmigkeit und das Unbehagen an der unvermittelten Zuordnung von „zwîvel-herz-nâchgebûr“ erst richtig wieder ans Tageslicht. Weil jedoch auf diese Weise der Vers, auch in der Übersetzung, akustisch als Ganzheit erhalten bleibt, erhält vor allem der Hörer die Chance, sich auf eigene Faust mit der Rätselhaftigkeit des Originaltextes zu befassen, eine Chance, die ihm bei einer sprachlich geglätteten Übersetzung vorenthalten bliebe.
Es spricht einiges dafür, daß es sich bei dem Eingangsvers um ein Rätsel handelt, das im dichterischen Konzept einen ganz bestimmten Sinn zu erfüllen hat; und da kommt es auf jeden Buchstaben und vor allem jeden Laut an!- Wenn man also lieber bei einer etwas prosaisch und gar nicht dichterisch klingenden Übersetzung bleibt, die scheinbar vom Text so gefordert wird, muß man sich selbst schon Mut machen, wie Rupp (1961, S. 31) es tut: „denn Wolfram war ja schließlich ein großer Dichter." Gegen die o.a. Interpretation ist zunächst nichts einzuwenden.
Die Beteuerung Rupps klingt merkwürdig: so, als ob es da doch etwas zu entschuldigen gäbe. - Diese Anmerkung - nicht ironisch gemeint - ist eher Ausdruck einer eigenen ähnlichen Empfindung denn Kritik an der Aussage Rupps. Nicht nur der Eingangsvers selbst und seine Übersetzung, auch sein Kommentar geben ein Rätsel auf. Damit soll nur gesagt werden, daß es im positiven Sinne „anregend“ genug war, im Text selbst, z.B. im entscheidenden programmatischen Eingang des „Parzival“, nach einer anderen Lösung des Rätsels zu suchen.
Es wird also nicht bestritten, daß die Übersetzung ‘richtig’ ist, schon deshalb, weil der geschriebene Text wörtlich übersetzt wurde und damit seine akustische Substanz erhalten blieb, auf die es hier wirklich ankommt. Möglicherweise ist aber auch das „geschriebene Wort“ nur die „halbe Wahrheit“ des mündlich vorgetragenen Urtextes, weil der Dichter z.B. mit dem Stilmittel einer „Äquivokation“ gearbeitet haben könnte, so daß die andere Hälfte der Wahrheit noch im dazugehörigen akustischen Teil des Textes enthalten ist und erst noch identifiziert werden müßte. Liegt etwa die Unstimmigkeit der Übersetzung im Widerspruch zwischen geschriebenem Text und gesprochenem Wort des Originals? So ist es! Mit dieser Bemerkung soll nicht auf Theorien von „oral poetry and written composition“ angespielt werden. Es handelt sich im Sinne von Rupp hier nur um eine „naive“ Frage, die aus methodischen Gründen ganz bewußt nicht vor einem wissenschaftlich-theoretischen Hintergrund gestellt werden sollte.
Vielleicht muß man also noch „genauer“ zuhören, als Rupp es schon tat, um einen von Wolfram gewollten selbstironischen oder auch parodistischen Ton zu erkennen, und im künstlerischen Sinne noch etwas „naiver“ fragen, um die andere, noch verborgene Hälfte der Wahrheit zu ahnen. Jedes Ding hat bekanntlich seine zwei Seiten. Hat man bisher nur die „Rückseite“ des Einleitungsverses gelesen und die „Schauseite" noch gar nicht bemerkt bzw. noch gar nicht danach gesucht?
Ironie ist dadurch gekennzeichnet, daß sie u.U. das Gegenteil von dem ausspricht, was sie wirklich meint. In der Selbstverspottung, d.h. „in der Selbstironie drückt sich eine kritische, spielerisch überlegene Haltung sich selbst gegenüber aus" (dtv). Insofern gibt die o.a. Bemerkung Rupps, „denn Wolfram war ja schließlich ein großer Dichter", vielleicht jene Reaktion wieder, die dieser bei seinem Publikum gerade auslösen wollte: einen Zweifel, der nachdenklich macht, ob das, was geschrieben steht, wohl stimmen möge, und ob durch die Art, wie es gesagt ist, nicht auch etwas ganz anderes gemeint sein könnte.
Diese allgemeine Verunsicherung, die nach dem Hintersinn der Eingangsverse des Parzival fragt, wirkt in der Wolframforschung weiter und wird von bekannten Wissenschaftlern wie Bumke, Hempel, Nellmann und Wapnewski u.a. freimütig zugegeben. Um die oben angeführte Beteuerung über die Dichtkunst Wolframs in gewissem Sinne zu rechtfertigen, wage ich zu behaupten: Jede Übersetzung klingt im Vergleich mit dem Originaltext poetisch unbefriedigend. Die Frage stellt sich, ob es dafür einen Grund gibt, der in der spezifischen Struktur dieser mhd. Dichtung begründet ist.
Eine gewissermaßen erzwungene Rat- und Respektlosigkeit zwingt dazu, nach Gründen zu suchen, warum ein relativ ungünstiger Eindruck - was das Verstehen betrifft - vom Anfang des Parzivalromans vom Dichter überhaupt zugelassen oder vielleicht sogar gewollt ist. Jedenfalls ist der Dichtung damit auf merkwürdige Weise ein bleibendes, beunruhigendes Motiv eingeimpft, sich immer wieder intensiv mit dem „Eingangsrätsel“ bzw. dem Dichter zu befassen.
Man darf jedoch davon ausgehen, daß hier ein gewollter selbstironischer Effekt vorliegt, der sowohl bei den Zeitgenossen Wolframs als auch in heute vorliegenden Übersetzungen eine vergleichbare Wirkung auf die Zuhörer auslöste. Es ist zum „Verzwîveln", das scheint auch Schröders Kommentar zu den ersten Zeilen des Prologs zu sagen: „Es muß den, der mit Vernunft begreifen will, der Zweifel überkommen, der Zweifel an der Weisheit dessen, der solches schrieb" (W.J. Schröder, 1951/52, S. 135). Wapnewski sagt im Vorwort zu seiner Arbeit „Wolframs Parzival“: „Wolfram mag der bekannteste der mhd. Dichter sein - er ist zugleich der unerkannteste, der rätselhafteste, der geheimnisvollste" (1955, Vorwort). In der Auseinandersetzung mit Schneider ist ihm zuzustimmen: „Aber Schneider irrt, wenn er meint, dem zwîvel-Motiv im Parzival komme gewissermaßen nur Aufmerksamkeit und Erinnerung weckende, kontrastierende, zeitgebundene, polemische Funktion zu, keine den Helden und sein Schicksal andeutend beschwörende, dunkel vorausweisend antizipierende Geltung.“ (Wapnewski, 1955, S. 19). Er fährt unmittelbar daran anschließend fort:
„`Ist zwîvel herzen nâchgebûr, daz muoz der sele werden sur,’
wer das immer wieder auf sich wirken läßt, der wird schließlich fragen, wie denn nur diese Verse sich nicht auf Parzival beziehen könnten?" - Schwerwiegend ist dann allerdings das Eingeständnis Wapnewskis: „Der zwîvel im Parzivalprolog ist aus dem Prolog selbst heraus nicht voll zu deuten." - Treffend, aber trotzdem überraschend, ist seine, noch auf derselben Buchseite getroffene Feststellung: „So schreibt Wolfram, in der Nachfolge Chretiens stehend, einen Anti-Chretien. Und schreibt, in der Nachfolge Hartmanns stehend, einen Anti-Hartmann. Das Kennwort dafür ist zwîvel." Daß es sich um einen „Anti-Hartmann“ in einem ganz besonderen Sinne handelt, der nicht direkt mit „zwîvel“ zu tun hat, läßt sich außerdem noch durch die bitterböse Erec-Satire (S. 185) und Enite-Kritik (S. 168) im Parzivalprolog belegen. Zunächst gilt das Interesse jedoch dem „zwîvel“.
Diese zutreffende Behauptung Wapnewskis bedarf einer Begründung. Das „Kennwort" bzw. das Erkennungswort, mit dessen Hilfe man den Unterschied zwischen Hartmann und Anti-Hartmann (d.h. Wolfram) identifizieren kann, ist also der „zwîvel“. Diese Aussage basiert zunächst nur auf einem Gefühl, ähnlich wie bei den o.a. Forschern. Wenn hier im positiven Sinne kritisiert wird, das Gefühl habe immer schon eine Rolle gespielt, so muß ergänzend gesagt werden, daß man auf das Gefühl als Erkenntnismöglichkeit gar nicht verzichten kann, daß es aber nicht in einen wissenschaftlichen, sondern künstlerischen Kontext gehört, was die Deutung der dichterischen Bilder betrifft; nicht zuletzt deshalb, weil Dichtung Kunst ist.
Mit fast leidenschaftlich zu nennendem Engagement hatte sich auch Hempel, einige Jahre früher als Rupp, gegen die oben bereits erwähnte Deutung des Eingangsverses durch Schneider gewandt: „Die Beziehung zu Hartmann besteht wirklich. Aber nicht zugeben werden wir, daß unser von seinem religiös-sittlichen Anliegen so geradezu besessener Dichter mit diesen nachdrücklich hingesetzten Überschriftversen nur theoretische, moralisierende Betrachtung habe geben wollen, die mit dem Gehalt seiner Dichtung nur in loser Beziehung stände, daß er nicht vielmehr in deren Kern gezielt habe. Das erste Verspaar muß mit dem, was folgt, einen gedanklichen Zusammenhang bilden und auf das zentrale Anliegen des Dichters weisen, der hier im Vorspruch, wie ich glaube, vorblickend die Summe von Parzivals ganzer Existenz zieht" (Hempel, 1951/52, S. 167). Die im zweiten Teil der vorliegenden Analyse des Parzivalprologs als Hartmannkritik identifizierte Reihung von dichterischen Bildern in den Versen 2,15-24 kann die Aussage Hempels inhaltlich unterstreichen.
Hempels Position, was die o.a. Verteidigung Wolframs betrifft, wird allerdings dann schwach, wenn man sein Verhältnis zu den dichterischen Bildern, die für jede Interpretation eine große Rolle spielen, genauer betrachtet. Er sagt: „Wolframs Denken aber ist wesentlich intuitiv und sinnbildend, nicht logisch-diskursiv, sondern in Bildgestalten [...] Selbst wo er, wie im Eingang des Parzival sich vorsetzt, etwas von den Grundideen seines Werkes auszusagen, spricht er abgerissen und gerät sofort wieder ins Bildliche hinein, Vergleich auf Vergleich in abrupter Reihung häufend, daß der Hörer kaum zu folgen vermag. So ist der Eingang des Parzival an vielen einzelnen Stellen dunkel und sprunghaft, wie er auch als Ganzes keinen völlig klaren Aufbau zeigt“ (Hempel, 1951/52, S. 162).
Über die Bildhaftigkeit in Wolframs Dichtung äußert sich Bumke (1997, S. 135), wie bereits kurz erwähnt, so: „Das auffälligste Merkmal von Wolframs Sprachstil ist die Fülle bildhafter Wendungen (Umschreibungen, Vergleiche, Metaphern) und die Ausgefallenheit seiner sprachlichen Bilder.“ Er fährt fort: „Nach der Lehre der Poetik haben sprachliche Bilder die Funktion, Lebendigkeit und Anschaulichkeit zu erzeugen. Bei Wolfram sind die Bilder eher befremdlich oder dunkel, manchmal auch bedrohlich, voller Überraschungen und Spannungen, mitunter ins Fratzenhafte verzerrt.“ Bumke betont im Rückgriff auf die traditionelle Lehre der Poetik die „funktionale“ Abhängigkeit der dichterischen Bilder von der Sprache und der auf Umwelterfahrung gerichteten Wahrnehmung, durch die sie vermittelt werden; dafür bringt er verschiedene Beispiele (593,14-18 409,25 ff.; hier das Bild von Nieswurz und Hasenvergleich).
Die zentralen dichterischen Bilder Wolframs sind keineswegs sprachunabhängig, jedoch in dem Sinne „abstrakt“, als in ihnen Erfahrungen vermittelt werden, die in der Außenwelt keine Entsprechung finden. Sie entstehen mit der Wahrnehmung des Textes in der Phantasie der Hörer und können nur mit den „inneren Augen“ erzeugt bzw. angeschaut werden. Der Sinn des Textes (bzw. seiner Bilder) erschließt sich bei ihm in dem, was er als künstlerische Form ist, erst durch eine besondere Art von Selbstverständlichkeit des Zuhörers, ob er z.B. überhaupt die sogenannte „Beisteuer“ leisten kann oder will. Wenn Wolfram sagt, daß das vligende bispel tumben liuten gar ze snell“ ist, heißt das ja nicht, daß es für sie nichts zu bedeuten hat. Die „Leute“ hören den Text zwar auch; aber anders als jene, für die im Erkennen seiner Form derselbe Text sich wandelt. Diese Metamorphose der Sprache - Wolfram spricht von „wenken“ - bleibt den tumben liuten verborgen. Im Zusammenspiel der in der Phantasie des Hörers entstehenden fiktiven dichterischen Bilder wird erst der Sinn des Ganzen auf der Ebene der künstlerischen Form wahrnehmbar als „Vorübergang“. An ihm sind das Objekt, d.h. der Text durch seine Form, und das Subjekt, indem es als Hörer nicht nur den Text als objektiven Befund, sondern auch dessen Form wahrnimmt, gleichermaßen beteiligt. Das heißt, dichterische Bilder können nicht nur funktional, abhängig von der Sprache etwas bedeuten, sondern: die Hervorbringung ihres Sinnes wird gleichzeitig von einem subjektiven Bildverstehen her so gelenkt, daß sie auch „sagen“ können, was „unsagbar“ ist. Dieses Hin und Her von Wortbedeutung und wirklicher Bedeutung im dichterischen Bild erfolgt blitzschnell und komplexartig in der Phantasie: „tumben liuten“ geht das viel zu schnell.
Das Bild ist dem Wort als Hintergrundinformation völlig gleichwertig zugeordnet, wie vergleichsweise die Relation von Sujet und Hintergrund in der modernen Malerei seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Sinn eines Wortes kann also durchaus von dem mit ihm verbundenen abstrakten dichterischen Bild, das keineswegs im traditionellen Sinne „anschaulich“ sein muß, festgelegt werden, m.a.W. die o.a. einseitige Funktionalität „funktioniert“ sogar auch in umgekehrter Richtung: Der Sinn eines Wortes kann abhängig sein von einem im Text verborgenen Bild, wie man es von Rätselbildern her kennt.
Daß sich einem Zuhörer oder Leser der künstlerisch-bildlogische Zusammenhang literarischer Bilder nicht ohne weiteres erschließt, ist nicht verwunderlich. Denn sie sind keineswegs nur im inhaltlichen Sinne der Sprache so zugeordnet, als ob Sprachlichkeit die passende Form und ihre Bildhaftigkeit nur inhaltlich zu verstehen sei. Sprachlogik und Bildlogik folgen ihren eigenen, z.T. ganz unterschiedlichen Regeln und Gesetzmäßigkeiten. Das gilt nicht nur für ein an der Wand hängendes „Ölbild" von Rembrandt, eine Plastik im Gewande eines bestimmten Werkstoffs oder ein abstraktes Bild von Franz Arp, sondern auch für ein dichterisches Bild im Klanggewand der Sprache bei Wolfram von Eschenbach. Schon aus diesem Gegensatz von Sprachlogik und Bildlogik ergeben sich Schwierigkeiten und Mißverständnisse bei der Interpretation. Sie werden bei einer einseitigen und methodischen Festlegung auf den geschriebenen Text und dem Übergewicht des rein sprachlogischen Umgangs mit ihm nicht einmal bemerkt.
Selbst ein „behutsames Vorverständnis“ über „Text und Bild - Bild und Text“ kann nicht über sachliche und sprachlogische Schwierigkeiten hinweg täuschen. Auf dem bereits zitierten gleichnamigen Symposion 1988 war etwa folgender Satz zu hören: „Ich möchte also nicht ergebnisantizipierend wirken, [...] wenn ich also zu Anfang der Gepräche sage, mit ‘Text’ lassen sich alle sprachlichen, mit ‘Bild’ alle bildlichen (bildnerischen) Medien der menschlichen Kulturarbeit abkürzend bezeichnen, ...“ (DFG-Symposion 1988). Natürlich ist eine solche suggestive Aussage der Versuch der Vorwegnahme eines sachlichen Ergebnisses, selbst wenn man sich rhetorisch bemüht, es nicht so erscheinen zu lassen. Wer die Verschiedenheit von Sprache (Text) und Bild (bildnerische Medien) so betont, kann natürlich das Wörtchen „und“ im Chiasmus des Titels nicht brauchen. Es signalisiert Einheit und damit Widersprüchlichkeit der Aussage. Deshalb wird der oben zitierte Satz so weitergeführt:..„wenn ich auf die höchst kompliziert zu verstehenden Aussagemöglichkeiten des ‘ und ’ in unserem Thema nicht eingehe “. Das selbst auferlegte Sprechverbot klingt zwar wie eine Begründung der vorhergehenden Aussage. Tatsächlich kommt es jedoch gerade auf die ausgeklammerte unscheinbare Vokabel „und“ an, weil sich darunter die besondere Qualität von Einheit verbirgt, nach der im o.a. Falle 1+1 nicht 2, sondern 1 ist: Die Einheit von Text und Bild. Sie kann eben nicht „additiv“, weder als „Superadditivum“ noch als „Quasi-Einheit“ vorgestellt werden. In der Literatur wird der Chiasmus immer dann als stilistisches Mittel verwendet, wenn eine untrennbare Einheit als Ganzheit hervorgehoben werden soll.
In einer Studie, die eigens dem Kenn- und Kernwort des Prologs, dem „zwîvel" gewidmet ist, sagt Hempel: „Das Verständnis der Einleitung und darüber hinaus wesentlicher Sinnbezüge in Wolframs Parzival hängt vor allem davon ab, wie man den zwîvel auslegt, den der Dichter mit epigrammatischem Nachdruck im ersten Verspaar hinstellt als eine Bitternis der Seele. Ich teile die Meinung, daß Vers 2 prägnant aufs Ganze geht und bedeuten soll: 'das führt die Seele in ewige Qual'. Hiermit wäre über die alte Streitfrage, ob der Dichter den Zweifel vorwiegend religiös oder weltlich gemeint habe, bereits entschieden.“ (Hempel, 1951, S. 157) - Daß der Eingangsvers als „Ganzheit“ aber auch ein dichterisches Bild oder Bildrätsel sein könnte, in dem der „zwîvel“ künstlerisch noch etwas ganz anderes bedeutet, wird nicht in Erwägung gezogen, weil die Möglichkeit einer anderen als religiösen Form, nämlich der literarischen Einheit nicht erwogen wurde. Eine solche künstlerische Ganzheit müßte der einseitig „religiös“ definierten nicht einmal widersprechen; im Gegenteil: eine religiöse Aussage, das nämlich, was im Grunde „unsagbar“ ist, bedarf umso mehr der künstlerischen Form als jede andere Aussage.
Durch die schon im ersten Satz der Studie erfolgte Festlegung auf das Religiöse erhält „zwîvel" eine überwiegend theologisch-diskursive, begriffliche Färbung. Wenn Hempel auch zugesteht: „das Wort hatte (in älterer Zeit) einen viel weiter gespannten und man möchte fast sagen amorphen Bereich", so werden doch im einzelnen begriffliche Abgrenzungen vorgenommen, die selbst wiederum kaum zu den Vorstellungen von Gestaltlosigkeit passen, die von Hempel mit dem Zwîvelbegriff in Zusammenhang gebracht werden, wie die Ausdrücke „amorph - vage - unschlüssig - verschwommen“ signalisieren. Hempel unterscheidet den „zwîvel“ begrifflich wie folgt:
„1. Ungewißheit (Denkzweifel) (S. 163) “2. Unfähigkeit zu beschließen (Wollenszweifel) (S. 165) “3. Angst, Besorgnis, Verzagtheit (Gefühlszweifel) (S. 165) “4. Zweifel (als) der Gegensatz von Beharrlichkeit und Treue und bedeutet Untreue, (S. 166) “5. Zweifel [...] eine Meinungsverschiedenheit zwischen Parteien (S. 168).“
Im Sinne Wolframs und seiner Zeit [...] war zwîvel eine vage Komplexvorstellung, die intellektuelle wie (die) willensmäßige Unschlüssigkeitslage samt ihren Gefühlsausstrahlungen [...] einschließen konnte [...] Gerade die Verschwommenheit der komplexen Globalbedeutung war das Wirkliche, das je in Erlebnis und Sprachgebung eintrat [...]" (Hempel, 1951, S. 168).
Diesen pointiert vorgetragenen wissenschaftlichen Ergebnissen soll im Grunde nicht widersprochen werden. Dennoch wird im Gegenzug zu den o.a. Thesen die Frage nach der „Prägnanz“ der dichterischen Form weiterhin erlaubt sein. Ein anerkannter Wissenschaftler wie Hempel wird sie sich sicher selbst gestellt haben, so daß sie hier nur wiederholt wird. Hier ist also die Frage nach der Prägnanz der Form nicht primär Kritik wissenschaftlicher Ergebnisse, sondern methodische Absicht: Im Vergleich mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Arbeit läßt sich eine naiv-künstlerische Arbeit mit und am Text besser artikulieren.
Der zitierte Katalog möglicher Bedeutungen kann sicherlich bei einer Interpretation des „zwîvels“ im Eingangsvers mitgemeint sein, m.E. aber „nur unter anderem“. Was das eigentlich „Andere", nämlich Künstlerische an der Dichtung (und Deutung) ausmacht, ist also die immer noch offene Frage: Wie hat der Dichter die Menge „denkbarer" begrifflicher Bedeutungen so „ verdichtet", daß gerade nicht die „Verschwommenheit einer komplexen Globalbedeutung als das Wirkliche" übrig blieb, sondern deren Einheit. Zu dem Problem der Komplexität von „maere“ sagt Wolfram selbst:
„Solt ich nu wîp unde man ze rehte prüeven als ich kan, dâ vüere ein langez maere mite. nu hoert dirre âventiure site“ (3,25)
Es interessiert insbesondere, wie er diese Quantität in Qualität, d.h. in jene „prägnante" sprachliche Form, die man dichterisches Bild nennt, überführt hat: „dar zuo gehôrte wilder vunt“ (4,5). Schon aufgrund solcher, bloß formaler Überlegungen und Vermutungen müßte vom Wort „zwîvel“ noch etwas anderes erwartet bzw. sogar „gefordert“ werden als nur eine Menge denkbarer Bedeutungen. Es kann doch nicht sein, daß der Dichter „sein ganz besonderes Wort", nämlich den „zwîvel", als Anfangswort des „Parzival“, der „Vielfalt möglicher Bedeutungen", wie Rupp meint, oder auch der „Verschwommenheit einer komplexen Globalbedeutung", wie Hempel sagt, einfach überlassen hat. - Der Eingang des Parzivalprologs im Originalton gibt, selbst wenn man ihn nur ungenau versteht, überhaupt keine Assoziationen her, die mit Gestaltlosigkeit oder Verschwommenheit zu tun haben.
Die Frage könnte lauten: In welcher Form werden die genannten möglichen Interpretationen, die ja gar nicht grundsätzlich falsch und einfach von der Hand zu weisen sind, zusammengehalten? Wie hat der Dichter die Fülle möglicher Deutungen „verdichtet“, so daß nicht alles zerfließt; m.a.W. wie hat er die Reduktion solcher Komplexität überhaupt bewerkstelligt?- Man könnte die Frage sogar so zuspitzen: Wie hat Wolfram sich, weil der „zwîvel" zu seiner Zeit so vieldeutig war, geradezu gegen Globalvorstellungen, Vieldeutigkeiten und Verschwommenheiten, aber auch Eindeutigkeiten wehren können, ohne sich auf Begrifflichkeit festlegen zu lassen? Gerade in diesem Sinne ist Wolframs Parzival auch ein Roman über die Fragwürdigkeit der Begriffe und damit ein Roman über die Erfahrung. Meine Thesen hierzu lauten:
1. Der Vorspruch (Eingangsverse) ist nicht nur eine ganz gewöhnliche und „bescheidene" begriffliche Aussage (Sentenz), sondern als Einleitung des Ganzen selbst eine „Einheit“. Sie ist eine „Initiale", in der Form eines geheimnisvollen dichterischen Bildes: ein Rätsel und Erlösungsrätsel, bei dem es um Kopf und Kragen geht, ähnlich wie beim Sphinx-Rätsel.
2. Der erste Doppelvers ist ein exemplum für das, was er selbst sein will: ein „bîspel": Ein „Doppelspiel" mit den Worten „zwîvel" und „nâh-gebûr"; ein „Bickelspiel“ um das menschliche „herz", den Sitz aller menschlichen Tugenden, d.h. des „unverzaget mannes muot" (1,5).
3. In diesem „Bickelspiel", einem unzulässigen „Spiel der Worte", wie Gottfried meint, wird das Schicksal herausgefordert: Es geht in der Tat ums „Ganze": um das menschliche Herz . Nicht der zwîvel ist deshalb die „Sinnmitte " des ersten Verses, sondern das herz. Exakt aus diesem Grunde steht „herzen" in der Mitte des ersten Verses; so wie „sele" die Sinnmitte des zweiten Verses ist und seinen Platz in der Mitte der zweiten Zeile hat.
4. Herz und Seele sind, völlig symmetrisch angeordnet, die beiden waagerechten Dreh- und Angelpunkte des ersten und zweiten Verses im Prolog. In bezug auf die Fortsetzung der Gedanken des Eingangs bilden sie den Anfang einer Symmetrieachse, die der Länge nach den Eingang durchzieht und sinngemäß von den nachfolgenden Versen umspielt wird.
5. Je nachdem, wie man den Text wahrnimmt oder wie weit man ihn „durchschaut", erscheint er entweder als begriffliche Aussage oder als Bild, im Grenzfall als die Einheit von beiden: als dichterisches Bild.
6. Der volle Sinn und die künstlerische Realität erschließen sich erst im Zusammenwirken von Schauseite und Kehrseite des sogenannten Vorspruchs, wie die zwei Seiten einer Münze.
7. Wer mit der Zweideutigkeit der Welt-Wirklichkeit umgehen kann, so, wie sie in künstlerischer Form vermittelt, d.h. in dichterischen Bildern des Romans präsent ist, kann sich auch in der Welt selbst zurechtzufinden: Swer mit disen schanzen allen kan, an dem hât witze wol getân“ (2,13-14).
Was in diesen sieben Punkten „pointiert" gesagt wurde, ist nicht apodiktisch gemeint. Sinngemäß sind diese Thesen nämlich selbst eine „Beschränkung“ bzw. der Gegenpol zu der oben zitierten „Vieldeutigkeit, Unbestimmtheit und Verschwommenheit", die dem Eingangsvers des Prologs expressis verbis im Wort „zwîvel“ gleichermaßen unterstellt werden kann. Daneben sind die Thesen im programmatischen Sinn auch als Richtungsangabe für die nachfolgenden Überlegungen zu verstehen.
Wie die allgemeine Rezeptionsgeschichte zeigt, hat man auf diskursivem, wissenschaftlichem Wege verschiedene Interpretationen des Prologs versucht, ohne eigentlich zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen. Unter diesen Umständen sich den Sinn des Prologs auf künstlerischem Wege zu erschließen, wäre die naheliegendste Möglichkeit des Verstehens. Diese „schanze" ist vielleicht gerade deshalb schwer wahrzunehmen, weil sie nicht nur so nahe liegt, daß man sie einfach übersieht, sondern weil sie darüber hinaus so etwas wie „Teilhabe“ erfordert. Man könnte meinen, Bumke (1991, S. 237) habe etwa „Teilhabe“ oder „Beisteuer“ (stiure) im Sinn, wenn er von Zuhörern spricht, die „gelernt hatten, daß sie selber Teil der Handlung waren und selber in die Erzählung hineingehen mußten, um zu Einsichten zu gelangen, die der Erzähler für sie bereit hielt“. Die von Bumke angemahnte Änderung bzw. Ergänzung der Forschungsmethoden für den Parzivalroman hatte in ähnlicher Form Weber bereits 1962 für die Tristanforschung erhoben, wenn er abschließend feststellt: „Sodann dürfte für die gegenwärtige Forschungslage charakteristisch sein, daß sich die Stimmen mehren, die eine verstärkte Betrachtung des ‘Tristan’ als Kunstwerk fordern [...]. Insgesamt harren hier m.E. noch manche fruchtbaren Aufgaben ihrer vollgültigen Lösung“ (Weber, 1962 , S. 73). Wie das zu geschehen habe, wird nicht gesagt; doch ist diese Forderung zu unterstreichen, nicht zuletzt deshalb, weil versucht wird, sie in der vorliegenden Arbeit annäherungsweise zu erfüllen.
Das hat wiederum damit zu tun, wie man sich selbst und die Welt als Wissenschaftler versteht. Kognitive und kreative Qualifikationen lassen sich ohnehin nicht scharf abgrenzen. Unabhängig von einem bestimmten Anspruchsniveau dieses Selbstverständnisses scheint die Personalunion beider Weisen des Welt- und Selbstverstehens bei jedem Menschen in gewisser Weise der Normalfall zu sein. Der Künstler Josef Beuys hat sich sinngemäß hierzu einmal so geäußert: Jeder Denkakt hat eine ästhetische Struktur und jeder ästhetische Akt eine Denkstruktur. Diese Aussage steht in Zusammenhang mit einem von ihm erneuerten und der Gegenwart angemessenen Kunstbegriff.
Anläßlich des 75. Geburtstages von Josef Beuys[8] würdigte der Theologe und Philosoph Friedhelm Mennekes in seinem Vortrag - gehalten am 12. Mai 1996 in der "Kunst-Station von St. Peter" zu Köln - Josef Beuys als einen Menschen, `dem wir nicht nur Impulse verdanken'. Beuys sei auch ein Denker, Theoretiker und Kunstphilosoph gewesen, `der Kunst theologisch zu bedenken (wußte)' [...] Der zentrale Punkt: Befragt nach seinem wichtigsten Beitrag zum Christusbild, antwortete er: `Der erweiterte Kunstbegriff. Ganz einfach."
Die übersteigerte Subjektivität eines die „andere Wirklichkeit“ schaffenden Künstlers, die allein dadurch den Charakter des Objektiven erreichen kann, daß sie sich in einer „verbindlichen", d.h. für alle geltenden Form „äußert", kann nicht auf Subjektivität des Rezipienten verzichten, sei er nun Zuschauer oder Zuhörer. Er braucht sie, um in der Begegnung mit Kunst- als der „anderen Welt des Ich"- sich selbst zu verstehen. Die Kunst ihrerseits bedarf der Subjektivität eines menschlichen Gegenpols, um als Form, d.h. vermittelnde Instanz überhaupt „etwas zu sein", um „wirklich zu sein“ im Sinne des Wortes.
In dem Bemühen, sich dem Text gegenüber nicht nur wissenschaftlich, „objektiv" zu verhalten, auf kritischer Distanz zu bestehen, sondern sich dem Kunstwerk in ihm mit gleichem Recht auch auf subjektivem Wege zu nähern, besteht keineswegs die Gefahr, „vereinnahmt" zu werden: Eine „Begegnung" mit Kunst - wenn sie denn eine ist - findet grundsätzlich nur auf „mittlerer Ebene", d.h. durch eine Form vermittelt statt. Im Namen „Parzival" selbst wird schon auf der Existenz einer solchen künstlerischen „Mitte" reflektiert:
„ir rôter munt sprach sunder twâl - deiswâr du heizest Parzivâl der name ist >Rehte enmitten durch<“ (140,15-17).
Wie würde Wolfram von Eschenbach auf die heimlichen oder veröffentlichten Vorwürfe der Kritiker des 20. Jahrhunderts reagieren, wenn z.B. behauptet wird, seine dichterischen Bilder seien dunkel, es gäbe keinen logischen Aufbau, manches sei unverständlich oder sogar verworren, logischer Unsinn etc.? - Aus seiner Reaktion auf die Attacken Gottfrieds ist zu schließen, daß er auch heute kaum anders als mit einer lakonischen Bemerkung wie z.B. in 1,15-16 („diz vliegende bîspel ist tumben liuten vil ze snel“ oder 2,13-14 (swer mit disen schanzen allen kann, an dem hât witze wol getân“) antwortete. Man könnte aus seiner Perspektive ergänzen: „Ebensowenig wie die Hl. Schrift für Theologen ist meine Dichtung für kritische Wissenschaftler konzipiert und niedergeschrieben worden. Beide sind von „berufswegen Ungläubige": Sie „halten sich selbst aus allem heraus“, gehen „auf Distanz“, wollen „stringente Argumente“ und „naturwissenschaftliche Beweise“ usw. Warum sollte ein Dichter ausgerechnet jenen das Geheimnis seines Textes offenbaren, die sich selbst nicht einbringen wollen oder können, sondern wissenschaftlich analysieren und sich methodisch „aneignen" möchten, was nur „gratis“ und ohne die Aggressivität eines diskursiven „Zugriffs“ zu haben ist. „Stringente Argumente" sind Fesseln, die ich mir nicht anlegen lasse. Mein Werk ist nur bei Entgegenkommen und der „Beisteuer“ (stiure) der Zuhörer „gratis" zu haben , ist eher für „Arme im Geiste" als für Schriftgelehrte konzipiert.
Die Hoffnung, der Dichter werde etwa seinen Text kommentieren oder interpretieren oder wenigstens die hypothetische Frage, „was er sich dabei gedacht habe,“ beantworten, würde mit Sicherheit enttäuscht. Er könnte diese Frage, selbst wenn er es wollte, gar nicht beantworten, denn, „als sich ihm das Gebilde seines Textes formte", wie Gadamer eindrucksvoll formuliert, hatte er sich nicht primär etwas dabei „gedacht", sondern war existentiell und gefühlsmäßig aktiv am Prozeß der Formfindung „beteiligt". Die Textstelle lautet: „Auch da gilt, daß man einen Dichter notwendig besser verstehen muß, als er sich selbst verstand, denn er `verstand sich’ gar nicht, als sich ihm das Gebilde eines Textes schuf" (Gadamer, 1990, S. 196). Weil der Dichter sich „gar nicht verstand“, gelingt es auch einem heutigen Zuhörer nicht, nur mit wissenschaftlichem „Sachverstand“, ihn besser zu verstehen. Im Gegenteil: Man muß z.B. zugeben, „daß es der Forschung, trotz intensivster Bemühungen, nicht gelungen ist, eindeutig zu klären, worauf Trevrizents Selbstbezichtigung eigentlich zielt“ (Bumke, 1991, S. 240). Das gilt nicht nur für die sogenannte „Lüge“ Trevrizents, die m.E. gar keine ist, sondern auch für ebenso viele andere Probleme mit dem Parzivaltext.
3.1 „naiv“ - „genialisch“ - „anders“ (2,16)
Wapnewski (1955, S. 9) sagt im Vorwort von sich selbst als Autor und Wolframforscher, er sei sich „immer bewußt gewesen, daß jeder Versuch einer Interpretation zur Bescheidung, zur Bescheidenheit verpflichtet: weil doch der deutende Betrachter nie das Ganze wird sehen, weil er immer nur ein Teil der Wahrheit wird packen oder tasten können." In dem Bemühen, den Dichter selbst nicht mit der „tumbheit" von Buchstabierübungen des eigenen subjektiven Verstehenwollens zu behelligen, gemäß der von Wapnewski mit Recht herausgegebenen Devise, in aller „Bescheidenheit" mit dem Text umzugehen, streift man ungewollt - weil es sich um einen klassischen Text handelt - ein seit etwa 150 Jahren diskutiertes zentrales Problem der Hermeneutik. Es ist gekennzeichnet durch die bekannte Formel Schleiermachers, „es gelte, einen Schriftsteller besser zu verstehen, als er sich selbst verstanden habe." Gadamer fährt fort: [...] „eine Formel, die seither immer wiederholt worden ist und in deren wechselnder Interpretation sich die gesamte Geschichte der neueren Hermeneutik abzeichnet" (Gadamer, 1990, S. 195). Die hier zitierte zweideutige Formel entstammt dem Genieverständnis des 19. Jahrhunderts. Einige Sentenzen dieses von Gadamer in seinem Werk „Wahrheit und Methode“ kritisierten Genieverständnisses mögen dies belegen:
1. „Wo nun Reden Kunst ist, ist es auch das Verstehen. Alle Rede und aller Text sind also grundsätzlich auf die Kunst des Verstehens, die Hermeneutik, verwiesen."
2. „Der genialen Produktion entspricht auf der Seite der Hermeneutik, daß es der Divination bedarf, des unmittelbaren Erratens, das letzten Endes eine Kongenialität voraussetzt."
3. „So kann er (Schleiermacher) sagen, daß die Individualität des Verfassers unmittelbar aufzufassen ist, indem man sich selbst gleichsam in den anderen verwandelt" (1990, S. 192).
Auch die Hoffnung, der Text könne „ unmittelbar" verstanden werden, wie es ein wenig auch in der Formulierung Wapnewskis anklingt, allein „den Text zu Wort kommen zu lassen", sollte man verabschieden. Die Vermutung, zur Interpretation eines solchen Verses bedürfe es einer gewissen Genialität des Deutungsvermögens jenseits von Vermittlungswegen der Kunst, ist irreführend. Selbst die Aussage Lachmanns, der Parzivalprolog sei „unübersetzbar", reflektiert, ob gewollt oder ungewollt, auf Unmittelbarkeit des Verstehens.
Wenn die Kunst der Deutung, der „Divination“, d.h. des „unmittelbaren Erratens“ bedarf, das letzten Endes Genialität voraussetzt, so ist die „Wahrnehmung" von Kunst letztlich an unerfüllbare und überzogene Bedingungen geknüpft, die mit der Wirklichkeit menschlicher Existenz und menschlicher Kunst „beileibe" - also bei der Unvollkommenheit leib-seelischen Geschehens - nichts zu tun haben: Kunst ist nicht etwas „Divinatorisches", „Seherisch - Göttliches", sondern im Gegenteil etwas zutiefst Menschliches. Gerade deshalb ist sie menschlich, weil es sich bei ihr um eine sinnlich erfahrbare, „außerordentliche" Form des Menschlichen-In-Der-Welt-Seins handelt. Wäre etwas „Divinatorisches“ an ihr, wäre sie unmenschlich und keine Kunst.
Der „Parzivalprolog“ ist kein historischer, sondern ein künstlerischer Text, nicht zuletzt auch ein programmatischer Eingang des ganzen Epos. In zahlreichen alten und neuen Übersetzungen ist bisher nur seine diskursive Seite berücksichtigt worden. Dieser Schein des Begrifflichen ist der von Wolfram bewußt benutzte Schleier, unter dem er im Text in der Regel ein dichterisches Bild als Rätsel verbirgt. Bezogen auf den Vorspruch (Eingang) des Prologs, der als Satz eine Sinneinheit ist, gilt es also, im Text nach Anzeichen von Sinnfälligkeit zu fahnden. Nicht Genialität, sondern Sensibilität ist m.E. gefordert.
In den sinnfälligen Formen der Kunst und Dichtung gibt es vielfache Anhaltspunkte, an denen ein sprach - und bildlogisch geübtes Denken und Fühlen Richtungen erkennen und Hinweise erhalten kann. Als Forscher müßte man sich eher auf Wirkungen (als Erkenntnisse) einstellen, die ein dichterisches Wort auslöst, und versuchen, diese als Begegnung zu verstehen, rational zu durchdringen und erst dann zu beschreiben in der Hoffnung, dadurch auch über das „Innenleben" des Textes etwas zu erfahren.
Wegen ihrer Affinität zu den historischen Wissenschaften beschäftigt sich philosophische Hermeneutik vorwiegend mit der Geschichte der Kunst. Kunstgeschichte und Kunst haben aber nur ganz am Rande miteinander zu tun; so wie das vergleichsweise auch für das Verhältnis von Literaturwissenschaft und Dichtung gilt. Deshalb kann man von ihr keine große Hilfe erwarten. Das Risiko des Verstehens liegt ganz auf der Seite desjenigen, der zu verstehen sucht. Was immer am Ende dieses Weges als „Ergebnis" herauskommen mag, kann man jedenfalls nicht dem Dichter, als etwas, „das er sagen wollte" oder sich „dabei gedacht haben mag", unterschieben.
3.2 Der Text als Rätsel - eine geheime Botschaft
Es gibt sicherlich guten Grund zu fragen, warum denn ein Text wie der Parzivalprolog sein Geheimnis nicht so leicht preisgibt: Ist es nicht denkbar, daß die Bedeutung dessen, was sich beim subjektiven Bemühen „enthüllen" sollte, von vornherein etwas Subtiles sein müßte, was auch sehr „intim“ gehandhabt werden muß? Weshalb sonst sollte eine solche Botschaft ein Geheimnis sein? Trotzdem hat jeder das Recht, einen dichterischen Text, dem er begegnet, unabhängig davon, ob der Dichter in seiner Zeit ähnlich empfunden haben könnte oder nicht, diesen Text so zu verstehen, wie er ihn selbst versteht. Sich um ein Rätsel oder Geheimnis zu bemühen, bedeutet immer auch, ein persönliches Risiko einzugehen. Im günstigsten Falle offenbart man dabei seine eigene Naivität. In der Kunst gibt es eine Art „Narrenfreiheit“. Sie garantierte einst am Hofe die Möglichkeit, ungestraft Wahrheiten zu sagen, was im Normalfall u.U. das Leben gekostet hätte. Daß eine Frage, das Risiko, ein Rätsel lösen zu wollen, lebensbedrohlich sein kann, ist aus vielen Märchen und Geschichten bekannt. - Die Gefahr sich dabei lächerlich zu machen, sollte kein Grund sein, einen Lösungsversuch nicht zu wagen. Es geht bei diesem „bickelspiel" um einen hohen Einsatz, „ums Ganze" wie Hempel (1951/52) meint, wenn auch nur im literarischen Sinn.
Selbstverständlich sollen dabei die Regeln der Sprachwissenschaft nicht außer kraft gesetzt werden, d.h. der Urtext soll nach wie vor gelten; aber nicht so, als ob er unvermittelt seinen Sinn erkennen ließe: Es gilt der Text in seiner Spannung zwischen geschriebenem Wort und akustischer Realisation. Man muß an dieser Stelle der Überlegungen nicht gleich all das reflektieren und referieren, was an Theorie über oral poetry und written composition gesagt worden ist.
3.3 Sind dichterische Bilder nur „anschaulich“?
Zum Kontext von Schrift und Sprache gehören die dichterischen Bilder mit einer gleichberechtigen bildnerischen Logik. Sie kommen in der Regel nicht durch bloßes Lesen ans Licht. Gelegentlich verbergen sie sich sogar unter der Hülle eines unscheinbaren Begriffes, wie z.B. im Parzivalprolog. Ihr Sinn wird, so paradox es klingt, manchmal erst dann „anschaulich“, wenn man einen Text akustisch realisiert. Nimmt man also die „Anschaulichkeit“ der dichterischen Bilder hörend wahr?
Wenn es hieße, der Eingangsvers „enthält" ein dichterisches Bild, so provoziert dies leicht die Vorstellung, dann hätte es doch eigentlich jedermann schon sehen müssen. Nun handelt es sich in diesem Fall um ein abstraktes, mystisches Bild. Weil es sozusagen mit „weißer Tinte“ als Geheimbild aufgezeichnet wurde, muß der Text erst einmal „entwickelt" werden. Die Botschaft kann nicht „jedermann im Vorbeigehen“ und ohne eigene Anstrengung erkennen. Man muß sich also auf den Text und das, was er an Wirkungen (in mir) hervorruft, in einem freien Spiel der Kräfte, auf das Abenteuer der Dechiffrierung einlassen. In dieser Begegnung verändert sich sowohl der Sinn des Textes als auch das Verstehen selbst im Sinne einer Verwandlung des begrifflichen in bildhaftes „Erkennen".
Ob das, was in dieser Metamorphose als mögliches Sinn-Bild herauskommt, etwas mit dem zu tun hat, was der Dichter sich eventuell „dabei gedacht haben könnte" oder was ihm als Konzept vorgeschwebt habe, ist eine Frage, die gar nicht beantwortet werden kann. Das Ergebnis eines solchen Gestaltwandels ist gleichermaßen das kreative Produkt subjektiver Phantasie, als auch mögliche Deutung eines dichterischen Textes. Eine Methodenlehre, wie man dabei mit dem Text und sich selbst umzugehen hat, gibt es nicht.
Weil ein Dichter, wie Gadamer sagt, in der Regel ein schlechter Interpret der eigenen Kunst ist, wird hier die Dichtung selbst zu einer von ihm abgelösten Instanz, und die Interpretation eine eigenverantwortliche Hervorbringung des Subjekts, das zu verstehen sucht. Wenn der Dichter immer im Grunde „mehr" zu sagen hat, als ihm selbst bewußt war, wie Schleiermacher meint, so könnte - theoretisch gesehen - eine heutige Sicht des Textes dem Dichter des 12. Jahrhunderts selbst als neu erscheinen. Insofern ist also auch die Möglichkeit gegeben, in den Text im Nachhinein etwas „hineinzudeuten“.
Es ist die ästhetische Struktur der Dichtung selbst, die sowohl dem „einfältigen" Gemüt als auch einem „raffinierten“ Verstehen den Zugang erschließen kann. Was hier als Möglichkeit subjektiven Verstehens gemeint ist, findet eine gewisse Stütze in der Wolframforschung selbst, die eine Art „objektiver Teilhabestruktur“ im Prolog identifiziert hat. Über die Hauptfigur der Dichtung sagt W. J. Schröder: „Er gehorcht nicht dem Wort (der Dichtung), er hat vielmehr teil an ihm. In solcher Teilhabe vollzieht er, wie es der Prolog aussagt, mit mannes muot den von Gott vorbedachten Schicksalsgang, der ihn durch Schuld zum Heil führt, wand an im sint beidiu teil, des himmels und der helle [...]. Wolfram, der seinen Helden unmittelbar unter das göttliche Wort stellt, in dem Raum und Zeit des Geschehens bereits substantiell enthalten sind, muß seinen Hörern na-hebringen, daß dieses Wort Wirklichkeit erzeugend ist. Daher denn die Gestalt des Parzival Wesenszüge trägt, die dieser Wirklichkeit angemessen sind: Das ‘Wort’ wird Fleisch" (W. J. Schröder, 1959, S. 325).
Dieses wirklichkeitserzeugende Moment einer Art „Inkarnation“ ist nun gerade im ersten und wichtigsten Doppelvers des Prologs zu erkennen. In der Tat wird in dem von W. J. Schröder angedeuteten Sinne in den Worten des Eingangsverses, die man nur „oberflächlich" relativ gut kennt, unter der hörbaren „Oberfläche des Textes“ jene Wirklichkeit „leibhaftig" erschaffen, auf die es Wolfram zum Zwecke des sinnfälligen, bildhaften „Erkennens" ankommt. Es ist faszinierend, wie der „zwîvel", als abstrakte philosophische und theologische Denkfigur, unter der Hand des Dichters - im Zusammenspiel mit den anderen Worten des ersten Doppelverses - in einer Metamorphose der Worte und ihrer Bedeutungen - zu einer leibhaftigen Gestalt wird: Zum Innbegriff des Helden, dem „herzen“ Parzivals. Es wird zur Sinnmitte des Eingangsverses. Dieser Vorgang kann durchaus als „imitatio" eines heilsgeschichtlich bedeutenden Vorgangs von „Inkarnation“ verstanden werden: auf sprach- und bildlogischer Ebene der Dichtung als die Ankündigung der „christlichen Existenz“ des Romanhelden schon im ersten programmatischen Vers des Romans.
Auf diese Weise entsteht schon im Einleitungsvers, der vordergründig abstrakten Bedeutung unterlegt, ein „surrealistisches“, mystisches Bild menschlicher Existenz von Leben und tödlicher Bedrohung. Wie in den Worten W. J. Schröders (1959, S. 325) anklingt und sich nicht von der Hand weisen läßt, reflektiert Wolfram mit seinem Prolog auf den anderen „vorbildhaften" Prolog, in dem vom Herabsteigen eines „Wortes", des Logos, in die Niedrigkeit des „Fleisches" die Rede ist. Ist nicht der „Eingang“, d.h. der erste progammatische Doppelvers des Prologs vielleicht eine bildhafte Spiegelung des Johannesprologs als dichterische „Analogie“ auf heilsgeschichtlichem Hintergrund?
Nach den Berichten der Genesis ereignete sich die erste Menschwerdung, als der Schöpfer- bzw. „Töpfergott" Adam, „dem Mann aus Erde“ seinen Odem einhauchte, ihm also eigenes göttliches Leben schenkte. Aus dieser ersten Inkarnation erklärt sich die große Wertschätzung der Leiblichkeit bei Wolfram. Sie beeinflußt entscheidend auch seine Vorstellung von den „heiden“ und von der Auserwähltheit aufgrund des „Geblüts“; gemeint ist damit die erste „Menschwerdung“ göttlichen Geistes im Medium der Leiblichkeit. In Wolframs Parzivalroman wird dieser Schöpfungsvorgang zu einer jungfräulichen Geburt: Eine erste jungfräuliche Geburt der „materia", der Mutter Erde in Analogie und im Unterschied zur Geburt Jesu Christi aus der Jungfrau Maria. Parzival erfährt dies in seinem Gespräch bei Trevrizent. In diesen beiden Fällen ist zwar von Inkarnation in einem ganz bestimmten, nämlich ausschließlich heilsgeschichtlichen Sinne die Rede. Warum aber sollte die „Erschaffung" einer exemplarischen christlichen Existenz, wie die des Romanhelden Parzival - auf geschichtlich-dichterischer Ebene - nicht eine der Genesis oder dem Johannesprolog analoge Struktur haben? Die Zeichen des Eingangsverses weisen jedenfalls schon auf den Helden und seine Erschaffung im Medium eines dichterischen Wortes hin. In diesem Sinne, der auch die Meinung Hempels wiedergibt, geht es schon „im Vorspruch [...] vorblickend (um) die Summe von Parzivals ganzer Existenz" (Hempel, 1951/52, S. 162). An diesem Punkt der Überlegungen angelangt, stellt sich die Frage: In welcher Form hat der Dichter das, was hier angedeutet wird, in seiner Dichtung verwirklicht? Wie sieht das erste dichterische Bild des Parzivalromans aus?
Es geht im Grunde nur darum herauszufinden, was am ersten „abstrakten“ Verspaar des Prologs als die „ganz andere Form seines Sinnes“, nämlich als ein dichterisches Bild „inkarniert“, und in welcher Weise diese poetische Vereinigung von Text und Bild eine Sinnerweiterung für das „Ganze“ ist. Die zahlreich vorliegenden, eher begrifflichen Übersetzungen, werden damit nicht etwa kritisiert oder eliminiert, also keineswegs als überflüssig empfunden. Sie sollen eher aus einer künstlerischen Perspektive „ergänzt“ werden.
4. Der Eingangsvers des Prologs - ein Rätsel
„Der Prolog gehört zu den schwierigsten und dunkelsten Textpartien der Dichtung,“ stellt auch Bumke (wie Rupp s.S. 66) ausdrücklich fest (1991, S. 47) Seine Übersetzung des Eingangs lautet: „Wenn der Zweifel dicht beim Herzen wohnt, so wird das für die Seele bitter.“ Es fällt schwer, dies nur als eine „Sentenz“, d.h. einen treffend geprägten dichterischen Sinnspruch zu akzeptieren. Nach übereinstimmender Meinung führender Wolframforscher ist „zwîvel" ein Kernbegriff des Prologs und zugleich eines der wichtigsten und umstrittensten Wörter des ganzen Parzivalromans; kurzum ein „bickelwort", wie ich meine. Es taucht im ersten Doppelvers des Prologs auf und hat nach den Regeln der Dichtkunst in dieser Position eine außergewöhnliche und progammatische Bedeutung.
"ist zwîvel herzen nâchgebûr, daz muoz der seele werden sur" (1,1-2).
Die von allen konstatierte Bedeutsamkeit von „zwîvel" steht jedoch im Widerspruch zu der Unsicherheit, mit der es übersetzt wird. Hier nur einige Beispiele, deren Reihe man beliebig verlängern könnte:
1. „Wenn der Zweifel sich dem Herzen benachbart, so muß das für die Seele bitter werden" (Friedrich Knorr und Reinhard Fink 1940);
2. „Ist Unentschiedenheit dem Herzen nah, so muß der Seele Bitternis daraus erwachsen" (Wolfgang Spiewok, 1981);
3. „Lebt das Herz mit der Verzweiflung, so wird es höllisch für die Seele" (Kühn, 1991);
4. „Wenn der zwîvel Nachbar des Herzens ist, dann muß das der Seele große Schwierigkeiten bereiten“ (Rupp, 1961);
„Der Gesamteindruck der bisherigen Wolframübersetzungen" stellt Ulrich Pretzel (1954, H. 5, S. 47) fest, „ist ein recht unbefriedigender“. In der unter Punkt 3 vorgestellten Version, bei der zwar ein ebenso schwergewichtiges, rätselhaftes Wort wie „nâchgebûr" ganz verschwunden ist, spürt man - vielleicht liegt das aber auch nur an der Versform - etwas von einer ursprünglichen Lebendigkeit, allerdings auf Kosten der nicht zu vertretenden Eliminierung des Wortes „nâchgebûr". Auch das Wort „zwivel“ wurde von der Tendenz der Abschwächung und Verfremdung des Textes nicht verschont. Walter Haug (1992, S. 159) bringt dafür ein Beispiel: „[..] man hat vielfach für zwivel in Vers 1,1 eine abschwächende Deutung vorgezogen und folgendermaßen übersetzt: ‘Wer unbeständig ist, der bringt seine Seele in Gefahr’, so mit der Rücksicht auf die Figur Parzivals, auf die man diese Einleitungsverse glaubte beziehen zu dürfen“. Für ihn und andere bekannte Forscher (u.a. Bumke) handelt es sich beim Eingang (1,1-2) des Prologs um „einen Satz von allgemeiner Verbindlichkeit“ (1992 S. 159), d.h. eine Sentenz. Bei den andern zitierten Übersetzungsbeispielen kommt ebenfalls das unbefriedigende Gefühl von Ungenauigkeit und Mißdeutung auf. Was muß ein Leser bei solchen Übersetzungen gutwillig alles an Philosophie und Theologie dazudenken, um die meisten Übersetzungen des ersten Doppelverses nicht nur sinnvoll, sondern darüber hinaus auch noch als Ausdruck der „Blüte mittelalterlicher Dichtung" zu empfinden? Die gewiß angebrachte Pietät gegenüber der großartigsten mittelhochdeutschen Dichtung sollte nicht so weit gehen, daß man, was als Übersetzung nicht ganz überzeugen kann, dennoch als solche gelten läßt, weil der geschriebene Text es angeblich so sagt.
Wer den Text im Originalton hört, spürt eine Lebendigkeit, deren Ursache ihm weitgehend verborgen bleibt. In Übersetzungen bleibt von solcher Vitalität nicht viel übrig. - Nun ist diese Feststellung wohl keine neue Erkenntnis. Sie entspricht der übereinstimmenden Meinung zahlreicher Wolfram-Forscher, die mit bisherigen Übersetzungsversuchen des Parzivalprologs keineswegs zufrieden sind. Lachmann spricht bereits vor 150 Jahren von der Unübersetzbarkeit des Textes, und zeitgenössische Forscher äußern sich heute noch ähnlich. Mit einem auch in der Forschung verbreiteten Unbehagen sollte man sich dennoch nicht zufrieden geben. „Nichtübersetzbarkeit" kann es theoretisch eigentlich nicht geben.
Mit Bezug auf vorliegende, von der Wissenschaft anerkannte Übersetzungen, die auch immer Interpretationen sind, darf man z.B. fragen: Was soll es überhaupt heißen, daß jemand sagt: „Wenn der Zweifel sich dem Herzen benachbart", dann ...; oder „Wenn der „ zwîvel" Nachbar des Herzens ist, dann muß das der Seele große Schwierigkeiten bereiten"? In der alltäglichen Kommunikation sind solche Aussagen ganz und gar unverständlich. Warum sollen sie in dieser Form als Übersetzung einer Dichtung verständlich sein?
Wahrscheinlich würde man einem Abiturienten, der solche oder ähnliche Redewendungen im Aufsatz gebraucht, diese mit Recht als Ausdrucksfehler ankreiden, denn es handelt sich um eine wirklichkeitsferne, blutleere und unverständliche Sprache. Als Meinung des Textes - das ist sie ja auch in Gestalt einer Übersetzung - kann man sie so nicht gelten lassen und dem Dichter des Parzival anlasten.
Wenn man einerseits sagt, der zwîvel im Prolog sei aus dem Text heraus nicht voll zu deuten, nutzt es wenig, „den Text zu Wort kommen zu lassen", wie Wapnewski (1955, Vorwort) das zur „Maxime" erklärt. Um ihn besser zu verstehen, macht Rupp für einen neuen Interpretationsversuch in der Tat einen recht unkonventionellen und interessanten Vorschlag: Man solle sich dem Text gegenüber „naiv" verhalten. Diese Idee ist gar nicht so „naiv“, wie sie auf den ersten Blick scheint.
Der Gedanke sollte am „naiv zu verstehenden“ Übersetzungsvorschlag des Autors Rupp auf seine Brauchbarkeit geprüft werden, ehe seine „Methode" hier mit einer moderaten Veränderung übernommen wird. Eine literarisch-künstlerische Interpretation erfordert nämlich eine ähnlich „naive“ Unvoreingenommenheit, wie sie von ihm empfohlen wird. Sie darf allerdings nicht mit naturwüchsiger „Naivität" verwechselt werden, obgleich das vordergründig so erscheinen könnte.
Rupp fragt: „Ist dieser Text wirklich widerspruchsvoll, oder ist er nicht bei genauem Zuhören und Hinhören und zwar bei naivem - nicht durch Theologie, Philosophie und Gottfriedpolemik vorbelastetem - Hinhören als sinnvoller Parzivalprolog verständlich, so wie er für einen mittelalterlichen Hörer verständlich sein mußte [...]" (Rupp, 1961, S. 31) - Sein Vorschlag lautet so:
„Wenn der zwîvel Nachbar des Herzens ist, dann muß das der Seele große Schwierigkeiten bereiten." (Rupp, 1961, S. 33)
Hier merkt man aber von der empfohlenen Naivität beim Textverstehen recht wenig. „Naiv" heißt nach Rupps o.a. Definition: „Beiseitelassen von Theologie; Philosophie und Gottfriedpolemik". Einmal unterstellt, man könnte Theologie, Philosophie und Literaturkritik einfach weglassen, was bedeutet dann noch der Satz: „Wenn der zwîvel Nachbar des Herzens ist, dann muß das der Seele große Schwierigkeiten bereiten?"
Kühn übersetzt: „Lebt das Herz mit der Verzweiflung, so wird es höllisch für die Seele“ (1991, S. 429). Das ist sicherlich eine gelungene und elegante Übertragung in die Sprache des 20. Jahrhunderts. Nachdenklich stimmt nur, daß sich darin keine Spur des im Originaltext doch bedeutsam klingenden „nâchgebûr“ wiedererkennen läßt. Vergleichbare Deutungsversuche sind aus folgenden Gründen nicht ganz befriedigend:
1. Aus dem Wort „zwîvel", das im 12. Jahrhundert aufgrund seiner Wortgeschichte auch noch adjektivisch (Lexer: zwîvel adj. ungewiß, zweifelhaft) empfunden werden konnte, wird in den meisten Übersetzungen ein Substantiv mit dem Anspruch, sinnbestimmend für den ganzen Eingangsvers zu sein.
2. Aus dem Gegengewicht zu „zwîvel" im ersten Vers, nämlich dem schwergewichtigen Wort „nâchgebûr" wird - obwohl als Substantiv nicht zu übersehen und zu überhören - zunächst ein Adjektiv („benachbart“), dann eine bloße Ortsbestimmung („nahe“) mit der Tendenz, sich ganz zu verflüchtigen (siehe oben).
3. Das Wort „herzen", das ja nicht ohne Grund in der Mitte des 1. Verses steht, weil es Zeichen für die Sinnmitte des Lebens und der Tugenden ist, u.a. durch sich selbst repräsentiert, wird ohne jede Begründung aus dem Zentrum „beiseite" geschoben, als ob es in erster Linie um einen „ zwîvel“, um Verzweiflung und Bitternis ginge. Das ist eine unzulässige Schwerpunktverschiebung innerhalb des Textes.
4. Weil der Sinn des ersten Verses durch den relativ „freizügigen Umgang“ mit dem Text „geschrumpft" ist, lohnt es sich nicht mehr, mit dem ersten Wort der zweiten Verszeile - nämlich „daz" - die Summe der Aussagen der ersten Zeile zu ziehen. Nach einem abstrahierenden Zugriff auf den ersten Vers bleibt einfach zu wenig übrig. Das Anfangswort „daz“ des zweiten Verses wird dadurch belanglos; verliert sein Gewicht gegenüber „sur“ und bringt den Vers aus dem Gleichgewicht.
5. Weil der Zusammenhang der Bilder und Begriffe im ersten Verspaar durch den o.a. Umgang mit dem Text grundlegend gestört ist, hinkt jede noch so gute begriffliche Übersetzung: Wenn nämlich der „Hintergrund-Sinn“ des Eingangs weder erkannt noch „berücksichtigt“ wird, hängen alle folgenden dichterischen Bilder in der Luft; z.B. das wichtige Wort „nâchgebûr“ im ersten Vers. Hempel gibt dafür folgende Erklärung: „Für Wolfram ist sûr gewissermaßen ein Charakterwort für die Hölle. Ersichtlich hat es als führendes Reimwort des Verspaares dem Dichter zuerst festgestanden und das auffällige nâchgebûr als Reimpartner erst herbeigezogen .“ (Hempel, 1951/52., S. 168) Man muß ihm zustimmen, daß Vers 2 „daz muoz der sele werden sur“, nicht einfach bedeutet ‘das schafft der Seele Bitternis’, sondern aufs ganze geht und die ewigen Qualen der Verdammnis meint.“ (So auch Lachmann, gemäß Fußnote Hempels auf derselben Seite). Der zweite Vers steht m.E. jedoch zum ersten wie die Wirkung zur Ursache. Deshalb glaube ich auch, daß „sur“ eher der herbeigezogene Reimpartner des viel auffälligeren „nâchgebûr“ ist. Dieses Wort ist zu schwergewichtig, als daß man es lediglich als „Reimpartner“ eines anderen ansehen kann. Es ist ebenso geheimnisvoll wie zwîvel, was immer es bedeuten mag.
Zugegeben wird, daß dies eine aus künstlerisch-gefühlsmäßiger Perspektive vorgetragene Kritik ist, formal durchaus ernst gemeint, selbst wenn bisher nur „künstlerische Naivität" in Anspruch genommen wurde. Mit dem, was eher als ungutes Gefühl denn als wissenschaftliche Kritik bezeichnet wird, soll eigentlich nur so viel gesagt werden:
1. Es kann nicht sein, daß der Dichter eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur sich erlaubte, an seiner wichtigsten Stelle „Fehler“ zu machen, so daß man ihn „im Ausdruck" zu korrigieren hätte.
2. Mit welchem Recht kann man ein schon vom Klang her so gewichtiges Wort wie „nâchgebûr" ohne Substanzverlust einfach aus dem „Eingang“ des Prologs verschwinden lassen oder durch schwächliche Vokabeln wie „nah" oder „benachbart" ersetzen?
Wie bereits mehrfach gesagt, sind Übersetzungen immer auch Interpretationen. Der alte Text spiegelt sich darin im Verständigungshorizont einer bestimmten geschichtlichen Zeitepoche wieder. Deutungen können deshalb nicht mit dem Anspruch antreten, für alle Zeit gültig zu sein. Man muß sie daher nicht unbedingt akzeptieren oder sich mit ihnen zufrieden geben. Meine Kritik an der einseitigen Begrifflichkeit mancher Übersetzung mit subjektiver Empfindlichkeit zu rechtfertigen, wäre allerdings dürftig. Deshalb möchte ich versuchen, im folgenden Abschnitt die bildlogischen Zusammenhänge von Wort und Bild aus künstlerischer Sicht zu explizieren, ohne damit Stringenz im Sinne wissenschaftlicher Methodik beanspruchen zu wollen.
4.1 Vorbemerkungen zur spezifisch literarischen „Naivität"
Viele Wissenschaftler - ob bewußt oder unbewußt - gehen primär „optisch“ mit dem Text um: Was geschrieben steht, soll gelten! Insofern verhalten sie sich wie Historiker. Dem geschriebenen wird im Verhältnis zum gesprochenen Wort fast regelmäßig eine größere Glaubwürdigkeit, Echtheit und Ursprünglichkeit und damit einhergehend eine größere Bedeutung beigemessen. Das mag für die Geisteswissenschaften gelten. Das pure schriftliche Vorhandensein und damit die Lesbarkeit eines Textes hat keine „Bedeutung“ im Sinne von „Deutung“ eines dichterischen Textes, auch dann nicht, wenn er Hunderte von Jahren alt ist. Das wäre etwa so, als ob man sich in der Musik und ihrer Interpretation vorwiegend mit dem Notenbild eines Werkes von Bach oder Händel begnügen wollte.
Dichtung ist aber auch keine Offenbarung im heilsgeschichtlichen Sinne, so daß von daher das „sola scriptura" der Lutherzeit gerechtfertigt wäre. Sie ist zwar auch eine „Offenbarung“ besonderer Art, hat aber hinsichtlich ihres Wahrheitsanspruchs keineswegs denselben Status wie das „Buch der Bücher“ als Offenbarungsliteratur. Weil sie als Kunst „innerweltliche geschichtliche Wahrheit“ und damit selbst eine besondere, künstlerische Wirklichkeit ist, hat sie auch nichts Divinatorisches oder Übermenschliches an sich. Diese relative Wahrheit bzw. Wirklichkeit erscheint nur im Medium sui generis als Dichtung im gesprochenen Wort.
In der folgenden Interpretation geht es um das Spannungsverhältnis von gesprochenem und geschriebenem Wort. In der Regel wird unterstellt, das geschriebene und gelesene Wort habe größere Affinität zum begrifflichen Denken, das gesprochene Wort stehe eher dem anschaulichen, literarisch-künstlerischen Wahrnehmen nahe. Dieses Verhältnis ist ausdrücklich Gegenstand der folgenden Überlegungen, die zu einer veränderten Sichtweise des Textes bzw. Kontextes von Sprache und Bild im Parzivalprolog führen sollen.
Wenn man anhand des Grimmschen Wörterbuches in die Wortgeschichte von „Zweifel" zurückgeht, erfährt man, daß es im 12. Jahrhundert einen modernen Zweifel-Begriff vermutlich noch nicht gegeben hat. Es wird gesagt: „ Zweifel, adj. bis zum frühen 16. Jahrhundert belegt, ist dann von „zweifelhaft völlig verdrängt worden". Weiterhin heißt es: „ das adjektiv zweifel ist wahrscheinlich älter als das substantiv und bezeichnet die eigenschaft `einem gespaltenen, zweigeteilten sinn habend`, vergl. den gebrauch im Heliand, wo das substantiv fehlt, und die grundbedeutung von ai duaya `zwei arten habend`" [9] angegeben ist.
Schon aufgrund einer solchen Wortgeschichte sind Übersetzungen, die das Verstehen von „zwîvel" einseitig als Diskurs über die Verzweiflung (aus der Perspektive des „Gregorius“) nahelegen, nicht zu vertreten. Die wortgeschichtliche Bedeutung des „zwîvel" kann möglicherweise helfen, ein dichterisches Bild, dem diese Wortbedeutung zugrunde liegt, besser zu erkennen und dadurch den Sinn im Kontext des Eingangsverses ans Tageslicht bringen.
Von der Wortgeschichte her kann man „zwîvel" nicht nur negativ eingrenzen, wie es in der Übersetzung durch den Begriff „Zweifel" geschieht. „Zwei arten habend" heißt logischerweise etwas „Unterscheidendes, Verschiedenes, also Zweierlei habend": Wenn nun schon die eine „art" negativ besetzt ist, wäre logischerweise die andere - weil verschieden - das Gegenteil davon, als etwas Positives zu verstehen.
Die gefühlsmäßige Anmutung zu „zwei" liegt - von der Etymologie aus gesehen - näher als die begriffliche zu „Ver-zwei-fel-ung", d.h. wenn man die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ernst nimmt. Es gibt keinen erkenntlichen Grund, dies nicht zu tun. Damit ist es möglich, sich dem ersten Doppelvers des Parzivalromans auch anders, als nur negativ und begrifflich, zu nähern.
So viel ist vorab schon zu sagen, daß der „zwîvel" bei Wolfram, von der Wortgeschichte her gesehen, eher einen ontologischen („einen gespaltenen Sinn habend") als einen metaphysischen (z.B. an der Güte Gottes verzweifelnd) Sinn hat. Er hat vermutlich mehr mit der Seinsverfassung des Menschen in dieser Welt, als mit jenseitsgerichteter Verzweiflung, die „in die ewige Verdammnis“ führt, zu tun. Eine solche Verfassung, die durch eine relative, geschöpfliche Freiheit gekennzeichnet ist, schließt aber auch die Möglichkeit und das Risiko ein, sich für oder gegen das Gute schlechthin zu entscheiden. Die Situation im Hinblick auf den „zwîvel" in der Gregoriuslegende ist eine völlig andere. Fest steht jedenfalls, daß man den elementaren eigentlichen Sinn des einleitenden und wichtigsten Satzes des Parzival bisher nicht erraten hat.
Warum sollte man also unter diesen Umständen nicht wenigstens versuchen, auf einem anderen als einseitig philologischen, wissenschaftlich orientierten Weg zum Ziel zu kommen, selbst wenn dazu ein Umweg über naiv künstlerisches Verstehen bildlogischer Zusammenhänge erforderlich ist?
Es ist - um das hier ausdrücklich noch einmal zu wiederholen - nicht beabsichtigt, mit der überpointiert vorgetragenen Kritik an den vorliegenden Übersetzungen des Textes, frühere generell überflüssig zu machen. Absicht war vielmehr, die Aufmerksamkeit auf einen bisher noch wenig oder gar nicht beachteten, immerhin möglichen anderen Aspekt zu lenken, der eine „ergänzende" Funktion für das Verstehen haben könnte im Sinne eines Zusammenspiels von Wort und Bild im „zwîvel“ selbst und im Kontext des ersten Doppelverses insgesamt.
4.2 Das Elsterngleichnis und der bildlogische Hintergrund von „zwîvel“
Bei den bisher vorliegenden Versuchen war das Wort „zwîvel“ nicht als dichterisches Bild angesehen worden. Das beherrschende Bild des Eingangs war immer schon das Elsterngleichnis. Man spürt zwar, daß es in einem bestimmten Verhältnis zum „zwîvel" steht und damit etwas zu tun hat, bemerkt aber auch, daß es eine Rolle übernimmt, die ihm im Verhältnis zum Gewicht des „zwîvel" vielleicht doch nicht zukommen kann. Meines Erachtens kann „zwîvel" - in seiner begrifflich abstrakten Bedeutung - zwar Kennwort des Prologs sein, aber nicht seine Sinnmitte. Unabhängig davon, ob nun das Elsterngleichnis in der Hierarchie dem „zwîvel" über- oder untergeordnet ist, möchte ich bei der bildnerischen bzw. bildlogischen Analyse zunächst mit diesem Bild beginnen, weil es den „zwîvel" erhellen könnte. Was man sprachlogisch „nicht auf die Reihe kriegt“, was sich nicht „reimt“, kann bildlogisch betrachtet durchaus „folgerichtig“ und sinnvoll sein.
Wenn man dem ersten Eindruck vertraut und glaubt, mit dem „anschaulichen“ Bild der Elster schon etwas Sicheres, Sinnliches, Konkretes in Händen zu halten, so befindet man sich bereits auf der falschen „verte": Die naheliegende Assoziation, daß es sich bei der Elster um einen schwarz-weißen Vogel handelt, taucht zwar automatisch auf, ist aber, was die damit verbundene Vorstellung von „Farbigkeit“ angeht, für das elementare Verständnis dieses Bildes und – damit zusammenhängend - der beiden ersten Verse des Prologs nicht nur belanglos, sondern sogar irreführend.
Wenn W.J. Schröder sagt: „Das Einprägsamste ist das Elsternbild, und gerade dies führt in die Irre", so hat er im Grunde genommen recht. Er fährt fort: „Fragen wir nach dem, was der Hörer verstanden haben muß, und bringen das in eine begriffliche Form, so ergeben sich folgende drei Sätze: 1. der gute Wille ist schwarz und weiß; 2. der böse Wille ist schwarz; 3. der gute Wille ist weiß".
Von einem Gegensatzpaar „schwarz und weiß" im Zusammenhang mit dem Aussehen der Elster ist im Text überhaupt nicht die Rede ! Der Vers lautet: „als agelstern varwe tuot" (1,6). Für die o.a. Deutung wurde gewissermaßen die „Farbe“ schwarz vom „unstaeten gesellen“ (1,10-13), der „in die Finsternis fährt“, entliehen und auf die Elster projiziert. Eine Elster kann aber weder in den Himmel noch zur Hölle fahren, also kann auch ihr schwarz-weißes Aussehen in diesem Zusammenhang nicht gemeint sein.
Wer nur auf Farben achtet - wobei ausdrücklich gesagt werden muß, daß im sachlichen und künstlerischen Sinne schwarz und weiß keine „Farben“ sind, und man sich einig ist, daß hier nicht etwa von schwarz und weiß als Maler- oder Anstrichfarben die Rede ist - bemerkt nicht, daß es im Elsterngleichnis nicht darauf ankommt, was man als Ergebnis sieht, sondern was ursächlich geschieht. In diesem Bilde ist jemand in Aktion: die Elster „ tuot" etwas. Es geht damit um eine Handlung, die man nicht primär evidenz- sondern handlungslogisch betrachten sollte. Die hier zu stellende Frage muß also lauten: Was bedeutet die Handlung des Raben- und Raubvogel s Elster? Nicht zuletzt als solche ist sie das tertium comparationis zu den vorhergehenden Versen.
Die Gefahr des o.a. Mißverständnisses besteht darin, daß man, wenn von „varwe“ die Rede ist, und dann auch noch der Name „Elster“ auftaucht, spontan „schwarz und weiß“ assoziiert, und darüber hinaus, einem naheliegenden und historisch überlieferten Interpretationsmuster (des vierfachen Schriftsinnes) folgend, sogleich die Kategorien „gut und böse" hinzudenkt. Genau das ist für ein Verständnis des Textzusammenhanges ein erster bildlogischer, „allegorischer Kurzschluß“, den W. J. Schröder dezidiert ausspricht: „Durch die Beziehung auf die Farben macht er (Wolfram) alle Klarheit wieder zunichte [...]. So wird [...] der Inhalt zum Rätsel. Das Einprägsamste ist das Elsternbild, und gerade dieses führt in die Irre. [...] Der logische Unsinn entsteht durch das Elsterngleichnis, [...]“ (W. J. Schröder, 1951/52, S. 133). Wolfram meint im Bild der Elster m.E. etwas Elementareres und viel Weiterreichendes:
Die Polarität, auf die er abzielt, ist nicht „oberflächlich" und allegorisch gedeutet als Gegensatz von „schwarz und weiß“ bzw. „böse und gut“ zu verstehen, sondern ist von existentieller Bedeutung. Das Elsterngleichnis ist gerade nicht „anschaulich“ im üblichen Sinn. Mitdenken ist erforderlich, wenn man der „Sprache Tun“ (Bernhard Casper, 1990, S. 31) in diesem Bild verstehen will. Als Gleichnis ist es auch kein „Standbild“, sondern ein dynamisches Geschehen, dessen Bewegung man in der eigenen Phantasie nachvollziehen muß, um zu erkennen. In erster Linie sollte daher die Handlung „angeschaut“ und gefragt werden, was sie bedeutet. Die Antwort darauf schließt ein, was eine äußere Erscheinung mit diesem Handeln ursächlich zu tun hat.
Der Behauptung, eine solche Deutung sei grammatisch nicht möglich, kann man entgegenhalten, daß die traditionelle allegorische Interpretation, bei der „varwe“ das Subjekt des Verses ist, logisch ebenfalls unmöglich ist. Abgesehen davon, daß es unvorstellbar ist, daß die Farbe als Sache realiter handeln bzw. „etwas tun“ kann, wäre ein Verständnis von „varwe tuot“ (1,6) im Sinne von „die Farbe färbt“ (die Elster) nicht logisch, sondern „tauto-logisch“, m.a.W. ein Zirkelschluß. Stilistisch gesehen wäre das im vorliegenden Fall eine unnötige Wiederholung desselben Sachverhalts durch zwei Ausdrücke. - Nicht ganz ohne Grund sagt W.J. Schröder: „Der logische Unsinn entsteht durch das Elsterngleichnis...“ (1951/52 S. 133). Weil also Logik und Grammatik im Widerspruch zu stehen scheinen, wurde die hier entscheidende Frage, wer oder was Subjekt des Elsterngleichnisses (1,6) sein könne, in Kapitel Nr. 7 nochmals aufgegriffen und untersucht (s.S. 168 ff.). Sollte tatsächlich die „varwe“ Subjekt sein, müßte man wohl eher von einem Farbengleichnis sprechen!
4.3 Was „tuot“ die Elster der „varwe“ an? Eine existentielle Deutung des Elsterngleichnisses
Genau darauf gibt der Text eine bildhafte Antwort: Sie „tuot", d.h. verfährt nach „eigenem Gusto“ mit der Farbe. Sie bedient sich ihrer willkürlich, räuberisch, als „diebische Elster“ alles stehlend, was „blank“ ist. Sie „wählt aus“ nach dem Prinzip von „Alles oder Nichts": Weiß bedeutet nicht in einem allegorischen Sinn „gut", sondern ist im lebensweltlichen und realen Sinn: Anwesenheit aller Farben ! Im existentiellen Sinn heißt das: „Alles“. - „Schwarz“ gewählt heißt primär nicht „böse“, sondern ist die Abwesenheit aller Farben. Schwarz bedeutet dann nicht nur „Nichts“, sondern „ ist “ ein Nichts an Farbigkeit. Wolfram hat hier den existentiellen Unterschied von bloß etwas „ bedeuten “ und etwas „ sein“ im Auge. - In dieser Weise verfährt also die Elster mit der Farbe an ihrem „vel". Das zweifarbige („zwî-vel“) „Fell“ der Elster ist gleichzeitig eine ironisch-kritische Anmerkung zum schwarz-weißen Doppelfell eines anderen Wundertieres - nämlich Enites Pferd im Erecroman - und dem „zwîvel“ als pseudoreligiösem Problem des „Gregorius“.
Das „zweifelhafte“Tun der Elster ist an ihrem Federkleid nur indirekt erkennbar; nicht einfach ablesbar. Ihr Gefieder, ihr „Doppel-Fell", ist die polare Einheit von „Alles und Nichts". Infolgedessen erscheint dieser Widerspruch auf ihrer Haut als Gegensatz von schwarz und weiß. In ihrer äußeren Erscheinung ist die Elster also das Produkt ihrer eigenen, willentlich „zwei-fell-haften“ Handlung, ihr Gefieder also eher „oberflächliche“ Erscheinung, nicht „Ursache“. Ihr schwarzweißes Aussehen ist also akzidentiell, wie auch das menschliche Gut- und Böse- Sein in der Welt in bezug auf das „prinzipiell" Böse oder Gute akzidentiell, also eine Folgewirkung zu sein scheint. Wolfram reflektiert auf den Unterschied dieser beiden Ebenen, hat aber in dieser quasi hierarchischen Zuordnung beide im Blick.
Wenn man die Syntax des Satzes „als agelstern varwe tuot" untersucht, stellt man fest, daß die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt innerhalb dieses Satzes nicht eindeutig festgelegt zu sein scheint. Unter Umständen kann man das Subjekt „Elster" mit dem Objekt „Farbe" vertauschen, so daß „varwe" zum Subjekt würde mit dem Effekt, daß nun der Elster nach dem Prinzip von „Alles oder Nichts" von der „varwe" her etwas geschieht. Die „varwe" wäre nun diejenige, die „tuot" bzw. der Elster etwas „antut". Diese Vertauschung wäre möglich, weil „varwe“ im Akkusativ und Nominativ gleichlautet. Die Satzstellung von „varwe “ (hinter „agelstern“) spricht eindeutig dagegen. Dennoch gehen alle bisherigen Deutungen theoretisch davon aus, daß „varwe“ Subjekt des Verses 1,6 ist.
Ein mögliches Changieren von Subjekt und Objekt im selben Satz würde bedeuten, daß die Elster nicht nur selbstverantwortlich bzw. unverantwortlich handelt, „tuot", wie der Dichter sagt, sondern, daß andererseits auch an ihr etwas geschieht, d.h. schicksalhaft über sie verfügt wird und zwar nach demselben Prinzip des „Alles oder Nichts“. Das „Nichts" heißt auf mittelhochdeutsch „tiuvel". Dasselbe Wort „tiuvel", heißt aber auch „Teufel" (Lexer, 1992). Es ist erstaunlich, was im „vel“ (der Elster oder des zwî-vel) nicht alles an Bedeutungen „verhüllt“ und unverhüllt mitschwingt. Das Wort „vel“, als Bestandteil von „zwîvel“, ist nicht zuletzt auch die gebräuchliche Abkürzung für „velum“, lat., Hülle, Vorhang, Schleier. Sind mit dem Wort „zwî-vel“ etwa auch „zwei Hüllen“ bzw. Schleier gemeint oder zumindest „mitgemeint“?
Der Gegenpol zu diesem „Nichts" ist das „Alles", das Totum, das Ganze, das Gute: „Alles Gute " oder das Höchste Gut (summum bonum). Über die Silbe „vel" im Wort „tiu-vel“ wird assoziativ die Brücke zum „vel" der Elster, wie auch zur identischen Silbe „vel" in „zwî-vel" geschlagen. Weil „vel" aber neben „Haut" (Lexer, 1992) außerdem noch „pergamint" bedeutet, ist auf diese Weise schon im ersten wichtigen Wort des Textes die Beziehung zum Halbbruder Parzivals, nämlich Feirefiz, angedeutet. Daß er expressis verbis als ein „beschriebenes Pergamint" „als ein geschriben permint, swarz und blanc her und da“ 747, 26f.) als „elsternfarbiger" Bruder vorgestellt wird, paßt in den bildlogischen Zusammenhang des ersten Verses.
Die Genauigkeit im Erkennen solcher bildlogischer Zusammenhänge im Elsterngleichnis hat nichts mit „Spitzfindigkeit" zu tun, sondern hat hier eine elementare Bedeutung: Insofern nämlich, als im „Nichts" das Prinzip des Bösen vorgestellt, und nicht nur das menschliche Böse-Sein als dessen besondere Variante, der differentia spezifica, hinzu gedacht wird. - Wenn man ein sinnlich vorhandenes Schwarz-Weiß nur allegorisch nimmt, verkennt man den „hintergründigen" existentiellen Sinn des Elsterngleichnisses. Man verfehlt nicht nur die Bedeutung dessen, was in diesem „bîspel“ „beiherspielt", wie Hegel sagen würde, sondern den eigentlichen Sinn.
4.4 Die Elster
Wenn im Kontext der Bildersprache Wolframs in den Parametern von „Alles und Nichts“ gedacht und gedichtet wurde, so mag das damals schon schwer verständlich genug gewesen sein. „sine mugens niht erdenken“, sagt Wolfram von Eschenbach. Für einen Menschen des 20. Jahrhunderts ist eine Interpretation des alten Prologtextes in diesem Sinne nicht nur nicht mehr verständlich, sondern kaum noch relevant. Vielleicht kann man deshalb die Frage nach dem religiösen und existentiellen Sinn von „Teilhabe an Allem und Nichts“, die im Text gestellt wird, kaum noch vernehmen. Hängt es nicht zuletzt damit zusammen, daß man sich heute kaum noch die Mühe macht, über die Möglichkeiten seiner eigenen künftig-jenseitigen Existenz nachzudenken, wie das im 12. Jahrhundert die Regel war, nicht allein deshalb, weil in unserer Zeit das einzig Sichere, nämlich das Faktum des Todes, verdrängt wird? Selbst bei rechtgläubigen Christen, jedenfalls solchen, die sich so verstehen, gibt es in diesem Sinne keine Utopien mehr. Weitverbreitete Vorstellungen über ein Leben nach dem Tode gehen eher in Richtung Nirwana, so als ob durch den Tod, die durch Zeugung, Geburt und Geschichte begründete eigene Existenz nur irgendwie rückgängig gemacht würde. Diese Tendenz zur Selbstauflösung, zu einem Aufgehen in die Unendlichkeit oder Erhabenheit Gottes, ist auch bei Christen eine weit verbreitete Ansicht.
Auf solche Vorstellungen, die gar nicht so christlich sind, wie sie scheinen, hat der große Theologe und Seelsorger Karl Rahner in seinem Essay über „Die ewige Bedeutung der Menschheit Jesu für unser Gottesverhältnis“ hingewiesen: „Man könnte sagen: weil wir nicht mehr in der Gefahr sind, Polytheisten zu sein, sind wir in Gefahr, das geschaffene Heilige nicht mehr verehren zu können und darum auch in Gefahr, daß Gott verblaßt zu einem abstrakten Postulat der theoretischen oder praktischen Vernunft, das eventuell noch christlich drapiert ist“ (S. 52). Weiter heißt es: „Er ist nicht das ‘Eigentliche’, [...] er ist nicht das esse omnium. Je näher man ihm kommt, um so wirklicher wird man; je mehr er in einem und vor einem wächst, um so eigenständiger wird man selber [...]“ (Rahner, 1957, S. 52).
Wenn auch in der Interpretation des Wolframschen Prologverses (1,1) z.B. das „Nichts“ an Farbigkeit und damit das Böse schlechthin - im Prinzip – exemplarisch mitgemeint ist, um das Böse-Sein des Menschen in seiner Gewichtigkeit eher als Besonderheit erscheinen zu lassen, so muß man doch gleich hinzufügen, daß Wolframs dichterische Bilder zu solchen kategorialen Abgrenzungen, wie „prinzipiell“ oder „akzidentiell“ überhaupt nicht passen und auch so nicht gemeint sind. Dasselbe gilt analog für „Alles an Farbigkeit“. Wolframs Vorstellungen tendieren auf eine ganz und gar irdische Welt als Gottes Schöpfung. In seinen Bildern verbirgt sich eine außerordentlich hohe Meinung von der Geschöpflichkeit, insbesondere der Leiblichkeit des Menschen, die im Diesseits wie auch im Jenseits - nach wie vor - eine große Rolle spielt. Gerade die Leiblichkeit wurde durch die Menschwerdung und die Erlösungstat Jesu Christi in besonderer Weise geehrt und „wunderbar erneuert“, wie es in liturgischen Texten der Kirche heißt. Welchen Sinn hat also die Verlagerung von der bisher üblichen allegorischen Interpretation auf die Welt- bzw. Wirklichkeitsebene, wo „schwarz und weiß“, existentiell verstanden, die Repräsentation des Gegensatzes von „Alles und Nichts“ (an Farbigkeit) ist?
Es gibt sprachlich keinen größeren „Gegen-Satz“ als den von „gut und böse“. Auf die bisherige Interpretation, daß „weiß und schwarz“ jeweils „gut und böse“bedeuten sollen, zu verzichten, und durch die Polarität von „alles und nichts“ zu ersetzen, könnte auf den ersten Blick der Eindruck einer Abschwächung des größtmöglichen Gegensatzes erwecken, wodurch die Prägnanz der dichterischen Aussage erheblich beeinträchtigt würde. Das ist jedoch keineswegs der Fall, im Gegenteil. Es stellt sich die Frage: Läßt sich der Gegensatz von „schwarz und weiß“, von „böse und gut“ überhaupt noch steigern? - Mit Worten, und das heißt als bloße „Aussage“, sicherlich nicht. - Demgegenüber ist folgendes zu bedenken: Nur zu sagen oder zu bedeuten, das menschliche Leben sei „gut und böse zugleich“, ist weit harmloser, als in dichterischer Form „ausdrücklich“ zu bekennen, daß man selbst existentiell daran Teil hat, sogar selbst „der Gute und der Böse“ in einer Person ist; daß man mit dem, was als gut und böse „gesmaehet unde gezieret“ ist, selbst aufs innigste verbunden bzw. „verheiratet“ ist. Wolfram spricht davon, daß man selbst „parrieret“, d.h. mit Leib und Seele Teil dessen ist, was dennoch als ein „Ganzes“ verachtet und verehrt, „gesmaehet unde gezieret“ (1,3) wird. Es ist die eigene, personale Existenz in der zugleich geschichtlichen und heilsgeschichtlichen Welt.
Dem Dichter gelingt es in Sprache und Stil, den Unterschied von Sagen und Sein, von Sprache und Wirklichkeit sinnfällig zu machen. In dem, was er sagt und vor allem wie es gesagt wird, wird nicht nur etwas „angedeutet“; es erscheint in dichterischer Form sinnfällig als die zur Sprache gebrachte andere Wirklichkeit. Nicht nur die „Elster tuot“, sondern die „Sprache tut“. Sie erschafft „auf mittlerer Ebene“ im Medium ihrer Form eine eigene, neue Wirklichkeit. In der Dichtung wird etwas „wirklich“ und „wahr“ gemacht. Es wird nicht nur „gesagt“, daß vergleichsweise „schwarz“ etwas „Böses“ und „weiß“ etwas „Gutes“ bedeuten soll. Um das zu begreifen, vor allem zu verstehen, wie es sprachlich geschieht, ist eine Verlagerung des Sprachinteresses und Sprachverstehens von der Zeichen- auf die Handlungsebene der Sprache notwendig, wie es in der Interpretation versucht wurde.
An Stelle einer eigenen sprachtheoretischen Reflexion und Begründung als Beleg für eine solche Interpretation dieser Textstelle möchte ich mich auf das be-ziehen, was Bernhard Casper über „Der Sprache Tun“ bei Augustinus sagt. Was er bzw. Augustinus sagt, gilt im engeren und weiteren Sinne auch für die Dichtung Wolframs. In seinem Aufsatz (mit dem Untertitel: Beobachtungen zu den letzten Büchern der Confessiones Augustins) trägt das erste Kapitel die Überschrift: „facere veritatem - in corde et in stilo“. Der erste Satz lautet: „Um dies [nämlich das Verständnis seiner Sprache] einer Klärung näher zu bringen, möchte ich von der Beobachtung ausgehen, daß sich das Sprechen, welches hier in Frage steht, insgesamt als ein Handeln darstellt. Es versteht sich keineswegs - etwa im Sinne der Abbildtheorie Wittgensteins, auf die man seinerseits das Schema signum-res beziehen könnte - als ein gleichsam automatisches Konstatieren von Sachverhalten durch Zeichen. Es versteht sich ausdrücklich als ein Tun, in welches der Täter solchen Tuns konstitutiv mit eingeht. Dieses Verständnis von Sprache gründet sich auf die Hl. Schrift , welche die Wahrheit nicht als ein Feststellen versteht, sondern als Tun: Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht“ (Joh. 3,21) (Casper, 1990, S. 37).
Dieses „facere veritatem“ - auch in der Dichtung - geschieht zwar in der Zeit. Die Identität dessen, der spricht, mit dem, was er spricht, geschieht nach Augustins Lehre durch ein „Etwas“, das der Sprache als menschlich-zeitlicher Ausdrucksform voraus ist. „Die sterblich-zeitlich sich entfaltende Sprache des Menschen, die sich ihrer Zeitlichkeit wegen selber nie sicher sein kann, gewinnt ihr Mit-sich-selber-Einssein erst in dem Rückgang auf ein vor der Zeit liegendes „ante“. Dieses aber wird nun, insofern es sich nicht als Gott selbst, sondern als ein geschöpfliches „ante“ zeigt, von Augustinus im XIII: Buch der Confessiones mit dem Psalm 115,6 das ‘caelum caeli’ genannt“. Diese „Zeit vor der Zeit“, wovon auch die Genesis 1,1 spricht, ist als „die Schöpfung vor der Schöpfung“, nämlich die Weisheit, die ‘prior omnium creata est’ ist. Von diesem ‘prior omnium’ spricht Augustinus „nicht nur in der Weise eines theoretisch Anzuschauenden“, (S. 37) sondern als von einem „schlechthin Vorgängigen und doch Geschaffenen in der Weise der existentiellen Betroffenheit, für welche die Confessiones insgesamt ein Zeugnis sind.“ (S. 37) „Das ‘prior omnium’ (nämlich die vor aller Zeit erschaffene Weisheit, d.V.) zeigt sich deshalb auch nicht nur als zugleich zeittranszendent wie zeitgründend, sondern sprachtranszendent wie sprachgründend. Sondern es zeigt sich ebenso als das meinen zeitlichen, sprachlichen Schritten Heil und Erlösung Verheißende: das Daheim der reinen Schöpfung, welche meine peregrinatio sucht.“ (Casper, 1990 alle Zitate).
Die vorübergehende Anwesenheit dieses „prior omnium“ in der Sprache Augustins ist es, die als Ur-Form von Zeit-Fülle in der Sprechzeit eine eigene Wirklichkeit erschafft. Sie hat auch in der Sprache Wolframs die relative Struktur des „an Allem Teilhabenden“, die Gestalt der Weisheit in der übergeordneten Form dichterischer Sprache. Sprache und Welt werden dadurch kontingent und auf „mittlerer Ebene“, d.h. der Form nach, wirklich „existent gemacht“. Sie werden, wie die Analyse zeigte, auch in dem Sinne austauschbar gemacht, als eines für das andere (nach traditioneller Redeweise: Inhalt und Form; siehe auch Enite-Kritik Wolframs) einstehen kann und soll.
Das Ziel des irdischen Weges bei Augustinus, das „Daheim der reinen Schöpfung, welche meine peregrinatio sucht“, ist - bis auf den Unterschied, daß der eine Theologe, der andere Laie ist - nahezu identisch mit dem, was Wolfram als die Frucht irdischen Bemühens so formuliert:
„swes leben sich sô verendet, daz got niht wirt gepfendet der sêle durch des lîbes schulde, und der doch der werlde hulde behalten kann mit werdekeit, daz ist ein nütziu arbeit“ (872, 19-24).
Der christliche Glaube versichert, daß der Mensch auch nach dem Tode Mensch sein soll und darf, allerdings in einem Zustand, der nicht nur die „Heiligkeit des Menschen im Urstand“ widerspiegelt (die erste Inkarnation, bzw. Menschwerdung), sondern in einer Form, die durch die Inkarnation des ewigen Wortes (des Logos) in unvorstellbarer Weise überhöht sein wird. In diese Sinnrichtung zielt inhaltlich und formal der Gedanke des „an Allem teilhaben“, wie ihn das Bild der Elster - gerade auch in seiner Zwiespältigkeit als Möglichkeit der Teilhabe am „Nichts“ - realisiert. Der Terminus „Alles“ signalisiert also im o.a. Zusammenhang eher eine Richtung als ein schon auf Erden zu erreichendes Ziel: Höchste von Gott geschaffene Weisheit.
Wir haben es bei dem Elsterngleichnis mit einem dichterischen Bild zu tun, das im Sinne des Wortes „aus dem Rahmen fällt"; selbst wenn, oder gerade weil es „nur" ein „dichterisches" Bild ist. Der Ausdruck „nur" bezieht sich darauf, daß man es als Bild einfach nicht ernstgenommen oder falsch eingeschätzt hat: Alles, was an diesem Bild wie „Inhalt" aussieht, was an ihm oberflächlich erscheint und wahrgenommen werden kann, ist „primär-logisch" nicht gemeint! Mit einer allegorischen Deutung verfehlt man den Sinn des Bildes. Andererseits ist das, was an ihm durch Nachdenken und gefühlsmäßiges Einlassen (bildlogisches Verstehen) als „seiend" erkannt wird, ohne Inhalt sinnlich nicht wahrnehmbar und damit auch überhaupt nicht zu denken („sine mugens niht erdenken“ 1,17). Was ist nun Inhalt im künstlerischen Sinn?
Aus der Perspektive der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts betrachtet, ist das Elsterngleichnis ein völlig „abstraktes Bild", wobei man zugeben muß, daß „abstrakt" sowohl in der bildenden Kunst als auch in der vorliegenden Anwendung auf die Dichtung nicht ganz den Sinn dessen trifft, was gemeint ist. So haben die Maler um die Jahrhundertwende (1900) weitgehend in ihren Bildern auf Gegenständliches, Beschreibendes, Erzählendes, kurz gesagt „Inhaltliches“, auch „Literarisches", (wie z.B. in der Historienmalerei des 19. Jahrh.) verzichtet, weil sie dadurch nicht von der künstlerischen Formfindung abgelenkt werden wollten. Nebenbei bemerkt, kann man auf Inhalte gar nicht verzichten; sie wurden damals nur anders definiert; insofern ist der Ausdruck „abstrakt“ nicht nur für eine Kunstgattung wie Malerei und Plastik irreführend, sondern für Kunst überhaupt.
In der Anwendung auf Wolframs „vliegendes bîspel“ könnte man in diesem Sinne z.B. sagen: die Elster in ihrer Anschaulichkeit als Vogel spielt überhaupt keine Rolle; sie ist gar nicht gemeint. In ihrem Handeln, nicht in ihrem Aussehen wird sie zum tertium comparationis für den Menschen. Dies wird in seiner Konsequenz im „abstrakten“ Bild des Eingangsverses auf elementare, sinnfällige Weise reflektiert.
Wolframs poetische Bilder sind im elementarsten Sinne des Wortes „Abstraktionen": Nicht das, was gesagt ist und was man an ihnen sieht, ist gemeint, sondern das, was nicht gesagt ist und „ expressis verbis" anders überhaupt nicht ausgedrückt werden könnte: Es findet dennoch im „ Wie “, d.h. in der Form des Gesagten, einen prägnanten Ausdruck. Die Qualität entscheidet, nicht endlose Erzählungen, denn „da vüere ein langez maere mite“ (3,27), sagt Wolfram. - In diesem Sinne ist gerade der Eingangsvers als künstlerische Form - und nur als solche - der größtmögliche bildlogische, abstrakte Ausdruck und die Erscheinungsform für „Unsagbares“; zugleich ist er aber auch ein sinnfälliges mystisches Bild des Helden und einer rätselhaften Verfassung des menschlichen In-der-Welt-Seins. Es ist dennoch nicht theologisch-begrifflich, sondern bildhaft konzipiert. Das schließt nicht aus, daß der „Anfang“ des „Parzival“ im Grunde nur vor dem Hintergrund des biblischen „Prologs“ schlechthin, nämlich dem des Johannesevangeliums zu verstehen ist. Die Teilhabe an „Allem und Nichts“, an Licht und Finsternis wird im Zusammenhang mit der Inkarnation des Logos dort prototypisch als Möglichkeit der christlichen Existenz dargestellt, als Teilhabe an der Schöpfung, denn „Alles ist durch ihn geworden“, und: „Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden“. Ebenso heißt es: „Das Licht leuchtet in der Finsternis. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf“. Sie bevorzugten die Finsternis:
„der unstaete geselle hât die swarzen varwe gar und wirt auch nâch der vinster var, sô habet sich an die blanken, der mit staeten gedanken.“
5. Das Verhältnis von „agelstern“ - „zwîvel“ - „nâchgebûr“
5.1 Der „zwîvel“ und das Bild der Elster
Wenn man aufgrund der existentiellen Interpretation des Elsterngleichnisses seine innere Polarität trotz extremer Gegensätzlichkeit als Einheit beschreiben kann, nämlich die Elster als „an Allem und Nichts teilhabend", handelnd und erduldend, und wenn darüber hinaus diese Interpretation durch die Wortgeschichte des „Nichts" bestätigt wird, so liegt auf der Hand, daß das Elsterngleichnis mit dem Leitwort des ersten Verses, dem „zwîvel" als Einheit von Bild und Begriff, in einer engen Beziehung stehen muß.
Das Bild der Elster und seine enge Beziehung zu „zwîvel" wird noch deutlicher, wenn man die Wortgeschichte des „Zweifel" mit der Analyse des Elsternbildes vergleicht. - Wie oben bereits gesagt - ist der ursprüngliche Sinn von „zweifel" adjektivisch gefärbt: „einen gespaltenen, zweigeteilten sinn habend" bzw. „zwei arten habend". Das war im Germanischen die Grundbedeutung. Sie schwang im mittelhochdeutschen Sprachgebrauch um 1200 sicherlich noch mit.
Im Bild der Elster wird demnach zwar in anderer Form, aber ausdrücklich der ursprüngliche Sinn des Wortes „zwîvel" bestätigt. Es liegt somit auf der Hand, daß, was am Gefieder der Elster als Folge ihres Handelns äußerlich erkennbar war, eigentlich einem inneren Zustand der Zerrissenheit entspricht. Vielleicht ist das der Grund dafür, daß der Sinn des wichtigsten Textteiles, nämlich der des ersten programmatischen Satzes, ebenfalls in der Form eines dichterischen Bildes teilweise verhüllt bleiben sollte; nicht nur, um durch ein Rätsel eine Spannung aufzubauen, sondern wohl auch, um das „Geheimnis um den Gral" nicht öffentlich und wohlfeil zum Markte zu tragen.
Daß es um ein „intimes“ Verhältnis einer Innen-Außen-Beziehung des Menschen zu sich selbst und der Welt geht, erkennt man schon an dem Wort „parrieret“ in Verbindung mit „als" (d.h. „wie"), mit dem der Vers 1,6 („als agelstern varwe tuot“, 1,6) eingeleitet wird. Die Teilhabe an Heil und Unheil, wie sie im Bilde der Elster dargestellt wird, ist zugleich die Verfassung des Menschen, der im mystischen Bild des Eingangs (1,1-2) als die Figur des Romanhelden identifiziert werden kann. Bei dem Versuch, den Text so zu verstehen, sollte man nicht auf die Unterstützung durch den Dichter in seinen poetologischen Zwischenrufen verzichten.
5.2 Die Bilder des Eingangs und die „Selbstverteidigung“ Wolframs
Wie Schirok (1990; S. 132) feststellt, zeichnet sich unter Wolframforschern mit Bezug auf die Selbstverteidigung Wolframs „seit längerem eine deutliche Mehrheit ab, die darin kein ernstzunehmendes Geständnis des Analphabetentums sah, sondern eine pointiert-überspitzte, funktional zu interpretierende Stellungnahme im Rahmen und im Zusammenhang der Ablehnung von Buchgelehrsamkeit". Da der Kontextbezug dieser Selbstverteidigung am Ende des zweiten Buches unklar blieb, wurde ihre mögliche „ursprüngliche Zugehörigkeit zum Prolog" (Schirok, 1990, S. 132) diskutiert. Sie soll als Hinweis betrachtet werden, wie der Dichter sich und seine Dichtung, hier insbesondere den Prolog, verstanden wissen möchte.
Vielleicht hat Wolfram mit dieser eher selbstironisch klingenden Aussage nicht nur ein Rätsel aufgegeben, um die Aufmerkamkeit der Zuhörer auf eine falsche Spur zu lenken, sondern sie auf Wichtiges aufmerksam machen wollen: Auf das gesprochene Wort als eigentliche Gestalt der Dichtung. Im Sinne einer solchen „Selbstverteidigung“ kann es m.E. nur legitim sein, sich für den nächsten Schritt bei der Analyse des Eingangsverses ausschließlich vom gesprochenen Wort leiten zu lassen. Das ist notwendig, weil nur in der sprachlich-akustischen Verwirklichung von Dichtung die Anwendung und Wirkung poetischer Stilmittel durch den Dichter überhaupt erst wahrgenommen und verstanden werden können. Bei der Enträtselung des ersten Verses spielen ausschließlich akustisch wahrnehmbare Stilmittel die entscheidende Rolle.
Im Hinblick auf verstehenden Umgang mit seiner Dichtung behauptet Wolfram nämlich, daß er nicht lesen und schreiben könne. Diese Aussage ist von einigen Wolframforschern akzeptiert worden. Heute ist man weitgehend anderer Meinung. Wenn man darüber hinaus die Textstelle kritisch und genau liest, stellt man fest, daß von „nicht lesen und nicht schreiben können" überhaupt keine Rede ist. Wolfram sagt lediglich: Wenn Frauen es nicht für bloße Schmeichelei hielten, würde ich euch die Geschichte von unerhörten Abenteuern weiter erzählen (115,25ff.):
„swer des von mir geruoche, der enzel si zu keinem buoche. ichne kan deheinen buochstap. dâ nement genuoge ir urhap: disiu âventiure vert âne der buoche stiure. ê man sie hete vür ein buoch, ich waere ê nacket âne tuoch sô ich in dem bade saeze, ob ich des questen niht vergaeze.“ (115,25-116,4)
Dieses Zeugnis Wolframs ist als poetologische Aussage nichts anderes als Kritik a priori am geschriebenen Wort. Es ist insofern von Bedeutung, als er sagt „ichne kan deheinen buochstap“. Ergänzend könnte man u.U. hinzufügen „nicht leiden“, so wie man gelegentlich den einen oder andern Mitmenschen nicht „leiden“ kann. Dies liegt näher als zu sagen: „Ich kann nicht schreiben oder lesen“. - Dagegen äußert sich Wolfram in sechs aufeinanderfolgenden Versen (115,26- 116,1) viermal negativ über ein nicht genanntes „buoch“. Vielleicht konnte er ein ganz bestimmtes Buch „nicht leiden“, von dem („dâ nement genuoge ir urhap“ 115, 28) schon „viel zu viele“ („genuoge“ heißt ironisch gemeint, „viel zu viel“, Lexer, 1992) ihren „aufruhr, streit, zank“ hernehmen („urhap stmn. Sauerteig, aufstand etc.“ Lexer, 1992). Der Koran beginnt so: „Dies ist ein vollkommenes Buch; es ist kein Zweifel darin“ (Sure 2, Vers 3).
Im Gebet zur Hl. Dreifaltigkeit im „Willehalm“ äußert sich Wolfram zu diesem Buch so: „swaz an den buochen stât geschriben / des bin ich künstelôs beliben“ (Wh. 2,19-20). Unmittelbar vorher hatte er diesem zweifelhaften Buch die Hl. Schrift selbst gegenübergestellt mit den Worten: „der rehten schrift dôn unde wort / dîn geist hat gesterket / min sin dich kreftic merket“ (Wh. 2,16-18). Aus dieser Zuordnung im Text geht hervor, daß hier über zwei grundsätzlich verschiedene „Schriften“ bzw. „Bücher“, d.h. über Glauben und Unglauben, nicht über Analphabetentum gesprochen wird.
Darüber hinaus ist anzunehmen, daß Wolfram als wacher Zeitgenosse bereits die lateinische Koranübersetzung kannte bzw. selbst gelesen hatte. Im Auftrag des Abtes Petrus Venerabilis von Cluny hatte der Engländer Robert von Ketton in Toledo 1143 den Koran ins Lateinische übersetzt (vergl. Ludwig Hagemann, 1985, S. 51ff.). Denkbar ist, daß der Name „Keton“ (die Schärfung „tt“ gab es im 12. Jahrhundert nicht) mit der Quellenangabe „Kiot“ identisch ist. Das englische „e“ ist phonetisch ein „i“. Wolfram brauchte also nur noch die letzte Silbe „ton“ umzukehren (das „n“ zu verschleifen) und hatte so den Namen des Gewährsmannes seiner „latinischen buochen“ verschlüsselt: Kiot. Wenn diese Hypothese stimmt, handelt es sich bei „Kiot“ nicht mehr um eine fiktive Quelle, wie oft vermutet, sondern um eine echte, um den Namen des Übersetzers „Keton“.
In der Selbstverteidigung und im Eingang des Prologs (1,1-2) könnte man eine ironische Reflexion auf den ersten Vers des Koran vermuten. Ein solcher Gedanke ist im Blick auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund nicht von der Hand zu weisen. Daß der Islam und die Kaaba vor Schastel marveile (563,21- 563 12) mit im Spiel sind, wird aus dem Text, wenn auch nur in verschlüsselter Form, erkennbar. Die dezidiert gestellte Frage, ob Mohammed mit der literarischen Figur des „crâmaere“ (in Vers 563, 23-24) identifiziert werden kann, läßt sich nicht eindeutig bejahen. Anhand der folgenden Überlegungen bleibt es dem Leser selbst überlassen, eine Antwort zu finden.
Mohammed war vor seiner Berufung Kaufmann (mhd. craemer stm. abgeleitet von crâm, s. Lexer). Die im Vers verwendete Form „crâmaere“ (als Variante zur Normalform „crâmer“!) kann durchaus eine literarische Anspielung sein, die Wolfram eigens erfand, um das Bild eines bestimmten Händlers durch ein Rätsel zu verschleiern bzw. zu enthüllen. Es wäre sogar überraschend, wenn der Dichter angesichts des in aller Welt bekannten dubiosen Würfels („der crâm was ein samit, vierecke, hôch unde wît“ 563,1-2), mit dem der „crâmaere“ dem Text zufolge etwas zu tun hat, ein Gedanken-bzw. Rätselspiel mit Würfelwörtern“ sich hätte entgehen lassen: „er vant den crâmaere und des crâm niht laere“ (562,23-24).
Um die Rätselfrage nach der Identität des Krämers wenigstens indirekt zu beantworten, muß man den Text genauer abhorchen. Nellmann, dem die Bedeutung der Krämerfigur und der zugehörigen Verse bereits früher aufgefallen war, tut dies, indem er sie mit den Parallelstellen bei Chretien vergleicht[10]. Dabei ist ihm offensichtlich die vorder- bzw. hintergründige „Ungereimtheit“ der oben zitierten Verse, bei der das Wort „crâmaere“ eine entscheidene Rolle spielt, entgangen. Es paßt mit dem angegebenen Akzent weder in das vorgegebene Versmaß noch zum Reimwort „laere“. Das Faktum dieser „Ungereimtheit“ - auch wohlwollend - läßt sich nicht überhören, was im Sinne Wolframs m.E. nicht wünschenswert wäre. Im Versverbund kann man also das wichtigste Wort nicht so aussprechen, wie es grammatisch richtig gefordert werden muß, nämlich mit Betonung auf der ersten Silbe. - Wenn man es jedoch „richtig“ liest, steht es - um im passenden Bild zu bleiben - quer zum vorgegebenen Versmaß und zum Reimwort „laere“ (562,26), vergleichsweise so, wie eine „Krücke“ als der obere „ quere “ Abschluß zum vertikalen Teil (Stollen) der Stelze, die ein Krüppel unter seinen Arm schiebt, um sich aufrecht zu halten. - Im übertragenen, literarischen Sinne - denn darauf kommt es hier wohl an - ist die „Krücke“, das Krummgebogene, ein Bild für „Unaufrichtigkeit“, zumal dann, wenn - wie hier erkennbar - durch eine verschwenderische Ausstattung von ihrer wahren Funktion als Krücke (d.h. als Ersatz für etwas Echtes, wie z.B. die Fähigkeit auf eigenen Füßen zu stehen) abgelenkt werden soll. Das tertium comparationis zwischen beiden Figuren ist etwas „Krummes“, die Krücke als Symbol von „Unaufrichtigkeit“ bei Chretien und die „cram-maere“, eine „krumme Geschichte“, als die Kehrseite der Medaille des „crâmaere“ bei Wolfram (cram = „Krampf, m. spasmus [...] körperlich, ein sich krümmendes einziehen in den gliedern“ (Grimmsches Wörterbuch Bd. 5).
Indem also die vordergründige Ungereimtheit durch „stiure“ (Mithilfe) der Zuhörer dem Versmaß entsprechend „zu recht“ geändert wird, weil nichts anderes übrigbleibt, erhält der Hörer bzw. Leser einen deutlichen Hinweis auf den dubiosen Sinn des Wortes „crâmaere“. Er kommt nunmehr als „cram-maere“ (d.h. verdrehte Geschichte) akustisch zum Vorschein. A uf dem Umweg über ein stilistisches Mittel wird hier die hintergründige Bedeutung eines Bildes ausgesprochen. Für denjenigen, der durch literarische Vorgabe stilistischer Mittel derart am Erkenntnisprozeß beteiligt wird, ist nicht schwer zu erraten, was ein „Kaufmann“ mit dieser Geschichte zu tun hat, und wer er ist. Der Text selbst bietet jedenfalls solche Verständigungshilfen an, so daß man als Hörer zumindest erkennen kann, daß der „crâm“ eine gefährliche „Sache mit Haken“ (Nellmann sagt „Köder“), und der „crâmaere“ eine bekannte zweifelhafte Figur ist. - Der unerwartete und raffinierte Umgang mit einfachsten künstlerischen Mitteln macht es dem heutigen Leser schwer, die poetische Grundstruktur des Textes in seiner Einmaligkeit und künstlerischen Qualität zu erkennen. Es ist faszinierend, auf welch einfache Weise dem Bild des Krämers der Eindruck von Lüge assoziiert wird.
Wenn also die infrage stehenden Verse akustisch realisiert werden (darauf kommt es im Zusammenhang mit der Selbstverteidigung an), hört man beispielsweise, daß das in den meisten Transkriptionen verwendete Dehnungszeichen über „crâmaere“ innerhalb des Doppelverses nicht stimmen kann: Durch Metrik und Rhythmik des ersten Verses in Verbindung mit dem Reimwort „laere“ des folgenden wird für dieses Wort eine Schwerpunktverlagerung auf die zweite Worthälfte - nämlich auf „maere“ - sozusagen ästhetisch „erzwungen“, denn sonst würden die Verse sich nicht reimen. Dieser Umstand müßte den Leser oder Hörer stutzig machen. Die Kehrseite des Wortes „crâmaere“ lautet also cra - maere mit der Betonung auf der 2. Silbe, sodaß ein neues Wort entsteht: „maere“.
Der beabsichtigte Bedeutungswandel wird dadurch vervollständigt, daß die erste Silbe - infolge der Akzentverschiebung nun unbetont und kurz gesprochen - zu „kra“ bzw. (durch die Liäson mit „maere“) zu „kram“ (Lexer, kram -mmes stm. krampf) wird. - Eine „Kramme“ oder „Krampe“ ist nach heutigem Sprachgebrauch ein gekrümmtes Stück Draht, mit dem man z.B. einen Weidezaun befestigt. - Im Kontext des Doppelverses wird „crâmer“ unter den Bedingungen der Versform zu „cram-maere“.
Im rätselhaften Bild des Kaufmanns vor Schastel marveile könnte sich für Wolfram die hintergründige Bedeutung zur Vorstellung eines Verkäufers „verdrehter Geschichten“ verdichtet haben. Die „cram-maere“ ist m.E. eine „krumme Geschichte“, die sich, wie der „krüppel“ bei Chretien anstelle eigener „Aufrichtigkeit“ auf eine „Krücke“, d.h. Lüge stützt. Der Gegenstand „Krücke“ im engeren Sinne ist der obere Abschluß einer Holzstütze, die unter den Arm geschoben wird und dadurch die „aufrechte“ Haltung sicherstellt. Im übertragenen Sinn ist sie Ersatz für eigene „Aufrichtigkeit“, d.h. eine Wahrheit, die nicht auf eigenen Füßen steht. Die Krücke (als Lüge) wird bei Wolfram zum „crâm“, d.h. zum „Köder“, der Krüppel zum „Kaufmann“, der sie als „verdrehte Geschichte“ („cram - maere“) verkaufen möchte. Wolfram spielt mit der Polarität von crâm und cram, von maere und laere (wobei laere, akustisch wahrgenommen sowohl „Leere“ als auch „Lehre“ heißen kann.
Über das kurze betonte „cram“ (als Teil von crâmaere) entsteht eine Beziehung zu „Krüppel“ und Krücke. Auch hier finden sich im Grimmschen Wörterbuch für dasselbe Wort „Krücke“ verschiedene Angaben, die durchaus in den vorliegenden Zusammenhang passen:
1. Krücke, pl. bücklinge: ach wie ist doch an den fürstlichen höfen so gemein [...] tausenderlei lieblichkeiten der geberde machen, ein ganzen haufen krükke und bükke sehen lassen. etc. Reineke fuchs Rost. 1650 s.411. vermutlich nd. Eine seltsame alte form, die hier durch die reimformel bewahrt auftaucht; bücke ist pl. zu buck biegung, wie war zu krücke der sing? man könnte an kruck, subst. zu kriechen, denken, kriechende verbeugungen.“
2. Krücke als „krümmung, gekrümmtes stück. Die ursprüngliche bed. Ist wol krummes, krumm gewachsenes stück holz“.
Unter dem Stichwort „krumm“ finden sich im selben Wörterbuch zahlreiche andere bildhafte Bedeutungen: einen krummen rücken machen = schmeichlerische unterwürfigkeit; krumme finger machen = diebisch sein; krumme wege gehen= einem ziele nachstreben durch künste, listen, ränke statt mit ehrlicher offenheit; daher heißt die lüge krumm, wer die leut betriegen will, der legt zum grund ein krumme lügen“.
Im Selbstzeugnis Wolframs handelt es sich jedoch in erster Linie um eine „radikale" Aussage, die den Text selbst betrifft, insofern man ihn nur dann enträtseln kann, wenn man ihn akustisch realisiert und erst dadurch als eine „Ganzheit“ wahrnehmen kannn. Die Deutung der o.a. Textstelle (563, 23-24) ist ein konkretes Beispiel dafür, wie berechtigt die Forderung Wolframs ist, daß sein Text auf akustische Realisierung angewiesen ist. Der Sinn der poetologischen Selbstaussage geht etwa in folgende Richtung: Als Dichter bin ich nur für das gesprochene Wort „verantwortlich" zu machen; nicht für das, was davon niedergeschrieben ist oder nur gelesen wird. Mit diesen Sekundärformen kann ich mich als Dichter nicht identifizieren. Nur in der primären Erscheinungsform des Wortes und der Dichtung, nämlich ihrer akustischen Gestalt, die vom Zeitmaß des atmenden Sprechens und vom Grundtakt des ordnenden Herzschlages, d.h. von Metrik und Rhythmik, getragen wird, kann die Wahrheit bzw. Wirklichkeit des Gesagten als künstlerischer Sinn verbürgt werden.
Wenn man die sog. „Selbstverteidigung" (115,25-116,4) auf dem Hintergrund des o.a. Beispiels betrachtet, geht es dem Dichter gar nicht um seine „Verteidigung", sondern eher um eine aggressive Aussage in bezug auf das eher „Hölzerne" und Leblose von „buoche" und „buoch-staben", nicht um Lesen und Schreiben, sondern um eine Antipathie, ein „Nicht-Leiden-Können" von Buchgelehrsamkeit, welche die Wirklichkeit einer Dichtung gern „schwarz auf weiß besitzt, um sie nach Hause zu tragen“, ihren Sinn aber verfehlt.
Eine solche Selbstaussage des Dichters ist wohl auch immer Kritik am Verstehen, das sich an geschriebene „Texte" klammert. Als „Text" gilt auch heute noch überwiegend das, was geschrieben vorliegt und aus dieser Form heraus eine Interpretation legitimiert. Die eigentliche Existenzform der Dichtung als akustisches Gebilde wird bei Deutungsversuchen nicht immer beachtet. Ist das einer der Gründe, weshalb elementare Sinnstrukturen von geschriebenen literarischen Texten nicht exakt oder, wie im Falle des Parzivalprologs, zum Teil gar nicht wahrgenommen werden können? Wenn man sich dichterische Texte nicht wenigstens als Klanggebilde vorstellt, kann das Ohr weder hören, worauf es ankommt, noch es „überhören".
Eine „radikale " Interpretation im o.a. Sinn bedeutet also, daß in jeder Phase die ursprüngliche Form des „Textes" hergestellt und nur der akustische Kontext zwischen Dichterwort und Hörer zur Grundlage des Verstehensvorganges gemacht wird. Nur so besteht die Chance, dabei auch ursprüngliche, poetische Sinnstrukturen der dichterischen Gestalt wahr zu nehmen. Sie „erscheinen“ sozusagen nur als „Zugabe“ im Verstehensprozeß selbst; weshalb sie sich auch wissenschaftlich kaum „verifizieren“ lassen. Wer ein dichterisches Bild nicht „sehen“ kann oder „hören“ will, kann jederzeit mit gutem Recht behaupten, daß es ein solches nicht gibt.
Die „Selbstverteidigung“ des Dichters ist aus diesem Grunde eher eine Regel ad usum delphini und für einen Interpreten von Dichtung gedacht. Diese Bemerkungen mögen überflüssig erscheinen, sind es aber nicht, weil die folgende „Analyse“ ganz auf die akustische Form des Textes eingestellt ist und nur diese Form gelten läßt. - Allein durch Schwerpunktverlagerung kann man - obwohl man ihm nichts hinzufügt oder wegnimmt - ein und demselben Satz einen ganz unterschiedlichen Sinn verleihen oder ihn durch bewußt falsche Betonung so deformieren, daß er „chinesisch" klingt. Dieser Effekt ist bekannt.
Im Grenzfall kann das bedeuten, daß ein dichterischer Text - unter der Bedingung, alle seine Silben und Buchstaben bleiben der Menge nach erhalten - wegen unterschiedlicher Betonung oder der Verlagerung von Schwerpunkten von einer auf die andere Silbe, zwei völlig verschiedene akustische Entsprechungen haben kann. Durch die verschiedene Betonung kann er mithin auch völlig unterschiedlich verstanden werden. Das gilt für den Übergang von der Schrift zur akustischen Gestalt, zum Beispiel auch für den programmatischen Eingangsdoppelvers des „Parzivalromanes“.
Dieser Vorgang gilt aber auch in umgekehrter Richtung für den Fall, daß der Schreiber eines Textes das gehörte Wort niederschreiben soll. Ein Dichtervers, wie der erste Satz des Prologs, könnte je nach akustischer Akzentuierung und Auffassung des Vortragenden vom Schreiber durchaus auf verschiedene Weise schriftlich niedergelegt werden. Erstens so, wie er uns handschriftlich überliefert wurde:
„ist zwîvel herzen nâchgebûr“ oder auch „ist zwî vel herzen nâh gebûr“.
Bei völlig gleichbleibender Buchstaben - und Silbenzahl ist im zweiten Fall nun nicht mehr von irgendeinem Zweifel, sondern von „Zwei Fellen“ die Rede. Der „nâchgebûr“ als der „nächstliegende Bauer“, hat sich durch die Betonung ebenfalls zweigeteilt: „nach“ ist dem herzen „nahe“ gerückt (wie das auch in vielen Interpretationen so gesehen wurde, indem man „nahe“ oder „benachbart“ übersetzte) und der andere Wortteil zum „Bauer“ geworden. Dieses Wort ist zweideutig. Es könnte aus naheliegenden Gründen (Falkenhaltung und -jagd) das Bild eines „Vogelbauers“ sein, auch „nächstliegender Bauer“, womit der „Nachbar“ gemeint ist. Es handelt sich also beim ersten und letzten Wort des Eingangsverses jeweils um ein Wort mit zwei Bedeutungen, d.h. um Äquivokationen, die Wolfram bewußt als Stilmittel einsetzt. Sie wirken im Rahmen des dichterischen Bildes mit. Deshalb entsteht der Eindruck einer changierenden Hin- und Herbewegung des zugrundeliegenden Sinnes. Man könnte hier vielleicht einwenden, im ersten Fall („zwî-vel“) müsse das Verb wegen des Plurals von „Felle“ dann nicht „ist“, sondern „sint“ heißen. Es handelt sich jedoch hier um ein Fell mit zwei Farben . Der Numerus bezieht sich also auf die Zweiteiligkeit eines Felles, wie etwa der Begriff „Polarität“ (im Singular) mindestens zwei Gegensätze vereint.
Die hier vertretene These lautet: Nicht nur bei der Niederschrift des Parzivalprologs ist „Zweideutigkeit“ im Spiel gewesen, sondern sie war mit Sicherheit vom Dichter so gewollt. Je nach Verständnis konnte man den Text in dieser oder jener Version niederschreiben, abschreiben oder auch vortragen. - Zweideutigkeit kann vom Dichter u.a. ganz bewußt als dichterisches Mittel eingesetzt worden sein, um z.B. eine subtile Aussage in der Form eines Rätsels zu verschleiern und damit gleichzeitig die Spannung zu steigern.
Eine solche Verschleierungstechnik war u.U. auch eine Möglichkeit, lästigen und inquisitorischen Fragen unangenehmer Zeitgenossen auf einfachste Art aus dem Wege zu gehen, d.h. auch, sich nicht belangen zu lassen. Mit der Möglichkeit, den Wortlaut der Dichtung so aufzuschreiben, wie ein Schreiber ihn verstanden hatte, war immer auch das Risiko eines Mißverständnisses gegeben. Wenn der Dichter dies nicht bemerkte, oder es nicht merken wollte,- nach eigener Auskunft war er ja des Lesens und Schreibens nicht mächtig - so konnte ihn niemand für einen kritischen Text verantwortlich machen. Die Aussage, von Büchern nichts zu verstehen, könnte auch eine Schutzbehauptung gewesen sein.
In diesem Sinne wäre die Selbstbezichtigung eine geschickte taktische Variante des Dichters, haargenau passend zur o.a. Maxime, daß seine Dichtung nur als gesprochenes Wort zu gelten habe und deshalb besonderer Aufmerksamkeit bedürfe. S elbst wenn der Text falsch niedergeschrieben wäre, könnte man ihn dennoch richtig verstehen, wenn er nur immer akustisch realisiert würde. Genau das ist die Forderung, die auch heute noch zu gelten hat. Wie oben dargelegt, bedarf es keiner eigenen Theorie, um durch geringfügige akustische Schwerpunktverlagerungen den Sinn eines Textes zu verändern.
Der Text des Prologs konnte bisher nicht eindeutig übersetzt werden. Warum sollte man unter diesen Umständen nicht annehmen, er sei in dichterischer Absicht von vornherein bewußt „zweideutig“ konzipiert? Auf diese Weise entspricht er der Form nach dem, was inhaltlich über die gespaltene Form menschlichen „In-der-Welt-Seins“ über den Romanhelden gesagt wird. Im Zusammenspiel von Sprachsinn und Bildsinn desselben Eingangsverses kann in seiner „zwiespältigen" künstlerischen Wirklichkeit ein hintergründiger Sinn erahnt werden.
Für die folgende experimentelle Analyse des ersten Prologverses wird der Textsinn so akzeptiert, wie er in den bisherigen Übersetzungen vorliegt; aber nur „vorläufig“. Der erste, durch „Lesen“ („einsammeln“) erzeugte diskursive Textsinn wird im „Vorgriff“ auf seine „andere“ noch „ankommende“ qualitative Bedeutung ein wenig retardiert. Weil sich - wie o.a. - der Sinn des Ganzen nur im Kontext mit seiner akustischen Gestalt (also „danach“) zeigen kann, entsteht die notwendige „Gleichzeitigkeit“ für die Wahrnehung des „Ganzen“ nur im subjektiven Erleben, d.h. die sinnfällige künstlerische Einheit von Subjekt und Objekt konstituiert sich als „ Paßform “ (vorübergehende Form) zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Vergehen und Ankommen der Zeit in der Einbildungskraft.
Was im künstlerischen Erleben „gleichzeitig“ geschieht, läßt sich im methodischen „Nacheinander“ nicht adaequat darstellen. Ebensowenig kann man Form als etwas „Vorübergehendes“ beschreiben. Insofern bleibt auch der hintergründige Sinn der folgenden methodischen Analyse auf die Einbildungskraft angewiesen. Der Sinn beider „Versionen“ des Textes (in gewissem Sinne „gespalten“, weil er an der schriftlichen und mündlichen Form teilhat) muß als Ganzheit verstanden werden. Die Aufmerksamkeit gilt nun dem ersten Doppelvers des Parzivalromans.
5.3 Die rätselhafte Beziehung von „nâchgebûr" und „zwîvel"
In der ersten Zeile spielt neben dem Leitwort „zwîvel" am Anfang des Verses das Wort „nâchgebûr" an seinem Ende eine ebenso wichtige Rolle. Seinen besonderen Sinn gibt es erst preis, wenn man den Vers laut spricht und dabei besonders seine Metrik und Rhythmik als entscheidende Verständigungshilfen für die Sinngebung beachtet. Um es vorweg zu sagen: Das Wort „nâchgebûr" wird - meistens aufgrund der heute schriftlich vorliegenden Form, die von Lachmann aus verschiedenen Handschriften transkribiert wurde, weil es keine Originalüberlieferung mehr gibt - oberflächlich zunächst mit „Nachbar" übersetzt. Das löst Verwirrung aus, denn was hat, wie schon angemerkt, der Zweifel mit dem „Nachbarn“ zu tun? Die Frage, wie „nâchgebûr“ im Verhältnis zu „zwîvel“ verstanden werden soll, ist damit gestellt: Eine Orakelfrage, die, wenn sie falsch beantwortet wird, im übertragenen Sinn „Kopf und Kragen“ kosten kann.
Zugegeben: Für sich allein genommen und als Begriffe passen „nâchgebûr" und „zwîvel" gefühlsmäßig schlecht zusammen. Man muß den Text schon stark „glätten“, um ihn einigermaßen „logisch auf die Reihe“ zu bringen, wobei in den meisten Fällen „nâchgebûr“ unterschlagen wird. Wenn andererseits aber der „Zweifel" dem Dichter so wichtig war, wie es nach der Art der Übersetzungen zu sein scheint, so wäre er dem Herzen gewiß nicht nur „benachbart" oder auch nur „nahe" gewesen, wie es in vielen Übersetzungen heißt: Wenn schon, dann gehört der Zweifel doch mitten ins Herz oder dieses wenigstens einschließend. In den Vorstellungen von „nahe" und „benachbart" wird „nâchgebûr“ im Nachhinein noch als lästig empfunden und deshalb als etwas nicht Vermeidbares der Form nach nur „beiläufig" berücksichtigt.
Bei Wolfram hat jedes gewichtige Wort im Text seine zwei Seiten, deren Sinn, wie bei einem „bickel", sowohl das „eine“ als auch das „andere" davon völlig Verschiedene bedeuten kann. Die Analyse des „bickelwortes" zeigte, daß dies der Vorwurf Gottfrieds an die Adresse Wolframs war. Auch am komplexen Beispiel des Elsterngleichnisses wurde erkennbar, daß man einem solchen Text nicht einfach „aus dem Gesicht ablesen“ kann, was er bedeutet. Das gilt für den ersten programmatischen Doppelvers des Prologs insgesamt, insbesondere auch für das Wort „nâchgebûr“.
Vom sogenannten „Tee-Kesselchen-Spiel“ der Kinder wissen wir, daß ein Wort zwei völlig verschiedene Bedeutungen haben kann, oder, daß in einem Wort zwei andere versteckt sein können, wie bei „Feder“, das Schreibfeder, Vogelfeder oder Uhrfeder bedeuten kann. Das mittelhochdeutsche „bûr" ist ein solches „Tee-Kesselchen": „Bur" heißt „Bauer“; entweder Landwirt oder Vogelbauer. Diese Doppelbedeutung gilt heute noch so gut wie damals. Der „nâchbûr" (so die regelmäßige Bildung zu „bûr“) wäre nach Lexikonauskunft „der in der nähe wohnende, der anwohner, nachbar" (Lexer, 1992). Unter dem Stichwort „nâch-gebûr“ steht im mhd. Wörterbuch lediglich der Verweis auf „nâchbûre“, was dasselbe wie „gebûr“ oder „bûr“ heißt. Gemeint war mit „gebûre“ u.U. nur der „nächstliegende Bauer“, d.h. Nachbar.
Die Bedeutung des Wortes „nâchbûr" (als „nächstliegender Bauer") wird von Wolfram innerhalb des Textes mit Hilfe von Metrik und Rhythmik des Versmaßes verdoppelt, d.h. akustisch getrennt in „nâch" („nahe", das dem „herzen“ im Text zugeschlagen wird) und „bûr" bzw. „gebûr“ („Bauer" = Käfig bzw. Gefängnis). Im Vers hat das Wort „nâchgebûr“ damit, d.h. primär akustisch wahrgenommen, diese zwei Bedeutungen.
Die letzte betonte Silbe des Wortes „nâchgebûr“, gleichzeitig letzte Silbe des ganzen Verses („bûr"), ist also Gegenpol zur ersten betonten Silbe des Eingangsverses „zwi“ (aus zwi-vel). Die Silben „zwî“ und „bûr“ sind symmetrisch um die Mitte, nämlich „herzen“ angeordnet. Im „zwî-vel" ist, wie oben gesagt, das „Zwei-Fell" der Elster mitgedacht und zwar im Sinne einer Dualitas von „Alles und Nichts". Da nun aber das Wort „zwîvel" selbst in seinem ganz ursprünglichen Sinn „einen zweifachen bzw. gespaltenen Sinn habend" heißt, bedeutet „zwîvel“ nun - im Zusammenhang mit dem Elsterngleichnis - inhaltlich „an Allem und Nichts teilhabend.“„zwîvel" wird wortgeschichtlich nach Auskunft des Grimmschen Wörterbuchs erst später zu „zweifel-haft". Als Eigenschaftswort ist es, wie sich aus dem Heliand belegen läßt, immer einem Substantiv, meistens (!) dem „herzen" („hugi“ im Heliand) zugeordnet. Vielleicht liegt in dieser Zuordung von „zweifel-haft“ der Grund dafür, daß dieses Wort selbst „gespalten“ wurde in zwî-vel und „haft“; wobei sich, wie bereits oben vermerkt, dem Dichter die Vorstellung von „Haft“ zu „Vogelkäfig“ d.h. „Bauer“ herauskristallisierte. Wie aus der sprachgeschichtlichen Entwicklung des Wortes „zwîvel" zu „zweifelhaft" hervorgeht, wurde vermutlich schon zu Wolframs Zeit in diesem Terminus so etwas wie ein „Gefangensein" bzw. „Haft“ mitgefühlt, wodurch sich u.a. die Vorstellung von „bûr", als Gegenpol zu „zwîvel" eingestellt haben könnte. Das wäre ein Argument für die Übersetzung von „bûr" als Käfig.
Die Vorstellung, daß „zwîvel" [diese „`Gesinnung' (mhd.: „die Eigenschaft, einen gespaltenen, zweigeteilten sinn habend" oder im Heliand: „zwei arten habend"] (Lexer, 1992) wie eine Dualitas („Zwei-Fell" der Elster) das Herz umschließt, provoziert die naheliegende Vorstellung, innerlich gespalten und selbst darin „eingezwängt" zu sein. Das wird bei Wolfram sehr realistisch gesehen: Das Herz ist in der eigenen Brust eingesperrt; der „Brust-Korb“ mit seinen Rippen als „Vogelbauer“ wird zum „Käfig“ für die Seele und als Gefängnis vorgestellt. Die optische und gefühlsmäßige Assoziation zu Brustkorb als „Bauer" ist „Gerippe", d.h. tödliche Bedrohung. Das Herz ist also im „Brustkorb“ von einem Doppelfell bzw. „Zwei-Fell,“ d.h. von „Gut- und Bösesein" umhüllt, wie in einem Vogelkäfig gefangen. - Diese Interpretation wird nahegelegt durch das Wort „zwîvel", soweit es auch vom Bild der Elster her beeinflußt wird, denn dieses weist in eine ähnliche Richtung.
Diese Deutung des ersten Verses wird mitgetragen und bestätigt durch das Versmaß als sinngebende Grundstruktur. Metrik und Rhythmus übernehmen dabei eine entscheidende Rolle. Erst durch die Schwerpunktbildung, die man beim mündlichen Vortrag, weniger beim bloßen Lesen, bemerkt, werden einzelne Silben betont oder unbetont, dadurch also hervorgehoben oder vernachlässigt, je nachdem, wie der Sinn des Textes es erfordert. So wird mit unbetontem Auftakt „ist“, die Silbe „zwî" des Eingangsverses zur ersten Silbe und „zwî-vel“ zum Leitwort gemacht. Indem im Wort „zwîvel" die Silbe „zwî" doppelt betont wird (im Wort selbst sowieso und als erste Silbe im ersten Metrum, sogar mit eigenem Auftakt), liegt das Hauptgewicht auf „zwî", d.h. der Assoziation von „zwei". Die Vorstellung von einem „Zweifachen“ (einer Dualitas: der Polarität) wird dadurch vorherrschend.
Durch das Versmaß wird „nâchgebûr" am Ende des Verses dreiteilig, von dem der erste Teil sich dem „herzen" zuneigt. Man darf annehmen, daß das dreisilbige Wort „nâchgebûr“ mit der eingeschobenen Silbe „ge", eine Wortschöpfung Wolframs ist. Auf diese Weise wurde es dem Versmaß angepaßt: Für die beiden letzten Takte des Verses wurden nämlich zwei Schwerpunkte benötigt, die dann auf die Silben „nach" und „bûr" entfielen. Das Wort „Nachbar“ lautet in seiner regelmäßig gebildeten Form „nâchbûr" und ist nur zweisilbig (Lexer, 1992). Akustisch wurde so innerhalb des Verses die letzte Silbe „bûr" durch das unbetonte „ge" getrennt und zu einem eigenen einsilbigen Wort verselbständigt: zu „bur", d.h „Bauer“ oder „ Bauer “. Das Bild des „Vogelbauers“ war einer Gesellschaft, zu deren Lieblingsbeschäftigungen die Jagd mit Falken und Sperbern gehörte, durchaus vertraut.
Andererseits könnte aber auch die Silbe „ge“ zum Zwecke der Verdeutlichung des Wortes „bur" und zur Intensivierung seines Sinnes eingefügt worden sein, ganz abgesehen davon, daß diese Kurzsilbe als unbetonte Silbe für den Vers selbst im Metrum benötigt wurde. Die Silbe „ge" hat zwar keinen eigenen Wortsinn, bedeutet aber auf „bur" (als Käfig) bezogen eine Steigerung der Sinnrichtung dieses Wortes, die mit dem Sinn des Gesamtverses übereinstimmt und ihn verstärkt: „ge-, gi,- präf.[..] vor subst., adj., ad. und Verben mit dem Begriff des zusammenfassens, abschließens, der dauer und vergangenheit; [...] oft nur mit unübersetzbar leiser modifizierung des Begriffs" (Stichwort „ge" Lexer, 1992).
Wenn sich nun jemand allein auf die sprachlich-akustische Gestalt der Dichtung verlassen hätte, was zu Wolframs Zeiten sicherlich der Normalfall war, mußte er den Text - durch Gesten und Gebärden unterstützt - u.U. ganz anders verstanden haben, als wir, denen er nur schriftlich vorliegt. Dabei ist hinzuzufügen, daß nicht einmal heute, in handschriftlich vorliegenden Texten - was die Zahl der Silben und Buchstaben betrifft - etwas hätte verändert werden müssen, um ihn im oben angedeuteten Sinne verstehen zu können. Ob mit oder ohne Gestik: Daß der Sinn erkannt und das Kunstwerk als eine eigene Realität wahrgenommen wird, hängt immer noch vom einzelnen Hörer ab. Wer die Sinnrichtung des Textes nicht schon ahnt, kann ihn so oder so nicht entziffern.
Es ist an dieser Stelle grundsätzlich zu fragen, ob man schemenhafte Hintergrundinformationen des Textes, die beim mündlichen Vortrag relativ leicht nachzuzeichnen und zu verstärken sind, bei einer Übersetzung überhaupt berücksichtigen kann und darf. Angenommen, ein Schreiber hätte beim Hören der Dichtung, weil ihm bildlogische Assoziationen gegenwärtig waren, diesen „Hintergrund“ direkt in seine Niederschrift einfließen lassen: Verstehen und Übersetzen des Textes wäre damit für uns heute nicht vereinfacht worden. Diese Überlegung ist zwar nur reine Spekulation. Man sollte dennoch einmal die Probe aufs Exempel machen:
"ist zwî-vel herzen nâch ge bûr. daz muoz der sêle werden sûr."
„Nahe am dichterischen Bild im Text bleibend“ lautete der Eingangsvers in der Niederschrift des o.a. „Mitschreibers“ so:
„Zwei-Fell` das Herz umschließend wie ein Käfig, Das ist für die Seele eine Bedrohung.“
Hier handelt es sich zwar um den Bildhintergrund des Eingangs. In dieser Form „übersetzt“, wäre er völlig unverständlich, weil man seine Innenseite nach außen gekehrt hat. Wenn Lachmann von Nichtübersetzbarkeit bestimmter Stellen spricht, hat das einen guten Grund. Selbst wenn man ein dichterisches Bild als solches im Text identifiziert hat, kann man es nicht unvermittelt in die Übersetzung transferieren. Ein Versuch zeigt den Un-Sinn, der dabei herauskommt.
Was hier als hintergründiger Sachzusammenhang eines dichterischen Bildes identifiziert wurde, war für Gottfried von Straßburg als Zeitgenosse Wolframs leichter zu durchschauen als für uns. Umso besser kann man seine Wut verstehen. Er mußte mit ansehen, wie Wolfram mit einfachsten Mitteln in lapidarer Form den sich höchst anspruchsvoll gebenden theologischen Begriff des zwîvels, der in Hartmanns Dichtung eine zentrale Rolle spielt, durch parodistische Variation schon im Eingangsvers des Prologs „vom Sockel“ auf den Boden der Realität zurückholt. Der im „Gregorius“ überstrapazierte theologische Begriff „zwîvel“ mutiert im ersten ironischen Atemzug des Parzivalprologs zu „zwei-Fellen“, zu einer „Hülle“ (wie „vel“ aus velum) oder sogar zur „Zwiebel“, dem Inbegriff des „Hülle-Seins“. Dieser „zwîvel“, wie zwei sich um das Herz legenden „Felle“ verstanden, wird dann auch noch mit Hilfe eines zweiten Bildes (nâchgebûr) parodistisch zum „Käfig“ umgedeutet, indem er mit „bûr“, d.h. „Vogelbauer“ gleichgesetzt wird. Dieses Gesamtbild ist vordergründig eine Verspottung Hartmanns von Aue - und gleichzeitig - als mystisches Bildrätsel eine Ehrung des Romanhelden Parzival: „beidiu [...] si lasternt unde êrent“ (2,10-12). In der Einheit von Text und Bild sind völlig verschiedene Tendenzen vereint: Spott für den Gegner und Verehrung für den Helden Parzival. Gottfrieds Kritik, die im Vorwurf der Herstellung und Verwendung von „bickelwörtern“ (Wörter bzw. dichterische Bilder, die Sinn und Un-Sinn in sich vereinen) kulminiert, entbehrt also aus seiner Perspektive wirklich nicht eines Anlasses. Freilich scheint er nicht bemerkt zu haben, daß er mit seiner heftigen Kritik nur die Ebene der dichterischen Mittel erreichte. Seine Kritik traf nicht den Kern der Dichtung Wolframs, weil er ihn nicht erkennen konnte oder wollte.
6. Das dichterische Gesamtbild des Anfangs (1,1-1,14)
Um die logischen Schwierigkeiten und die dadurch auftretenden Polaritäten im Rahmen des Prologs verständlich zu machen, war auf den sachlichen Hintergrund eines möglichen dichterischen Gesamtbildes reflektiert worden. Dabei hatte sich die bis an die Grenze der Unvereinbarkeit gehende Spannung zwischen dem sachlogischen bildlichen Hintergrund und der Begrifflichkeit des sprachlich fixierten Textes im Vordergrund gezeigt. Das war vom Dichter vermutlich so gewollt.
Die Versuche, den bildlogischen Hintergrund des Textes aufzuklären, um Verständigungsschwierigkeiten auszuräumen, sind also keineswegs schon als die neue Übersetzung des Textes zu betrachten. Es geht im nächsten Schritt primär um die Zuordnung von Sprach- und Bildlogik auf der Ebene eines tertium comparationis durch das die unterschiedlichen logischen Beziehungen von Bild und Begriff im Wort sinnvoll einander vermittelt werden können. Diesem „zu vergleichenden Dritten“ als Gestalt einer „gemachten“ Wirklichkeitsebene der Dichtung entspricht die leib-seelische, geschichtliche Existenz des Menschen in seiner Welt. Die „verrückten“ Perspektiven im logischen Verhältnis von Text und Kontext, von Welt und künstlicher Welt, haben ihre gemeinsamen Koordinaten in der Einheit der leib-seelischen Verfassung des Menschen. Auf diesem Hintergrund erscheint die künstlerische Wirklichkeit des Eingangs in ihrer Spannung von Wort und Bild als Spiegelung der Einheit und Zerrissenheit des Menschen. Sie steht stellvertretend für die real gespaltene menschliche Existenz in dieser Welt, nicht bloß spekulativ, sondern als sinnfällige, künstlerische Realität.
Auf das Herz bzw. das Leib-Herz-Seele-Verhältnis eines wirklichen Menschen bezogen, nämlich das des Romanhelden Parzival, erhalten die Wortbedeutungen von „zwîvel“, theo-logisch als Zweifel, anthropo-logisch als „vel“ (Haut), kunst-logisch als „velum“ („Hülle“ als Sinnbild für künstlerische Form) ihren gemeinsamen Sinn: Auf seelischer Seite ist es das rationale und emotionale Gespaltensein, auf existentieller Seite die Leiblichkeit, die seelisches Geschehen „verhüllt“. Diese Einheit ist es, die der Erkenntnis und Selbsterkenntnis sowohl im Wege steht, als sie auch in unvollkommener sinnlicher Weise ermöglicht (als Kunst). „Zwei-Fell’“ im weitesten Sinne des Wortes verhüllen und enthüllen das menschliche Herz als ein Wesen in einem „bur“ (Vogelbauer oder Gefängnis). Diese Aspekte des Menschseins haben in einem künstlerischen Prozeß einen Gestaltwandel zum dichterischen Bild mitgemacht. In ihm wird das komplexe Schicksal menschlicher Existenz reduziert und im „tertium comparationis“, der Dichtung als Kunst, „analog“ (im Medium der Worte) verwirklicht.
Die zweite Hälfte des Eingangsverspaares lautet: „daz muoz der seele werden sûr," (1,2). Im ersten Wort der zweiten Zeile „daz" spürt man die „Summe" des in der ersten Zeile Gesagten. Von daher erhält sein Anfang mit dem relativ unscheinbaren Artikel „daz“, das ganze Gewicht eines vollwertigen Satzgegenstandes für die zweite Verszeile. Das eigentliche Subjekt des zweiten Verses ist sinngemäß also der objektive Befund (Inhalt) des ersten Verses. Erst in dieser Bedeutung ist „daz“ dann das Gegengewicht zum ebenso lapidaren Wort „sûr". Trotz seiner Einsilbigkeit enthält es eine Fülle von Bedeutungen, die man als Kennworte bzw. Begleiterscheinungen seelischer Verzweiflung bezeichnen könnte („sûr“, adj., sauer, herbe, scharf, bitter (bildl. hart, böse, schlimm, grimmig). - subst. stn. bitterkeit, übel, nachteil“ Lexer, 1992). Insofern ist im Wort „sûr“ dasselbe gesagt wie in „zwîvel“. Diese tautologische Zuordnung steigert das Subjekt des ersten Verses in seinem Gewicht. Dreh- und Angelpunkt des zweiten Verses und dessen Mitte, auch als Sinnmitte, ist jedoch „seele". Während der erste Teil des Doppelverses ein dichterisches Bild ist, handelt es sich in der zweiten Vershälfte eher um eine Abstraktion dieses Bildes, eine Zusammenfassung und Schlußfolgerung, die man so übersetzen könnte: „Das treibt die Seele in den Wahnsinn“. Damit sind der erste und zweite Vers des Prologs eine Einheit von Bild und Begriff, ein Programm des ganzen Parzivalromans.
Die tektonische Mitte des „Eingang“ (1,1-2) wird optisch und akustisch durch das Wortpaar Herz und Seele gebildet. In der Verlängerung dieser Achse, durch das ganze „vliegende bîspel“ hindurch, ordnen sich alle weiteren Bilder um sie herum und werden dadurch untereinander verbunden. Beide Wörter bilden auch je für ihren eigenen Vers die Mitte und halten ihn im Gleichgewicht. Graphisch läßt sich die Grundstruktur des ersten Verspaares folgendermaßen darstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„Zwîvel“, im ersten Vers als „Zwei-Fell“ apostrophiert , heißt natürlich beides, sowohl „Zweifel“ als auch das „Zwei Fell“. In dieser Deutung spiegelt sich die völlige Ausgewogenheit des Originaltextes wider. Nicht zu vergessen ist, daß „zwîvel“ an „Allem und Nichts teilhabend“ heißt, was zu den zwei Fellen paßt, die das Herz im übertragenen Sinn umschließen.
Interessant ist hier die realistische, dichterische und existentielle Vorstellung des Herzens im „Zwie-Spalt" von „Alles und Nichts", eingeklemmt im „Brustkorb“, wie in einem Vogelbauer gefangen. Die Sprossen des Bauers und die Rippen des Brustkorbes verschmelzen zu einer einheitlichen Vorstellung. Der eigene Brustkorb („bauer“) wird zum Symbol für das „Eingesperrtsein“ von Herz (im übertragenen Sinne) und Seele im Leib. Sie sind ihrer Freiheit beraubt. Im Bild dieses sonderbaren Bauers als „Gerippe" wird zugleich ein Gefühl von „tödlicher Bedrohung" assoziiert. Im Wort „sur“ konzentriert sich diese Bedeutung.
Das enge Beieinander von Herz und Seele im ersten Doppelvers läßt darauf schließen - man sieht es auch schon im geschriebenen Text -, daß diese Beziehung im „Wirrwar“ ringsum der ruhende Pol und das Zentrum des Menschseins, somit auch Sitz der menschlichen Tugenden ist. Diese Einheit ist logischerweise auch Sitz des „unverzaget mannes muot“. In dieser Konstellation handelt es sich nicht mehr nur um ein allgemeines Bild des menschlichen In-der-Welt-Seins, sondern um das Bild des Menschen dieser Geschichte: Parzivals. Der „unverzaget mannes muot“ ist das Erkennungssignal eines Helden des maere: Dieses Herz, umgeben von „Allem und Nichts“, selbst daran teilhabend, eingesperrt wie in einem Gefängnis seiner leibseelischen Existenz, ist das dichterische, mystische Bild des Romanhelden Parzival. Er erscheint schon im Eingangsvers des Prologs samt seinem „alter ego“, dem elsternfarbenen und „zweifelhaften“ Bruder Feirefiz.
Die Bedeutung dieses dichterischen Bildes ist so komplex, weil es als mystisches Bild und Rätsel eine menschliche Situation vergegenwärtigt, die über Sprachliches weit hinausgeht. Man kann dennoch einmal kurz in Erinnerung bringen, was von den Metabegriffen des ersten Verses, nämlich „zwîvel“ und „nâchgebûr“ und ihrer Hintergrundbedeutung mit einfließt, um die Komplexität zu ahnen, die in diesem Bild „verdichtet“ wurde.
„zwîvel“:
- Wortgeschichtlich: „einen gespaltenen Sinn habend“.
- Heilsgeschichtlich: eine Seele in Verzweiflung, jenseitsbezogen.
- Naturgeschichtlich: ein Herz von zwei „Fellen“ und einem „Gerippe“ eingeschlossen.
- Dichterisch: die wortgeschichtliche Leer-Form („Hülle“), die durch das Elsterngleichnis mit der Bedeutung an „Allem und Nichts teilhabend“ ausgefüllt wird.
- Logisch: „zwîvel“ als ein Wort, verschiedenen logischen Ebenen angehörend und dennoch auf beide gleichzeitig reflektierend, der Innbegriff für die Schwierigkeit, die Welt und vor allem sich selbst zu erkennen.
- Lexikalisch: „zwîvel stm; md. auch zwibel“; „zwifel“ (Lexer, 1992) die Zwiebel als Äquivokation zu „zwîvel“.
„nâchgebûr“
- Wortgeschichtlich: Nachbar, d.h. „nächstliegender Bauer“; über das Wort „Bauer“ wird die Beziehung zur alternativen Bedeutung von „Bauer“, als „Vogelbauer“ hergestellt.
- Bildlich: eine „Haft“- Anstalt; von daher die Beziehung zum Adjektiv „zweifel-haft“.
- Geschichtlich: der Nachbar als „nächstliegender Bauer“ signalisiert „Bodenhaftung“, In-der-Welt-Sein, Erdverbundenheit, menschlich Nahe- Sein, Beisammensein und Einheit.
- Dichterisch: diese dingliche Nähe mutiert vom „nächstliegenden Bauer“ (Nachbar) über den „nahen Vogelbauer“, zum mystischen Bild des „Brustkorbes“, in dem das eigene Herz leibhaftig gefangen ist.
Im letzten Punkt der Aufzählung korrespondiert „nâchgebûr“ mit dem „leiblichen Anteil“ von „zwîvel“, nämlich dem „vel“: `zwei-vell`das Herz umschließend. Entweder können „Alles und Nichts“ die beiden Felle sein oder aber die Leibgebundenheit der menschlichen Existenz, die ein Grund für die Verzweiflung der Seele ist.
Die Worte „zwîvel“ und „nâchgebûr“ umrahmen wie zwei Säulen das dichterische Bild eines menschlichen Herzens, das Anteil an Gut- und Böse-Sein hat. Dieses Bild „spricht“ für sich selbst. Ein Herz in tödlicher Bedrängnis zwischen Gott und der Welt; „gepaart“ mit dem „unverzaget mannes muot“. „Herz“ assoziiert die Farbe rot, Blut, Liebe, und Leben; es ist von „Allem und Nichts“, gut und böse in der eigenen Brust „umfangen“. Alles deutet auf die symbolisch verdichtete menschliche Existenz des roten Ritters hin, der hier in der Form seines „herzens“ bereits anwesend ist bzw. verkündigt wird. Der Prolog schließt deshalb so: „den helt ich alsus grüeze [...] er ist maereshalp noch ungeborn“ (4,19-24). Wolfram begrüßt am Ende des Prologs den, in Worten des „Eingangs“ schon empfangenen, Helden. Er ist zwar noch nicht geboren, aber doch schon leibhaft anwesend.
Eine gewisse Banalität der Gegenstände wie „Fell“ oder „Vogelbauer“, die bei der Interpretation ins Spiel gebracht wurden, mag gelegentlich und auf den ersten Blick ein gewisses Unbehagen ausgelöst haben; das hatte schon Gottfried von Straßburg so empfunden („swer nu des hasen geselle si und uf der wortheide hochsprünge und witweide mit bickelworten welle sin [...]“ (Tristan 4638-4641). Das gilt z.B. auch für den etwas prosaischen Gedanken an eine Zwiebel im Zusammenhang mit dem „zwîvel“ des Parzivalprologs: „zwîvel“ und „zwîbel“ werden synonym gebraucht (Lexer, 1992).[11] - Wenn eine Zwiebel gemeint ist, wird das „i“ kurz gesprochen. Allerdings findet sich in den Handschriften als Schreibweise von „zwîvel“ auch „zwifel“; ein Terminus, der im Lexer eindeutig der „zwibolle“ zugeordnet ist. Ob sie als „Urbild“ einer noch nicht entwickelten Pflanze etwas mit dem Eingangsbild des Prologs zu tun hat?
Die Zwiebel ist ein Urbild der Verhüllung, so daß es nicht abwegig ist, wegen der Mehrschichtigkeit der Bedeutungen des „zwîvels“ sich dieses Bildes zum Zwecke einer organischen Deutung des Prologs zu bedienen. In der Gattung der Zwiebelgewächse gibt es nämlich neben denen, die man in der Küche gebraucht, auch solche, aus denen sich im Wachstumsvorgang Tulpen, Narzissen und Lilien entfalten. Diese Endformen einer lebendigen Gestalt sind schon in ihrer Zwiebelform keimhaft (Goethes Urbild der Pflanze) vorhanden, nicht nur als Anlage, von der man nichts sieht, sondern in einer Miniaturform, die man mit bloßem Auge gerade noch erahnen kann. Wegen dieser Besonderheit nennt der Fachmann die Zwiebel einen „gestauchten Sproß“. Unter dem Aspekt ihres Gestaltwandels ist die Zwiebel plötzlich gar nicht mehr banal. Dieser „terminus technicus“ der Biologie ist zwar „biologisch“ festgelegt, die damit verbundene Vorstellung kein schlechtes Bild, um die zugleich organische, morphologisch komplexe Struktur des Parzivalprologes zu deuten.
Die Wolframforschung ist sich darin einig, daß der Prolog entstand, als das Hauptwerk schon fertig war, mithin die Summe des Ganzen vom Dichter sozusagen im Nachhinein in einen „keimhaften“ Zustand zurückgeführt wurde. Hier handelt es sich jedoch nicht um einen wissenschaftlichen, sondern künstlerischen Reduktionsprozeß. Damit unterlag auch das maere den durch Reduktion bedingten Gestaltveränderungen, bei denen die logischen Beziehungen nicht „evident“ m.a.W. auf der Hand liegen, sondern nur „morpho-logisch“ zu deuten sind. Im Fachausdruck der Biologie schwingt die Vorstellung von etwas Zukünftigem mit, das noch gar nicht als Stengel, Blatt oder Blüte einer Pflanze wirklich da ist, über das man aber, im Vorgriff auf das Kommende sagen kann, es sei ein „gestauchter Sproß“, d.h. in anderer Form bereits vorhanden. Die logische Schwierigkeit in der Biologie besteht darin, daß man eigentlich nur das „stauchen“ kann, was zeitlich vorher schon da gewesen sein muß. Dieses logische Problem besteht in bezug auf den Parzivalprolog nicht, weil man davon ausgehen kann, daß der Prolog entstand, als der Roman tatsächlich schon abgeschlossen war. Der Parzivalprolog hat also eine morphologische Struktur: in ihm ist die ganze „aventiure“ keimhaft angelegt, nicht bloß als Möglichkeit, sondern in Bildern „verdichtet“. Die aventiure ist im Prolog - in reduzierter Form - als Verhüllung des Ganzen schon wirklich vorhanden. Die „Schleier“ fallen im Verlauf der Geschichte nicht nur einfach ab, damit man etwa sehen kann, was sie verbergen. Die bildhaften Formen „enthüllen“ sich vielmehr inhaltlich als etwas anderes, als was sie „vorher“ zu sein schienen; so, wie bei der Zwiebel „Schalen“ (Hüllen) in einem Gestaltwandel zu Stengeln und Blättern werden. In seiner komprimierten, programmatischen Form wurde der Prolog, nachträglich als Reduktion der Komplexität des Ganzen, an den Anfang gesetzt. Dem Philologen mag sich das Bild der „Hülle“ (Form) über die Silbe „vel“ (Wortteil von „zwî-vel“) erschließen, als die im Lateinischen häufig benutzte Abkürzung für „velum“ (lat. Hülle Vorhang, Tuch, Abkürzung für „velatum“, lat. der Schleier der Frau, oder „velamentum“, lat. Hülle).
Wenn der „zwîvel“ (u.a. Worte des Eingangs) eine morphologische Einheit von Bildern, Begriffen, Assoziationen ist, handelt es sich um eine Konzentration von Sinn und Form in einem noch „vorläufigen“, noch nicht ganz entfalteten Zustand, m.a.W. um ein noch „unentfaltetes“ Wortbild im Sinne eines Urwortes, d.h. „Logos“. Dieser hat nach einem organo-logischen Vorverständnis nicht nur zeichenhaft etwas zu bedeuten, sondern ist nach Inhalt und Form selbst etwas : künstlerische Realität.
Aus methodischen Gründen sollen die „umständlichen“ Überlegungen über die Beziehung von gesprochenem und geschriebenem Wort, die durch die spätere Entdeckung der getrennten Schreibweise (s.S. von „nach gebur“ in den Handschriften (einen Urtext gibt es nicht) überflüssig geworden zu sein scheinen, in ihrer Form so belassen werden, wie sie hier vorgetragen wurden. Die akustische Analyse verdankt ihre Entstehung primär einem spontanen Gefühl des Unbehagens wegen der bisherigen Übersetzungen von „nâchgebûr“ im Eingang des Prologs. Trotz aller Kritik muß man anerkennen, daß der Text auch im zusammengesetzten Wort „nâchgebûr“, wenn man es als „Nachbar“ übersetzt, in seiner Substanz erhalten bleibt, so daß man auch in diesem Fall seinem hintergründigen Sinn auf die Spur kommen konnte.
Die von Lachmann zuerst vorgenommene Zusammenziehung von „nah“ und „gebur“ zu einem Wort „nâchgebûr“ ist unter dem Gesichtspunkt der Texttreue zumindest fragwürdig, ebenso wie die Deutung, „daß der Zweifel dem Herzen benachbart ist“ nicht ganz überzeugend ist. Anhand der als Anlage beigefügten Faksimilekopien kann man außerdem feststellen, daß das Wort „zwîvel“ in den Handschriften nicht mit Dehnungszeichen über „i“ („accent circonflex“) versehen ist und in den überwiegenden Fällen statt mit „v“, mit „f“ geschrieben wird (Ulzen, 1974, S. 38 siehe Zusammenstellung).
6.1 Die Herzmitte des Eingangs
Nachdem also der zwîvel-Begriff durch seine bildhafte Deutung im o.a. Sinne relativiert und an seiner Stelle das Herz in die Mitte des Interesses gerückt wurde, kann man nicht umhin, dem Herzbegriff Wolframs besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Wegen seiner Komplexität können die Überlegungen hierzu im Rahmen der vorliegenden Studie nur unvollständig sein. Sie mögen deshalb eher als Richtungsangabe denn als Analyse verstanden werden. In den wesentlichen Punkten kann man sich auf bereits vorliegende Forschungsergebnisse zum Herzbegriff stützen. Die besondere Absicht ist hier, den Begriff des Herzens mit dem des „art“ in Wolframs Konzept in Verbindung zu bringen. Gemeint ist damit die fiktive „Auserwähltheit des Anschewingeschlechtes“, in der einerseits das historische „Prinz-Sein-von-Geblüt“ der Mitglieder des Hauses Anjou parodiert, andererseits eine dichterische Fiktion für eine christliche Existenz in dieser Welt geschaffen wird. Nach seiner Taufe ist Feirefiz, als alter ego Parzivals, der Prototyp dieser Fiktion.
Es gibt eine Reihe von Untersuchungen zum Herzbegriff als Einzelstudien und im Zusammenhang der Gesamtdeutung mittelalterlicher Literatur. Die wichtigste Arbeit auf diesem Gebiet stammt von Xenia von Ertzdorff (1996) mit dem Titel: „Das Herz in der lateinisch-theologischen und frühen volkssprachigen religiösen Literatur.“ Es ist die überarbeitete Fassung ihrer Dissertation „Studien zum Begriff des Herzens und seiner Verwendung als Aussagemotiv in der höfischen Liebeslyrik des 12. Jahrhunderts“. Wie der Titel und die in der Fußnote referierte Kritik belegen, handelt es sich hier nicht um eine Analyse des Herzbegriffs im Parzivalprolog oder bei Wolfram von Eschenbach, sondern um eine Untersuchung allgemeiner Art über die Stellung des Herzens in der Literatur des 12. Jahrhunderts.
„Was Gottfried unter dem Begriff ‘herze’ versteht, ist bisher im Rahmen der Gesamtdeutung seines Werkes zutreffend gewürdigt worden. Der Versuch, Gottfrieds ‘herze’ im Zusammenhang mit der zeitgenössischen religiösen Mystik zu deuten, ist (jedoch) daran gescheitert, daß der Begriff ‘herze’ zu sehr in Gegensatz zu anderen psychologischen Termini gesehen und die Tradition , in der dieser Begriff steht, nicht richtig erkannt wurde.“ (v. Ertzdorff, 1996, S. 22) Ein kritischer Nachsatz im o.a. Zitat bezieht sich besonders auf drei frühere wissenschaftliche Arbeiten (Dissertationen), die sich mit dem Thema „herze“ beschäftigen: „Die lateinische Tradition des Begriffs haben sie jedoch zu wenig berücksichtigt und sind daher nicht zum eigentlichen Kern des Begriffs ‘Herz’ durchgestoßen“ (v. Erztdorff 1996, S. 22)[12].
Die „Auserwähltheit des Geschlechtes der Anschewin“ hat mit der ersten Inkarnation des Menschen zu tun, wie Wolfram sie im Trevrizentgespräch als Geburt aus der Jungfrau, der Mutter Erde, darstellt. Diese Erschaffung des ersten Menschen aus Erde („materia“, Mutterstoff) hat bei Wolfram die Dignität einer Menschwerdung, deren Natur von Anfang an eine „anima naturaliter christiana est“ (Augustinus). Es bedeutet, daß nicht nur Gott Vater, sondern die Hl. Dreifaltigkeit als Einheit im Schöpfungsvorgang tätig war: „Nun sprach Gott: „Laßt uns den Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich“ (Gen. 1,26) „Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau erschuf er sie “ (Gen. 1,27).
Am Verhalten der gefallenen Engel kann man ablesen, daß Gott nach der Lehre der Väter den Menschen - auch im Hinblick auf die kommende Menschwerdung des Logos - in besonderer Weise mit Gnadengaben ausgestattet hatte, deren höchste die Zusage Gottes war, selbst einmal in der Gestalt eines Menschen unter ihnen wohnen zu wollen. Dies erregte den Neid der Engel. Sie konnten bzw. wollten als Engel den Willen Gottes nicht akzeptieren, denn dann mußten sie im Prinzip vor einem Menschen, der in der Schöpfungsordnung weit unter ihnen stand, als reine Geister auf die Knie fallen und ihn (Jesus als Mensch!) anbeten.
Wenn hier die Meinung vertreten wird, daß der Herzbegriff bei Wolfram eine andere religiöse Dimension hat als bei Gottfried v. Straßburg, so gilt doch für beide mittelalterliche Autoren, daß sie in der Verwendung ihrer Herzbegriffe in einer griechischen und lateinisch theologischen Tradition stehen. Diese wird von der zitierten Autorin aufgearbeitet. Die Ergebnisse ihrer Arbeit sind hier die Basis der weiterführenden Gedanken in bezug auf die Deutung des Herzbegriffs bei Wolfram. Nach der Aussage von Erztdorffs ist es nämlich nicht „Gottfrieds künstlerisches Genie allein, das für das ‘herze’ eine so große Bedeutung erfand, wohl aber ist es seine Leistung, daß er ihm eine so große Aussagefähigkeit für das höfische Menschentum zuerkannte“ (1996, S. 22).
Wenn es Gottfried gelang, „die Tradition, die diesen Herzbegriff bildete [...] mit neuem Gehalt“ höfischer Art zu erfüllen, so wird hier darzustellen sein, wie Wolfram es versteht, eine Tradition, welche auf die Theologie der „Kirchenväter“ und Konzilien zurückgeführt werden kann, durch eine dichterische Neukonzeption für seine Zeit in einer neuen Form so zu aktualisieren, daß sie einer christlich ritterlichen Gesellschaft, die sich religiös gesehen als pilgerndes Volk Gottes auf Erden versteht, eine vertiefte und neue Dimension christlichen Selbst- und Weltverstehens eröffnen konnte. Wolfram hat also zugleich die Tradition selbst neu belebt und ihr darüber hinaus im höfischen und heilsgeschichtlichen Sinne einen zeitgemäßen literarischen Ausdruck verliehen.
Der Nachweis für diese These kann dann gelingen, wenn man den Herzbegriff des Prologs aus dem Gesamtzusammenhang des Parzivalromans interpretiert. Er steht in einem innigen poetischen Verhältnis zum Begriff der „Inkarnation“, für den Wolfram eine besonders auffallende dichterische Variante erfindet: Die Vorstellung von zwei Arten jungfräulicher Menschwerdung und Geburt. Der Einsiedler Trevrizent berichtet (an Stelle des Dichters) darüber seinem Neffen Parzival im neunten Buch des „Parzival“. Diese dichterische Idee mag von der offiziellen Lehre der Kirche abweichen, gemäß der Lehre der „Väter“ über die „Vorgeschichte“ der Erbsünde im Himmel ist sie aber keineswegs häretisch. Lassen doch diese dichterischen Fiktionen erkennen, daß im Unterschied zur lateinisch-theologischen (und damit auch klassisch-griechischen) und alttestamentarisch-biblischen Tradition ein durchaus neutestamentarischer Gedanke in den alten Bericht von der Erschaffung des ersten Menschen eingeführt wird. Es ist ein neuer trinitarischer Gedanke, der gegen die häretische Lehre des Abtes Joachim von Fiore gerichtet sein könnte. Seine Lehre von den drei Zeitaltern (des Vaters, des Sohnes und des Hl. Geistes) erwartete den Anbruch der mönchischen Geistzeit für das Jahr 1260. Diese Trinitätslehre wurde nach seinem Tode verworfen. Sie entsprach als Lehre von den drei (getrennten) Reichen nicht der kirchlichen Lehre vom Wesen des dreifaltigen Gottes[13].
Man könnte hier die Frage stellen: Was hat der Herzbegriff mit Inkarnation und Dreifaltigkeit zu tun? Der Herzbegriff Wolframs steht zwar in einer lateinisch-theologischen und vor allem biblischen Tradition, wurde aber, nicht zuletzt unter dem maßgeblichen Einfluß augustinischen Denkens, dichterisch aus neutestamentarischer Sicht überformt. Für den Parzivalroman bedeutet dies beispielsweise, daß die Menschwerdung des Logos schon mit der Erschaffung Adams beginnt bzw. in einem engen Verhältnis zu ihr steht. Durch die Idee einer zweiten jungfräulichen Geburt, der Geburt Adams durch die „jungfräuliche Mutter Erde“, gelingt es Wolfram, der ersten Erschaffung des ersten Menschen vom religiösen Begriff der Inkarnation des Logos her, eine unerhörte Bedeutung zu geben. In dieser dichterischen Fiktion wird die Leiblichkeit („Inkarnation“ „Fleisch“-Werdung der Seele im Leib) als menschliche Natur a prori sanktioniert: anima naturaliter christiana est. Dahinter steht der Gedanke, daß nicht nur Gott Vater den Menschen erschaffen hat, sondern der Dreifaltige Gott. Wenn Gott also Adam, sein Geschöpf, nach dem eigenen Bilde erschaffen hatte, so mußte das an diesem Bild wahrnehmbar sein. Das leibhaftige Menschenbild des „Parzival“ ist also „dreifaltig“; äußerlich erkennbar als dichterische Fiktion in der Zuordnung der drei Figuren Gâwân-Feirefiz-Parzival zu dem einzigen Helden des Romans „Parzival“.
Der Inbegriff menschlicher Leiblichkeit, das Herz, ist vor diesem Hintergrund auch als Sinnmitte des Eingangsverses zu betrachten. Es sollte anstelle des „zwîvels“ in den Mittelpunkt des Interesses gerückt werden. Der Begriff des Herzens gehört, wie Max Wehrli mit Recht sagt, mit noch einigen anderen „einfachen“ Wörtern, wie „minne“ und „frouwe“ zu einem Katalog mittelhochdeutscher Wörter, die man eigentlich nicht übersetzen kann. Das ist besonders erstaunlich; könnte man doch meinen, das Wort „herz“ habe damals wie heute denselben Sinn. „Herz“, wie wir es heute verwenden, hat nicht annähernd die Fülle wie im 12. Jahrhundert. Den Bedeutungsverlust zwischen damals und heute kann man nur ahnen.
Die Ambivalenz des biblischen Herzbegriffs wird schon in den ältesten Büchern der Hl. Schrift offenbar. Im ersten Buch Moses 8,21 steht: „das Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend an“. Im 5. Buch Moses 6,5 heißt es von demselben Herzen: „den Herrn [...] liebhaben von ganzem Herzen“. Gerade auch diese biblischen, ambivalenten Vorstellungen gehören mit zum fiktiven Bild des menschlichen Herzens, das Wolfram entwirft.
Wenn man nun den ersten Vers des Parzivalprologs so übersetzt: „Ist die Verzweiflung dem Herzen nahe, so bringt das die Seele in Bedrängnis,“ wird damit vorab entschieden, daß das Herz gut und der „zwîvel“ schlecht ist. Daß das Herz im biblischen Sinn selbst gespalten, d.h. „gezwîvelt“, also in eigener Kompetenz „böse“ oder „gut“ sein kann, wird damit übersehen. Es ist zwar nicht ohne weiters einzusehen, aber Gut- und Böse-Sein sind im biblischen Sinn zwei Seiten ein und derselben Medaille. In dieser Tradition steht Wolframs Herzbegriff. Seine besondere Qualität erhält er dadurch, daß er im Kontext mit dem neutestamentarischen Begriff der „Inkarnation“ des „Logos“ zur Vorstellung einer „ersten Inkarnation“ im Schöpfungsprozeß des ersten Menschen verbunden ist. Diese besondere „Dichte“, d.h. seine ausgesprochen poetische Struktur, ist Wolframs ureigene Leistung. Gemeint ist damit die gleichzeitige „Versinnlichung“ und „Spiritualisierung“ des Herzbegriffs. Sie wurde dadurch erreicht, daß er die eher stoffliche bzw. physiologische Seite einer konkreten Herzvorstellung dadurch eliminiert, daß er sie mit der Erschaffung des ersten Menschen „Adam“ (Mann aus Erde) durch Gott selbst verbindet, der ihm SEIN Leben einhauchte und dadurch den „handwerklichen schöpferischen“ Vorgang a priori „sanktionierte“: Das Herz hat an der Spiritualität der „materia“ überhaupt teil: als die „Materie“, die im göttlichen Schöpfungsprozeß zum „Mutterstoff“ für die Vereinigung seelischen Geschehens mit der Materie wird. Das „Herz“ wird dadurch zum Symbol und Zentrum der Leib-Seele des Menschen. Wolfram spricht von der „jungfräulichen Mutter Erde“ (463,25-464,13), die durch den Odem des Schöpfergottes beseelt und damit zur Einheit von Körper und Seele, zum „lîp“ wurde. Dieser lîp ist bei Wolfram der Prototyp der Einheit von Verschiedenem, von Natur und „Übernatur“. Im Begriff des Leibes wird bei ihm stets die qualitative (nicht additive) Einheit von Leib und Seele vorgestellt. Das Herz ist das leib-seelische Zentrum dieser Einheit.
Mit „Übernatur“ ist nicht etwa die Seele des Menschen gemeint, sondern seine „iustitia originalis“, die ihm im Schöpfungsprozeß verliehen wurde. Gott konnte „diese Gerechtigkeit dem ersten Menschen bei seinem Ursprung eingießen und ein Gesetz erlassen, kraft dessen dieselbe mit der Natur in der Zeugung auf seine Nachkommen übergehen sollte “ (S. 191).[...] „So aufgefaßt, erscheint die Vererbung der ‘iustitia originalis’ als ein die Zeugung der Natur begleitendes Fortwehen des Heiligen Geistes im Menschengeschlechte, ein Fortwehen, das sich zwar an die Fortpflanzung der Natur anschmiegt, aber nicht in der Natur wurzelt, und das eben in seiner Anschmiegung an die Natur sich als ein neues großes Mysterium offenbart“ (Matthias Joseph Scheeben, 1958, 3. Aufl., S. 191).
Im Schöpfungsprozeß entstand also das, was Wolfram den „art“ des Menschen nennt. Gemeint ist jene „Art“ des Menschengeschlechtes, die den Engeln gegenüber dadurch ausgezeichnet ist, daß sie einerseits zwar auf der „niedrigeren“ Stufe in der Seinsordnung steht, andererseits aber der „iustitia originalis“ teilhaftig war. Sie war der Grund, weswegen er zu „sündigen wagte“[14], d.h. aufgrund von zugestandener Freiheit „Nein“ sagen konnte, ohne das Risiko einzugehen, dafür ewig bestraft zu werden, wie die oppositionellen „Engel“. - Als Menschengeschlecht wurde es noch dadurch bevorzugt, daß Gott nach dem Sündenfall seinen Sohn als „zweiten Adam“ bei diesem „sündigen“ Geschlecht und nicht bei den Engeln hatte Wohnung nehmen lassen. Daher heißt es auch im Anfang des Prologs und des „vliegenden bîspels“: „der mac dennoch wesen geil: wande an im sint beidiu teil des himels und der helle“ (1,8-10). Wenn Wolfram von „art“ spricht, sind, wie oben angeführt, die Ideen aus der Väterlehre im Hintergrund immer präsent. Dieser spezifische „Natur“- und Herzbegriff, die miteinander in enger Beziehung stehen, gehen weit über das hinaus, was man sich heute dabei vorstellen kann. Insofern ist das Bild des Herzens, in dem die Gestalt des Helden am „Anfang als Wort“ erscheint, das wichtigste des Eingangs. Aus der Perspektive des Gesamtromans repräsentiert bereits das Herz im Prolog die Idee und die Fiktion des „auserwählten Volkes“, die im dichterischen Bild des Anschewingeschlechtes und seines Protagonisten Feirefiz (als das „alter ego“ Parzivals) für das Konzept des Romans von grundlegender Bedeutung sind. Die erweiterten Ausführungen zum „herzen“ sind vor diesem Hintergrund zu sehen.
Im Neid der gefallenen Engel auf die Menschen liegt bei Wolfram das Urmotiv sowohl der Hybris als auch des Neides. Auf die Geschichte der Menschheit übertragen war dessen direkte Folge der erste Tod in der Geschichte überhaupt, der Brudermord an Abel. An dieser Schuld Kains wird die Ursünde als härteste Konsequenz für die ersten Menschen erkennbar, als Zusammenhang von „Ursache“ und Wirkung.
Trotz dieser Verflechtungen oder sogar wegen dieser Schuldzusammenhänge ist die Menschheit ein „Auserwähltes Geschlecht“. „O, felix culpa“, heißt es in der Osterliturgie, „die uns einen solchen Erlöser beschert hat“. Wolfram sagt: „der mac dennoch wesen geil: wande an im sint beidiu teil, des himels und der helle“ (1,7-9). Im Verlauf des maere entwickelt sich aus dieser Sicht des Menschen die Vision bzw. das fiktive auserwählte Geschlecht der Anschewin, deren vornehmster Vertreter Feirefiz ist. „Heidnisch“ heißt nicht antichristlich. Der Begriff ist im Sinne des Romankonzeptes als eine „vor- bzw. urgeschichtliche Vollkommenheit“ zu verstehen.
Die „natürliche Christlichkeit“ (der „art“) zeichnet jeden Menschen als Geschöpf aus. In dieser vor- und heilsgeschichtlichen „Natürlichkeit, die mit dem Begriff von Natur als innerweltlicher Erscheinung nur am Rande zu tun hat, liegt die Exklusivität der Wolframschen Vorstellung von der „Natur“ des Menschen überhaupt. Das gilt in besonderem Sinne für den Heiden Feirefiz, der aus der „Vorgeschichte“ kommend die Bühne des Romangeschehens betritt. Er ist gerade nicht heidnisch im Sinne von „ungläubig“, obwohl nicht getauft! Die Ungläubigen schlechthin sind die Antichristen, jene, welche die Dreifaltigkeit Gottes leugnen und bekämpfen. Zu Wolframs Zeit war der Antichrist in Person Mohammed, der sowohl die Gottessohnschaft Jesu als auch die Dreifaltigkeit Gottes leugnete. Seine Anhänger sind deswegen „Antichristen“ und werden als solche Sarazenen, nicht Heiden genannt. „Heiden“ sind sie insofern, als sie, wie alle Menschen, an der menschlichen „Natur“ im o.a. Sinne teilhaben. Deshalb sind sie sogar als Ungläubige (Sarazenen) dennoch „Gottes handgetat“, wie Gyburc in ihrer sog. Toleranzrede sagt. Auch diese „heiden“ haben an der ursprünglichen Würde aller Menschen teil. Nichtsdestoweniger müssen sie nach Wolframs Meinung, wie dies durch Gyburc und Willehalm zum Ausdruck gebracht wird, bekämpft werden, weil sie das Christentum „niedertreten“ wollen:
„nu wêret êre unde lant daz Apollo und Tervigant und der trüegehafte Mahmet uns den touf icht under tret“ (Willehalm 17,19-22).
Dieser Unterschied zwischen dem Begriff „heide“ als „Auserwählter“ und „heide“ als Ungläubiger bzw. „Antichrist“ (Sarazene) ist für das Verstehen des Parzivalromans und des Willehalm unerläßlich. In bezug auf ihre durch den Schöpfungsprozeß bedingte leib-seelische Urverfassung haben jedoch Gläubige und Ungläubige, d.h. Christen und Muslime, a priori die gleiche Dignität: Sie sind Menschen aus der Hand Gottes. In diesem Sinne und im Gegensatz zur griechischen Auffassung erfuhr der Begriff des Herzens besonders durch Augustinus seine besondere gefühlsmäßige und biblisch-theologisch fundierte Ausprägung. Hierauf gründet sich Wolframs Verständnis. Es steht in Übereinstimmung mit dem biblischen Herzbegriff.
Wenn man alle Bibelstellen im AT wie im NT untersucht, in denen vom Herzen die Rede ist, bemerkt man immer wieder die Ambivalenz, die dem Begriff des Herzens anhaftet. Diese Zweideutigkeit des mit dem „Herzen“ verbundenen Verhaltens prägt nicht nur die biblischen Geschichten, sondern ist das Urmodell für das Verhalten des Romanhelden im Parzival.
Besonders wichtig ist, daß dabei der augustinische Herzbegriff, im Gegensatz zur späteren mittelalterlichen Diskussion (Luther), einen gewissen Freiheitsspielraum christlichen Handelns bzw. Mitwirkens am Heil erkennen läßt: Durch Erziehung soll der Mensch dazu befähigt werden, seine Freiheit zu gebrauchen. Genau auf diesen Spielraum von Freiheit und Schicksal reflektiert Wolfram in seinem „Parzival“. Er steht im Zentrum höfischer Erziehung und christlichen Tugendstrebens; denn wo keine Freiheit möglich ist, gibt es auch keine Tugend.
Die Schwerpunktverlagerung im Eingang des Parzivalprologs vom „zwîvel“ auf den Herzbegriff kann also neben gefühlsmäßigen Gründen auch mit vernünftigen Argumenten, soweit sie sich aus dem Gesamttext belegen lassen, vertreten werden. Das erforderte eine eingehendere Analyse des Herzbegriffs. In fast allen Interpretationen wurde bisher der „zwîvel“ als das „Hauptwort“ des Eingangsverses schlechthin behandelt. Es ist ein Wort, das in Gewicht und Stellenwert dem „herzen“ unter- oder nebengeordnet sein sollte.
Auf eine bewußte und gewollte „Interpretation von oben her“, z.B. durch die „bloße Anwendung christlicher Lehre“ (Wehrli, 1954, S. 39), konnte man verzichten, weil es sich beim Herzbegriff um einen gewichtigen zentralen anthropologisch-biblischen Begriff handelt, wie er sich im Laufe einer langen Wortgeschichte von der Antike bis in das 12. Jahrhundert herausgebildet hatte. Er verdient damit größere Aufmerksamkeit als der - auch vom „Gregorius“ her – negativ aufgeladene „zwîvel“-Begriff.
Das Herz zählt nicht nur zum „Grundvokabular“ Wolframscher Dichtung, sondern auch zu dem der Bibel, weshalb ihm besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. Während die Wörter „Zweifel“, „zweifeln“ und „Zweifler“ nach der „Wortkonkordanz zum revidierten Luthertext“ („Bibel von A bis Z“, 1969) zusammen nur zehn Mal in der Hl. Schrift erscheinen, gibt es allein für das „Herz“ einhundertneununddreißig Texthinweise.
Diese Zu- und Unterordnung des „zwîvels“ zum „herzen“ nimmt dem Wort selbst nichts von seiner elementaren Bedeutung, die es als eine rein religiöse Vorstellung - unabhängig vom Gregoriusprolog - beanspruchen könnte. Wenn Bumke ausdrücklich vermerkt, daß der „zwîvel“ im ganzen Roman nie wieder die Bedeutung erhält wie im Eingangsvers, so ist dem ausdrücklich zuzustimmen, unabhängig davon, ob er dem Herzbegriff unter oder übergeordnet ist. Die Forschung hat „auf den ‘zwîvel’ als Kennwort der Parzivalhandlung nicht verzichten wollen“, obwohl Schneiders Interpretation der Eingangsverse „ sich darauf berufen kann, daß Parzivals Verfehlungen nirgends mit dem „zwîvel“ in Verbindung gebracht werden“ (Bumke, 1970, S. 126). Man kann zwar mit Recht der Meinung sein, der „zwîvel“ habe im Kontext des Eingangs eine ganz besondere Bedeutung. Die innere Parzivalhandlung wird jedoch durch das biblische Bild eines zwiespältigen menschlichen Herzens gekennzeichnet und nicht durch den abstrakten Begriff des „zwîvels“.
6.2 „gesmaehet unde gezieret ist, swâ sich parrieret unverzaget mannes muot“
Das bisher Gesagte bezog sich ausschließlich auf den Eingang des Prologs. Die im ersten Doppelvers (1,1-2) durch den Dichter vorgenommene Situationsanalyse, die gleichzeitig auch Exposition des Ganzen ist, erfährt in den anschließenden Versen eine nähere Erläuterung. Sie bildet dem Sinn nach mit dem Eingangsvers eine gedankliche Einheit:
„gesmaehet unde gezieret ist, swâ sich parrieret unverzaget mannes muot, als agelstern varwe tuot" (1,3-6)
In einer heftigen Hin- und Herbewegung, ohne sich die Zeit zum Atmen zu erlauben, von einem Vers in den nächsten stürzend, durch die Synkopen vorangetrieben, endet diese Versgruppe, „per Saldo“, mit dem gewichtigen Satz: „als agelstern varwe tuot“. Dieser Satz steht, wie schon die vorhergehende Analyse zeigte, in größter Nähe zum ersten Doppelvers und schließt den ersten Gedankenblock (1,1-6) des Eingangs ab, der sich wie ein Tor zum gewaltigen Bilder- und Gedankenkomplex des Romans nur dem öffnet, der die „Parole“ der Elster „Alles und Nichts“ kennt. Eine „Parole (ist) ein Losungswort, das Zugang zu etwas Abgeschlossenem verleiht“ (Andre Jolles, 1930, S. 134).
Nicht nur durch die Wortwahl (z.B. „parrieret", zu dem im folgenden noch eine eigene Überlegung angestellt wird), sondern auch durch die Anwendung eines besonderen Stilmittels - hier eines Enjambements - werden die Verse 1,3-6 aneinander geschmiedet, um sowohl ihren innigen Zusammenhang untereinander als auch ihre Bedeutung für den Eingangsvers zu unterstreichen:
„Verachtet und verehrt ist, was sich vereinigt (‘gepaart’) hat mit dem Tugendstreben des Mannes, so (zweifelhaft) wie die Elster ihre Farben auswählte.“
Die erste Absicht des Elsterngleichnisses war die Kennzeichnung des größtmöglichen denkbaren Gegensatzes von „Alles und Nichts." Ein solches Bildverständnis steht mit „zwîvel", definiert als „zwei arten habend", in einem ursprünglichen Zusammenhang. Das Herz, Sitz und Mitte aller Tugenden - auch des „unverzaget mannes muot“ - ist durch die Vereinigung (‘parrieret’) mit dem im „Eingang“ (1,1-2) Gesagten - also am Bösen und Guten teihabend - zugleich „verflucht und geehrt".
Wenn Wolfram hier von „parrieret" spricht, so steht diese Vorstellung wiederum in Beziehung zum Bild der Elster, an dem die „Paarung von Allem und Nichts", von gut und böse erkennbar war. Das gescheckte Gefieder ist nur die „oberflächliche" Bestätigung dafür, was im existentiellen Sinn gemeint ist. Daß diese Interpretation naheliegt, möchte ich belegen, aber zuvor noch einige Schwierigkeiten bereinigen, die das Wort „parrieret" selbst macht: Im „Original Lexer" steht unter „parrieren swv. = undersniden, mit abstechender Farbe unterscheiden, schmücken, verschiedenfarbig durcheinander mischen (mfz.parier)." Damit ist relativ wenig anzufangen.
Naohiko Tonomura (1971) untersucht in einem Aufsatz eigens die Bedeutung des Wortes „parrieren", um dann die „Frage nach dem Sinn des ganzen Abschnittes zu stellen" (1,1-14). Er hält fest: „Mhd. parrieren kommt von afr. pairier/mfr. parier, das aus pariare (gleichstellen >par<gleich) stammt [...] pairier;/parier bedeutet nämlich hauptsächlich >gleichstellen< und >paaren<. Mhd. parrieren scheint daher sowohl pariare>pairier/parier im Sinne von >gleichstellen< und >paaren< als auch parare/parer im Sinne von >schmücken< in sich zu kombinieren". An einer langen Reihe von älteren Übersetzungen weist Tonomura nach, daß parrieren von allen Interpreten - bis auf Knorr und Fink - als > sich verbinden < und > sich gesellen < verstanden wird (Tonomura, 1971, S. 154).
Daraus folgernd besteht Veranlassung, dies als seine Grundbedeutung zu akzeptieren, sie jedoch im Zusammenhang der o.a. Textstelle mit dem stärkeren Ausdruck, nämlich „paaren" zu gebrauchen. So läßt sich die Unwiderruflichkeit der entstandenen Verbindung stärker betonen, was sicher auch Wolfram im Sinn hatte. Wenn Tonomura meint, daß „sich parrieren von 1,4 [...] > sich bunt machen < bzw. > scheckig werden < bedeutet", so ergibt das in diesem Zusammenhang keinen Sinn.
Der „unverzaget mannes muot" steht nämlich in direkter Beziehung zur Sinnmitte des ersten und zweiten Verses Herz und Seele. Beide bilden je für sich wie ein Waagebalken den Dreh- und Angelpunkt ihres Verses, auch äußerlich erkennbar, und durch die Verbindung beider in Längsrichtung zum „unverzaget mannes muot“ hin eine Mittelachse, um die sich die Verse 3-6 hin-und her bewegen. Dieser erste Gedankenblock steht in völliger Harmonie vor uns und ist sogar graphisch darzustellen. Wegen seiner Möglichkeit zwischen „Alles und Nichts" zu wählen, hat der „ unverzaget mannes muot" seinen Halt bzw. Sitz selbstverständlich im Herzen bzw. in der Seele. Er bildet mit beiden auch eine Längsachse, um die sich die Geschichte in diesem chaotischen Umfeld ordnet.
6.3 „zwîvel“ im „herzen“ verbunden mit dem „unverzaget mannes muot“ - die Grundverfassung des Menschen
Die Einheit von Gut-Böse-Sein mit dem Herzen, d.h. auch mit dem „unverzaget mannes muot" ist derart, daß Wolfram davon spricht, beide seien miteinander „parrieret", „gepaart" oder „verheiratet“, und zwar so, wie es dem gegensätzlichen Handeln in bezug auf „Alles und Nichts" im Bilde der Elster entspricht: selbstverschuldet und schicksalhaft, gewollt und ungewollt in einem. - Deshalb ist der unverzaget mannes muo t mit beiden, dem Gut- und Böse-Sein des Herzens sozusagen „unauflöslich verheiratet“, bis „daß der Tod sie scheidet“. Tugendstreben ist so gesehen die lebenlange Aufgabe des Menschseins.
Aristoteles bestimmte „die Tugend formal als der Situation angemessenes Finden der jeweils richtigen Mitte, etwa die Tapferkeit als angenommene Mitte zwischen „Toll-Kühnheit“ und Feigheit, Besonnenheit als Mitte zwischen Askese und Zügellosigkeit." (dtv-Lexikon Stichwort „Tugend“) - In diesem Verständnis gibt sie den notwendigen Spielraum zwischen Freiheit und Notwendigkeit des Handelns, ohne den Tugend - nämlich „unverzaget mannes muot“ - nicht denkbar ist. Das ist dann allerdings mit dem Risiko verbunden, sich in der Welt, hier der höfischen Welt, für oder gegen Gott zu entscheiden.
Grundsätzlich scheinen hier, wie Bernard Willson meint, auch mystische Gedankengänge nahe zu liegen. Den „unverzaget mannes muot “ aber als „ Such- und Jagdmotiv", das „eine unbestreitbare mystische Grundlage hat" (Willson, 1960, S. 60), zu interpretieren, halte ich für gewagt. Das bekannteste Jagd- und Fluchtmotiv, und zwar im unmittelbaren Anschluß an den Eingang, ist doch das von Elster und Hase (in der Zuordnung von Raub- und Beutetier!), das man, auf dem Hintergrund des mystischen Spiegelvergleichs im Korintherbrief (1 Kor. 13,12), als irdisches Selbst-Erkennen-Wollen und Nichterkennen-Können verstehen kann: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel [...]“. Suchen und Jagen sind zwar auch charakteristisch für die Aventiure; der Zusammenhang, in dem hier unverzaget mannes muot erscheint, läßt jedoch eher darauf schließen, daß damit „Arete", d.h „die bei den Griechen ursprünglich hervorragende Tauglichkeit, dann allgemein Tüchtigkeit und Tugend" (dtv Lexikon) gemeint ist, die beim Menschen eine sittliche Haltung voraussetzt. Sie hat etwas mit „staete" („Aufrichtigkeit“) zu tun; die „unstaete" eher mit Schuldigsein. Weil beides für den Menschen nicht zu trennen ist, sagt Parzival am Ende eines langen Pilgerweges:
„ iedoch het ich niht missetân, ir het mich zorns etswenne erlân. done was ez et dennoch niht mîn heil: nu gebt ir mir sô hôhen teil, dâ von mîn trûren ende hât " (783, 13-17).
„Hätte ich jedoch keine Schuld auf mich geladen. hättet ihr mich mit eurem Zorn verschont, aber es wäre dennoch nicht mein Heil gewesen: Nun aber beschenkt ihr mich so reich daß all meine Trauer ein Ende hat."
Von diesem Ende des Parzivalromanes her ist zu verstehen, was Wolfram gleich im siebten Vers des Prologs in bezug auf einen göttlichen Heilsplan so ausdrückt:
„der mac dennoch wesen geil, wande an im sint beidiu teil, des himels und der helle" (1,7-9).
Dies ist, um in der Terminologie Wilsons zu bleiben, ein zweiter „Gedankenblock“, der theologische Überbau für die menschliche Existenz, die in den ersten sechs Versen dargestellt wurde. Die Frage, warum man denn, obwohl jeder Mensch böse und gut zugleich ist, noch froh sein kann und muß, läßt sich nur aus der heilsgeschichtlichen Perpektive Wolframs beantworten, und zwar im Rückgriff auf die Exegese Trevrizents im neunten Buch. Es hat mit dem Abfall der Engel von Gott, der Urschuld des Menschen und seiner Erlösung zu tun, sowie mit der Tatsache, daß der Mensch die Freiheit hat, zwischen gut und böse relativ „frei“ wählen zu können. Diese Zusammenhänge können an dieser Stelle - wo es um den Prolog geht - nur vorab angedeutet werden. Worin Wolfram ganz konkret menschliche Schuld erkennt und scharf kritisiert, geht aus seiner Enitekritik und der höhnischen Erec-Satire hervor, die auf pervertierte christliche Vorstellungen in Hartmanns Dichtung zielt.
6.4 Die Rätselbilder des Parzivalprologs - Probleme ihrer Übersetzung und Interpretation
Wie kann man bildhafte Assoziationen im Hintergrund eines Textes, wie etwa „zwei Felle, die das Herz umschließen, gleich einem Gefängnis“ (Vogelbauer) bei der Übersetzung berücksichtigen, so daß sein Bildhintergrund, der ja wesentlich zu seiner ganzheitlichen Gestalt gehört, überhaupt wahrnehmbar bleibt? Man muß noch hinzufügen, daß es sich ja nicht nur um flüchtige „Assoziationen“ handelt, sondern um Wortbedeutungen, die als Äquivokationen auch schwarz auf weiß erscheinen.
Selbstverständlich kann man den bildlogischen Hintergrund eines dichterischen Textes weder „wörtlich“ zitieren noch an seine Stelle setzen. Für Assoziationen, Indizien, Gefühle und Ahnungen hinsichtlich einer Bedeutung mögen sich konkrete Hinweise im Text finden, die auf einen bestimmten „Hintergrund“ schließen lassen. Doch diesen Bildhintergrund, der als Teil zur Ganzheit der Dichtung gehört, mit dem Text selbst zu verwechseln, wäre ebenso „sinnlos“ wie eine geglättete vordergründige Übersetzung. Erst im Zusammenspiel beider Ebenen läßt sich die Wirklichkeit eines dichterischen Bildes erschließen.
Um die Zwischenbemerkungen zusammenzufassen und die eigene Position deutlich abzugrenzen, möchte ich sagen: Die Überlegungen bewegen sich vorerst noch auf der Ebene der künstlerischen bzw. dichterischen Mittel. Hier ist zunächst nur die Frage gestellt, wie etwas gemacht wurde und nicht was ! Selbstverständlich bestimmen „zwei Felle“ und ein „Vogelbauer“ und darinnen das Herz, die hier in einer bestimmten Funktion im Hintergrund auftauchen, nicht allein die dichterische Aussage. Sie sind wie Pinsel, Farbe nur künstlerische „Mittel“ in der Hand des Malers bzw. Dichters.
Zu diesen Mitteln gehört auch die Polarisierung. So wird z.B. ein künstliches Chaos[15] dadurch verursacht, daß Wolfram die Spannung zwischen Begriff und Bild im selben Wort bis an die Grenze des „Un-Sinns“ treibt, nicht zuletzt, um auf diese Weise den „Widersinn“ des menschlichen In-der-Welt-Seins sinnlich spürbar zu machen: Zwei der drei wichtigsten Wörter des Eingangs, „zwîvel“ und „nâchgebûr“, sind auf extreme Weise „in sich selbst uneins“. Sie sind in ihrem Sinn durch Äquivokation gespalten. Ist etwa die eine Bedeutung „richtig“ und die andere „falsch“? Es dauert schon eine Weile, bis man bemerkt, daß ihre verschiedenen Bedeutungen einen gemeinsamen dichterischen Sinn haben.
Wie schon angedeutet, benutzt Wolfram die Zweideutigkeit solcher äquivoker Wörter als stilistisches Mittel. Unsicherheit verbreitend, umstellen sie das „herz“. Im Zentrum des Verses plaziert, wird dieses jedoch zum ruhenden Pol im dynamischen Prozeß der Sinngebung, m.a.W. zum Kristallisationspunkt für das erste dichterische Bild des Prologs: Das Herz des Romanhelden Parzival von „Allem“ und „Nichts“ umhüllt im Gefängnis der eigenen Brust.
Wolfram hat diesen Eindruck künstlich dadurch erreicht, daß er die beiden entscheidenden Wörter „zwîvel“ und „nâchgebûr“, die je für sich gleichzeitig verschiedenen logischen Ebenen angehören, der bild- und sachlogischen Seite des Verses zuordnete. Ihre Mehrdeutigkeit verdichtet sich um die „Herzmitte“ zum literarischen Bild. Dies ist nicht etwa ein Mangel, wie Gottfried es sieht, sondern eine neue dichterische „Methode“. Die ursprüngliche Offenheit des Textes wird, was seine Sinnfindung betrifft, durch jede noch so gute Übersetzung fast zwangsläufig beeinträchtigt. Die primär gewollte dichterische Zweideutigkeit wird, wenn man sie nicht als Stilmittel erkennt, u.U. nur noch als Mangel wahrgenommen.
Wenn eingangs gesagt wurde, daß der vorliegende Interpretationsversuch gewagt sei, weil man dabei u.a. gefühlsmäßig argumentiert und sich deshalb dem Risiko spöttischer Kommentare aussetzt, so wird diese Art „Teilhabe“ vom Text geradezu gefordert: Wer sich auf ihn einläßt, muß etwas riskieren, denn es geht auch um „Alles oder Nichts“, was seine Form betrifft. Wer es nicht wagt, „vom Boden purer Tatsächlichkeit abzuheben“, erfährt auch „nichts“ (1,15-16!).
Ein dichterisches Bild im Text ist nicht selten ein Rätsel. „Schwarz auf weiß“ ist es weder zu fassen, noch verstandesmäßig zu begreifen. Beschreiben lassen sich eigentlich nur die Bedingungen, unter denen es erscheinen kann und nur von solchen war bisher die Rede. Das subjektive Engagement im Umgang mit dem mhd. Text läßt sich durch Interpretation erleichtern, aber keineswegs ersparen. Diese Anteilnahme ist geradezu die Bedingung dafür, die aufs Äußerste gesteigerte Subjektivität des Künstlers, wie sie sich in der künstlerischen Form objektiviert, wahrzunehmen. Verstehen in diesem Sinne ist nur möglich auf einer mittleren, vermittelten und vermittelnden Ebene, wobei sich sprachlogische (begriffliche) und bildlogische (künstlerische) Seiten trotz der hier aufgezeigten unüberbrückbaren Differenzen in einem sinnfälligen dichterischen Bild „ergänzen“ können.
Zu den vorangegangenen Bemühungen um ein erweitertes Verständnis des Eingangs (1,1-2) sei es erlaubt, eine abschließende Bemerkung zu machen. Sie bezieht sich einerseits darauf, daß der Prologanfang hier als ein zu lösendes Rätsel interpretiert wurde, andererseits darauf, daß die Überlieferung von (1,1-2) in den überlieferten Handschriften selbst Rätsel aufgibt. Die Hypothese, daß der Anfang des Parzivalprologs vom literarischen Konzept her ein Rätsel sein soll, wird dadurch indirekt bestätigt.
Die impressionistische Interpretation der programmatischen Eingangsverse des Parzivalprologs war Grund genug, die eigene Position auch kritisch zu reflektieren. Um möglichen Einwänden zu begegnen, wurden erreichbare Übersetzungen, Kommentare und Nacherzählungen daraufhin überprüft, ob nicht der eine oder andere Interpret im Kommentar eine ähnliche gedankliche Spur hinterlassen oder Ähnliches angedeutet hätte.
Es gab zwar eine Reihe von guten Gründen für die eigene künstlerische Deutung des Eingangs. Die Annahmen standen jedoch auf einem literarisch noch schwankenden Boden. So hätte man z.B. mit bezug auf die Behandlung des Wortes „nâchgebûr“ aus dem Eingangsvers behaupten können, es sei von mir in einem bestimmten Sinne manipuliert worden. - Die Hoffnung, für die o.a. bildhafte Interpretation des Eingangs in der Sekundärliteratur einen Beleg zu finden, mußte ich fallen lassen. Bei der Suche stieß ich zuletzt auf die authentischen Quellen selbst, d.h. auf die Handschriften des Parzivalprologs aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, und zwar in der Form der bereits erwähnten Faksimiles von sechzehn Parzivalhandschriften, die von Ulzen zusammengestellt und mit Kommentar veröffentlicht worden waren.
Bei ihrem Studium überraschte mich, daß es „nâchgebûr“ im größeren Teil der ältesten Handschriften (aus dem 13. Jahrhundert) als ein Wort überhaupt nicht gibt. Eine Ausnahme bildet die Handschrift „D“ des „Parzival“. Es ist der „Codex St. Gallen 857“ (Schirok, 1985). Bei zwei von sechzehn vorgelegten Schriften fehlt der Eingangsvers vollständig. In sieben von nunmehr 14 verbleibenden, und zwar den ältesten Schriften, besteht „nâchgebûr“ eindeutig aus zwei getrennten Wörtern „nach“ und „gebur“ (mit kl. Variationen, wie z.B. „noch gebur“).[16] Auch in der Reproduktion des „Reise-Parzival“, „jenem von Lachmann auf seiner Bibliotheksreise im Jahre 1824 benutzten Exemplar des MYLLERschen ‘Parzivals’-Druckes von 1784“, gibt es kein zusammenhängendes Wort „nâchgebûr“. Der Text lautet: „Ist zwîvel hercen nah gebur.“ Warum Lachmann die beiden Teile zu einem Wort „nâchgebûr“ vereinte, ist nicht bekannt. Im Text taucht es nie wieder auf; ganz abgesehen davon, daß bei der regelmäßigen Bildung „nâch-bûr“ (swstm. der in der nähe wohnende, der anwohner, nachbar siehe Lexer, 1992) auch dort die Silben des Wortes durch Bindestrich getrennt sind. Übersetzer und Interpreten umschrieben, übersahen oder „glätteten“ es, weil es als Störfaktor empfunden wurde.
Die getrennte Schreibweise von „nach“ und „gebur“, m.a.W. die Tatsache, daß es sich immer schon um zwei getrennte Wörter handelte, läßt sich in sieben (plus 2) von sechzehn Handschriften eindeutig belegen. Daß in den anderen Handschriften die zur Diskussion stehenden Teile von „nâchgebûr“ im Schriftbild „vereint“ sind, heißt nicht, daß sie auch zusammengeschrieben sind und eine Sinneinheit bilden müssen. In der Kunstschrift gibt es Regeln, nach denen jeder mittelalterliche Schreiber arbeitete. Wer sich auskennt, weiß, daß von Einzelbuchstaben mit starken Rundungen, wenn sie denn im Text aufeinanderstoßen, im Schriftbild negative Wirkungen ausgehen können: es entstehen Lücken. Sie treten dann auf, wenn man sich beim Schreiben rein mechanisch an immer gleiche Abstände der Buchstaben hält. Um also unschöne Löcher im Schriftblock zu vermeiden, muß man bei stark gerundeten Buchstaben, wenn sie unmittelbar nebeneinander auftauchen, den Abstand zum vorhergehenden bzw. nachfolgenden deutlich verringern - wie im vorliegenden Fall die Mittellänge des kleinen „g“ - um optisch den Eindruck eines gleichen Abstandes zu erreichen. Wenn des Schriftbildes wegen zwischen „nach“ und „gebur“ keine Lücke entstehen soll, muß das „g“ von „gebur“ näher als im Normalfall an das vorhergehende „ch“ des Wortes „nach“ herangerückt werden. Wie dicht das möglich ist, sieht man in den Faksimiles vergleichsweise bei den im Text kurz darauf folgenden Worten „vliegende“ (1,15: „diz vliegende bîspel“) und „mugens“ (1.17: „sine mugens niht erdenken“). Das ist jedoch bei dem aus den Originaltexten als „nâchgebûr“ transkribierten Wort nicht so. Demnach handelt es sich bei „nach“ und „gebur“ in Wirklichkeit um zwei verschiedene Wörter. Meine Interpretation, die aufgrund der akustischen Analyse des Textes von zwei verschiedenen Wörtern in „nâchgebûr“ ausging, wird also durch das wirkliche Vorhandensein von zwei Wörten in den ältesten Handschriften bestätigt. Diese Annahme führte, wie ich sie bereits ohne Kenntnis der Originale bei der akustischen Interpretation des Textes zugrunde gelegt hatte, zu einer anderen Deutung von „nâchgebûr“ und „zwîvel“.
Durch diese Sachlage hat sich die Basis meiner Thesen durchaus verbessert: War man für die Interpretation bisher auf sein eigenes Sprachgefühl und die Akzeptanz anderer angewiesen, so kann man sich nunmehr darauf berufen, daß der hypothetische Urtext (ein Original gibt es ja nicht!) mit hoher Wahrscheinlichkeit im Eingangsvers nur zwei getrennte Worte kannte: nah und gebur. Dehnungszeichen, wie sie in den Transskriptionen heute verwendet werden, sind ebenfalls nicht zu finden. Wenn „nâchgebûr“ als ein zusammengetztes Wort in den meisten überlieferten Handschriften gar nicht vorkommt, darf man zumindest vermuten, daß die getrennte Schreibweise („nah“ und „gebur“) auch einen anderen Sinn haben könnte, als ein - ein für allemal - semantisch fixiertes „Nachbar“.
Gilt die allgemeine Regel aus dem „Mittelhochdeutschen Taschenwörterbuch“, („Original-Taschenlexer“), daß die Silbe „ge“ „vor subst. adj. adv. und verben mit dem begriffe des zusammenfassens, abschließens“ (Lexer, 1992) treten kann, dann kann „gebur“ auch als „bur“ im „abschließenden“ Sinne durch „ge“ verstärkt, als „Käfig“ (bzw. „Vogel-Bauer“) verstanden werden. Damit ist durch Rückgriff auf die Handschriften des 13. Jahrhunderts der mögliche Vorwurf, sich nicht an den Text gehalten zu haben, entkräftet. Es ist zu vermuten, daß „nâchgebûr“ u.U. eine mißverständliche Übernahme ist, womit viele Schwierigkeiten der Verständigung über den Parzivaleingang erst ihren Anfang nahmen. Dieses Wort wurde damit zu einer Verständigungsbarriere. Meines Erachtens hätte sich „gebur“ als Einzelwort leichter als „Bauer“ (als Gefängnis) zu erkennen gegeben und mit dem „zwîvel“ als „Umhüllung“ („Zwei-Fell“) des Herzens zu dem dichterischen Bild des im „Brustkorb“ (als „naheliegendem Vogelbauer“) eingesperrten menschlichen Herzens vereinen lassen. Unter (fast) völligem Verzicht auf philosophische und theologische Spekulationen konnte aus dem Gegensatz von gesprochenem und geschriebenem Wort ein erweiterter Sinn der programmatischen Eingangsverse des Parzivalprologs nachgewiesen werden.
Das Hauptproblem bestand darin, im Versgefüge die beiden schwergewichtigen Wörter „zwîvel“ und „gebûr“ mit dem „herzen“ in einen plausiblen Sinnzusammenhang zu bringen. Daß „die Verzweiflung der Nachbar des Herzens“ sein soll, kann als „vorläufiges“ Verständnis akzeptiert werden. Wenn man dagegen die äquivoke Bedeutung von „zwî-vel“ (als zwei-„vel“ = doppelte Umhüllung; „vel“=velum) ebenfalls zuläßt, entwickelt sich dieses Wort im Kontext der anderen Wörter des Eingangs zu einem prägnanten und zugleich komplexen dichterischen Bild. Es war offenbar die Absicht des Dichters, sein subtiles dichterisches Eingangsbild mit dem Schleier von Begrifflichkeit zu umgeben. Der erste Vers des Prologs wird der Form nach dadurch zu einem Rätsel. Seine Lösung, die Erkennung des Verses als dichterisches Rätselbild vorausgesetzt, ermöglicht den Zutritt.
Die Hervorhebung des bildhaften Anteils in „zwîvel“ ist der Grund dafür, daß die Rezeption der „zwîvel-Problematik“ hier im bisher üblichen Verständnis nicht genügend berücksichtigt werden konnte. Wenn Ergebnisse aus dem Bereich der Sekundärliteratur referiert wurden, geschah dies nur skizzenhaft. Außer dem Platzmangel im Rahmen der vorliegenden Studie, gibt es zwei Gründe, die für eine kurzgefaßte Darstellung der Problemlage sprechen. Sie werden in der Literaturwissenschaft folgendermaßen artikuliert:
1. „Die Eingangsverse zu Wolframs „Parzival“ sind vielleicht die von der Forschung am häufigsten interpretierten Verse des ganzen Werkes“ (Ulzen 1974 Einleitung, S. VIII). Der andersartige, künstlerische Ansatz der eigenen Überlegungen soll die herkömmliche Art der Interpretationen des „Eingangs“ nicht um eine weitere vermehren, sondern eher auf der Ebene der dichterischen Bilder ergänzen.
2. „Die Bedeutung des Wortes und des Phänomens zwîvel bei Wolfram gehört zu den umstrittensten Problemen der „Parzival“-Forschung. Es geht um den Begriff des zwîvel im ersten Vers der Dichtung [...]. Zwei Hauptpositionen lassen sich unterscheiden. Einmal wird zwîvel aufgefaßt als religiöser Zweifel, zum andern als „Schwanken“, entweder im Sinne des Wankelmutes oder, umfassender, als Ungewißheit und Unschlüssigkeit in den letzten Fragen menschlichen Seins überhaupt als allseitiges Erschüttertsein.“ (Hoffmann, 1963 Stichwort „zwîvel“ als Lexikondefinition bei Weber). Weil ich im Gegensatz dazu der Meinung bin, daß der „zwîvel“ darüber hinaus eine prägnannte, künstlerisch- bildhafte Dimension hat, kann hier nicht umfassend auf die internen Kontroversen um den diskursiven Begriff des „zwîvels“ eingegangen werden.
Die hier vertretene These lautet: Der „zwîvel“ ist - im Kontext des Prologeingangs - Teil eines komplexen dichterischen Bilderrätsels, das eine programmatische Funktion für das Gesamtkonzept des Romans hat.
Gottfried von Straßburg, dessen Literaturkritik von der heutigen Literaturwissenschaft inhaltlich noch nicht enträtselt ist, hat mit seiner Kritik, die sich im Bild des „bickelwortes“ konzentrierte, damit indirekt sicherlich auch auf den mehrschichtigen Gebrauch des „zwîvel“ im Parzivalprolog reflektiert. Wenn Wolfram der „zwîvel-Diskussion“ im „Gregorius“ - auf einem vermeintlich hohen theologischen und philosophischen Niveau - seine eigene „Version“ von „zwîvel“ entgegensetzte, konnte Gottfried von Straßburg (stellvertretend für Hartmann) darüber nur aufgebracht sein. Sie mußte als Parodie auf den hochgestochenen und von jeder gesellschaftlichen Realität abgehobenen „zwîvel-Begriff“ im „Gregorius“ empfunden werden. Daß dies durch eine derbe „Ver-Inhaltlichung“ (als „Fell“ oder Hülle) auch geschah, liegt auf der Hand. Gottfried fühlte sich als Dichter veranlaßt, solchen parodistischen Tendenzen gegenüber Hartmanns Dichtung entgegen zu treten. Darüber hinaus konnte oder wollte er nicht erkennen und anerkennen, daß der im Parzivalprolog „inhaltlich“ eingefärbte „zwîvel“ als „Fell“ oder als „velum“ („vel“, lat. Abkürzung für velum bzw. velatum, Hülle) zu einem Synonym für gleichzeitiges Verhüllen und Enthüllen in der Kunst wurde. Gerade wegen dieser bildlichen Verdichtung erreicht „zwîvel“ im Parzivalprolog ein weit höheres abstraktes Ausdrucks- und Anspruchsniveau, als ein diskursiver „zwîvel“-Begriff im „Gregorius“ ihn je erreichen konnte.
Der Hinweis auf den Eingang des Parzivalprologs als ein zu lösendes Rätsel bedeutet gerade nicht, daß es sich hier um eine relativ bekannte und harmlose Sache, eine Art Kreuzworträtsel oder Detektivgeschichte handelt. Unter der Voraussetzung, daß man als Übersetzer und Interpret das Rätsel als solches erkennt und löst, kann man den Text m.E. auch so in eine moderne Sprache übertragen, daß die Möglichkeit erhalten bleibt, ihn im Zusammenspiel von Wort und Bild als literarische Form zu erkennen. Die Frage stellt sich nicht erst bei der Übersetzung, sondern schon bei der Transkription der alten Texte. Der erste Vers des Parzivalprologs liefert dafür das beste Beispiel.
Wie schon bei Lachmann sind auch in einer jüngeren Transkription (Ulzen) der Handschriften des Prologs zwei entscheidende Worte des Eingangs „nach“ und „gebur“ zu dem neuen Wort „nâchgebûr“ zusammengefaßt, obwohl die zwei Wörter, getrennt gelesen, einen anderen Sinn haben können als „nachgebur“. Damit erschwert man auch einem Leser des Originaltextes, der nicht auf Übersetzungen angewiesen ist, die Möglichkeit, sich das im bzw. hinter dem Text verborgene dichterische Bild wie ein Rätsel zu erschließen[17].
Jolles (1930, S. 126) beginnt in seiner Studie über „Einfache Formen“ das hier bedeutsame Kapitel so: „Noch eine zweite Form erfüllt sich in Frage und Antwort: das Rätsel“. Was das „Sich-Erfüllen“ für die menschliche Existenz bedeuten kann, wird anhand von zwei gegensätzlichen Rätseltypen erklärt:
„Da ist einerseits eine Gruppe, die wir mit den Typologen als Sphinxrätselgruppe bezeichnen wollen [...]. Hier examiniert ein mehr oder weniger grausames Wesen [...]. Aber in allen Fällen heißt es: rate oder stirb! In allen Fällen ist es im tiefsten Sinne eine Examens- und Existenzfrage.
Dem steht eine andere Gruppe gegenüber, die man gewöhnlich nach einer häufig vorkommenden Vergegenwärtigung Ilorätsel nennt [...]. Hier wird also ein Rätsel aufgegeben, das, wenn es nicht geraten wird, Freiheit und Leben bringt. Es ist die Frage des Angeklagten, und hier heißt es: gib ein Rätsel auf und lebe! [...] Ein aufgegebenes Rätsel nicht lösen können, heißt Untergang - ein Rätsel aufgeben, das keiner rät, heißt Leben [...]. Gerade weil Tod und Leben hier von der Lösung des Rätsels abhängen, hat man diese Gruppen Halsrätsel oder Halslösungsrätsel genannt“ (Jolles, 1930, S. 132)[18].
Gerade weil das „Aufgeben des Rätsels eine Prüfung des Ratenden, eine Untersuchung seiner Ebenbürtigkeit“ ist, oder die Lösung eines Rätsels „eine Parole, ein Losungswort [...] Zugang zu etwas Abgeschlossenem verleiht“ (Jolles, 1930, S. 134), kann der Bezug auf die Form des „einfachen Rätsels“ im Falle des Parzivalprologs hilfreich sein, die Situation zu erklären, in der sowohl der Romanheld Parzival als auch der Hörer des maere sich befindet, wenn er sie verstehen will: Er muß eine Probe „aufs Exempel“ machen, um ein Urteil über seine „Ebenbürtigkeit“ zu erhalten. Deshalb sagt Wolfram: „diz vliegende bîspel / ist tumben liuten gar ze snell / sine mugens niht erdenken / wand ez kann vor in wenken / rehte alsam ein schellec hase.“ (1,15-19).
Daß der Prologtext rätselhaft ist, braucht nicht nochmals betont zu werden. Die Schwierigkeit liegt in der „Einfachheit“ seiner Lösung, die eher Kreativität als „Intelligenz“ erfordert. „Evidenzlogik“ reicht nicht aus, weil der Schein der Worte trügt. Zu Wolframs Zeit war es für einen Zuhörer sicher nicht so schwer, auf eine Lösung zu kommen wie heute; denn bei dem damals üblichen mündlichen Vortrag konnten die vom Dichter gegebenen Lösungshilfen (z.B. einfache Gesten oder besondere Betonung) in einem lebendigen Sprachzusammenhang besser erkannt werden. Die Frage, ob man die Lösung weiterreichen dürfe, erübrigt sich, weil ein Rätsel, dessen Lösung man kennt oder einem vorab bekannt gegeben wird, keines mehr ist und deshalb keine Wirkung mehr hat (wie z.B. bei Parzivals Frage). Ein Rätsel, das andererseits so schwer ist, daß niemand es erraten kann, ist ebenfalls keines. Es kommt darauf an, daß man - auch eine „flüchtige“ - Lösung des Rätsel selbst findet und finden kann.
6.5 Die heilsgeschichtliche Verfassung auf der Basis einer „glücklichen Schuld“
Nachdem Wolfram also in Bild und Wort die äußerst problematische bis existenzbedrohende Situation des menschlichen In-der-Welt-Seins dargestellt (1,1-2) und erläutert (1,3-6) hatte, kommt mit dem siebten Vers die höchst überraschende Wende der Situation mit dem Wort „dennoch", sinngemäß etwa so übersetzt: „und trotzdem":
„der mac dennoch wesen geil wande an im sint beidiu teil des himels und der helle“ (1,7-9).
Durch ihren Beginn mit dem siebten Vers wird die Wichtigkeit dieser Aussage angedeutet und durch Verteilung auf drei Verse unterstrichen. Mit dem Stilmittel des Enjambements wird zudem formal die Einheit des Satzes hervorgehoben und inhaltlich die menschliche Existenz als Einheit trotz ihrer Polarität („beidiu teil“) künstlerisch sanktioniert: Dem ersten Gedankenblock (1,1-6), der die menschliche Verfassung in dieser Welt darstellt, wird in diesen drei Versen der Heilswille Gottes, wie er sich in dieser „Satzung“ widerspiegelt, übergeordnet. Die Verwendung der heiligen Zahlen (eins-drei-sieben) deutet das Konzept in diesem Sinn: Ein Satz - drei Verse - siebter Vers als Anfang.
In Anlehnung an eine Einteilung von Helmut Brall könnte man den Dreizeiler 1,7-9 als einen zweiten „Gedankenblock" und als die „tektonische Mitte" des Eingangs - als sein mittleres Bogenelement - bezeichnen. Im Unterschied zur vorliegenden Gliederung erstreckt sich der zweite Gedankenblock bei Brall von den Zeilen 1,3-1,9. Weil in Versen 1,7-9 eindeutig auf die „felix culpa“ der Osternachtliturgie angespielt wird, kann man hier eher von einem eigenständigen zweiten Gedankenblock als dem Verbindungselement zwischen beiden Teilen des vliegenden bîspels sprechen. Die „stark österliche Prägung“ der Parzivalhandlung hat Petrus Tax (1965, S. 455 ff.) besonders hervorgehoben.
Brall behauptet in diesen drei Versen im Gegensatz zu „unverzaget mannes muot“ in „Vers 1,7 der tektonischen Mitte des ersten Abschnittes, [...] die andere, aus dem eigenen Menschenbild begründete Heilserwartung [..]: der mac dennoch wesen geil, eine Formulierung, die eine Möglichkeit ausdrückt, nicht eine Tatsache festhält, wand an im sint beidiu teil, des himels und der helle (1,8 f.)" (Brall, 1983, S. 8). Wolfram „behauptet" m.E. hier gerade nicht eine „aus dem eigenen Menschenbild begründete Heilserwartung", sondern bezieht sich auf die offizielle kirchliche Lehre.
Infolge eines theologischen Mißverständnisses glaubt Brall also, Wolfram habe von Hartmann oder einem anderen „ein bereits weit beanspruchtes religiöses Schema bzw. dessen paränetische Essenz (daß „zwîvel“ ins Verderben führt), übernommen und wolle es trotzdem umkehren.“ So schließt er in einer Fußnotenbemerkung zu diesem Problem: „Es spricht viel dafür, einen gedanklichen Bruch anzunehmen; nicht trotz zwîve l und Irrewerden an Gottes Gnade wird die Möglichkeit des Seelenheiles behauptet, sondern aufgrund der von Wolfram selbst gesetzten Voraussetzungen" (Brall, 1983, S. 9 beide Zitate). Diese Bemerkung ist sicherlich ein fundamentaler Irrtum in der Einschätzung Wolframs, seines Denkens und Dichtens und seiner christlichen Überzeugung. Selbstherrliche „Setzungen“ dieser Art erlaubte sich nur Hartmann von Aue in seinem Erecroman.
Wapnewski hat demgegenüber überzeugend dargestellt, daß Wolfram bei aller Verpflichtung dem Vorgänger gegenüber eine elementare Wendung macht, indem er „das Entscheidend-Nichtgemeinsame darzustellen und damit das Unmenschliche, das Widernatürliche und das Legendenhafte am Werk Hartmanns“ (Wapnewski, 1955, S. 27) scharf kritisiert. Die Radikalität der Ablehnung Hartmanns geht aus der Erec-Satire im Parzivalprolog eindeutig hervor.
„Unsere Annahme eines grundsätzlichen weltanschaulichen Bruchs mit einer solchen Lehre vom Weg zum Heil hat daher auch nach den von Wolfram in Anschlag gebrachten Voraussetzungen für eine `Heilslehre' zu fragen" (Brall, 1983, S. 9 und 13). Auf der Suche danach stößt Brall unvermeidlich auf „die Elster als Chiffre, als Wahrzeichen menschlichen Daseins, das keine weitere Ausdeutung verlangt, weil das Bild die Anschauung einer Idee festhält (...). Wie unvereinbar aber die symbolische Deutung menschlichen Daseins mit der Allegorese der Farben schwarz und weiß ist, liegt offen zutage. Der gefleckte Mensch [...] kann doch nicht wesen geil; unter moraltheologischer Perspektive jedenfalls gibt es nur ein Entweder - Oder, keine Zwischenform des Heilsgewinns [...] dafür zwei Belege aus der volkssprachlichen Dichtung.
1. In Heinrichs Litanei, einer Sündenklage aus der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts, wird ein Bild der irdischen Existenz gezeichnet, die in ihrer Sündhaftigkeit der Allgewalt undurchschaubaren göttlichen Wirkens nachgerade ausgeliefert ist (2,1-14). Der Mensch sieht sich in einem krassen Knechtschaftsverhältnis zu Gott, und sein Kampf um das Seelenheil ist von diesem Bewußtsein seiner Niedrigkeit durchdrungen"
2. Ebenso hält es der für seinen Hang zur Eindeutigkeit bekannte Verfasser des Jüngeren Titurell mit einer orthodoxen Auslegung“ (1983, S. 18).
Daß sich das Bild der Elster in seinem elementaren Sinn einer allegorischen Deutung widersetzt, wie Brall sagt, ist nicht zuletzt deswegen richtig, weil, wie die Analyse zeigte, es gar nicht allegorisch konzipiert ist und so verstanden werden kann. Eine allegorische Deutung verfehlt m.E. von vornherein den ursprünglichen Sinn des Bildes. Die Auswahl der Belege, die Brall für seine richtige These heranzieht, wirft allerdings auch ein Licht auf das Vorverständnis des Autors selbst. Von mentalen Einstellungen kann sich niemand freimachen. Die von ihm zitierten Meinungen sind im zwölften Jahrhundert vielleicht auch vertreten worden; sie sind aber nie Lehrmeinungen der Kirche gewesen. Wenn man nun aus nachträglicher Perspektive gerade solche Beispiele als Belege auswählt, läßt das darauf schließen, daß man ein eher nachreformatorisches Sünden- und Heilsverständnis auf die Dichtung Wolframs projiziert. Die Aussage z.B., daß der Mensch in „einem krassen Knechtschaftsverhältnis zu Gott und sein Kampf um das Seelenheil [...] von diesem Bewußtsein seiner Niedrigkeit durchdrungen " sei, hat mit dem Erlösungsverständnis der Christenheit des 12. Jahrhunderts ganz und gar nichts zu tun. Es ist auch theologisch und vor allem im dichterischen Konzept Wolframs fragwürdig.
Der Mensch kann trotz seiner Schuld immer noch froh sein („der mac dennoch wesen geil“ 1,7), weil er erlöst ist. Der Bruch zwischen dem ersten Menschen und Gott in der Heils- und Menschheitsgeschichte ist nicht nur notdürftig verheilt. Durch die Menschwerdung des Gottessohnes ist sein Verhältnis völlig neu gestaltet worden. In der Liturgiefeier heißt es deshalb: „O Gott, Du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen, aber noch wunderbarer erneuert.“ Das ist Grund zur Freude trotz allem, was geschehen ist.
Im zweiten „Gedankenblock" (1,7-9), den man auch als Verbindungsteil zum dritten Block (1,10-14) des Elsterngleichnisses betrachten kann, wird also eindeutig auf den Heilswillen Gottes reflektiert, der die Menschen als relativ freie Geschöpfe erschaffen hatte. Sie waren immerhin so „frei“, ihrem Schöpfer gegenüber ein „Nein" zu riskieren: „unt daz diu sippe ist sünden wagen“ (465,5)[19]. Allerdings gibt es für die in ihrer Erkenntnisfähigkeit eingeschränkten Menschen, im Gegensatz zu den gefallenen Engeln, durch die Menschwerdung des Gottes Sohnes eine unerhörte Chance, ihr „Nein“ zu revidieren und immer wieder einen neuen Anfang zu machen. Dem „sünden wagen“ (465,5) wird die „riuwe“ (465, 1) im Sinne von Metanoite (Umkehr) gegenübergestellt.
Der ganze Exkurs über die gefallenen Engel und den Heilsplan Gottes mit den Menschen bei Trevrizent dient allein der Aufklärung dieses „Sachverhaltes". Er ist gleichzeitig eine nur „relative“ Unterweisung, „wie es um den Gral steht“. Relativ deshalb, weil auch seine Lehre vom Gral durch die sog. „Lüge“ Trevrizents am Ende in einem durch und durch zweifelhaften Licht erscheint. Damit wird, gemäß dichterischem Konzept Wolframs, die Verantwortung für die Frage nach dem Gral und seiner nur fiktiven Wahrheit auf die Zuhörer selbst übertragen.
Die Frage also, warum man denn trotz der Tatsache, daß jeder Mensch gut und böse zugleich ist und sogar noch froh sein darf, schuldig geworden zu sein, läßt sich nur aus der wirklichen heilsgeschichtlichen Perspektive beantworten. Schon die Wahl der Namen Parzivals, die für das Romankonzept eine entscheidende Bedeutung haben, belegt dies hinreichend. Der Romanheld wird mit seinen beiden Geschlechternamen als der „anschouve" und der „waleise“ vorgestellt. Nach dem bereits erprobten Verfahren des „naiven" künstlerischen - hier wortwörtlichen Verstehens - kann man diese Namen in einem „naiven“ Sinn interpretieren als: Parzival der „Anschauer", d.h. „ der zur Anschauung“ bestimmte Mensch, und als der „waleis", der in „ freier Selbstbestimmung" auf der „wal-stat" (stf. schlachtfeld, kampfplatz) der geschichtlichen Welt für Gott und die Mitmenschen kämpfen muß auf einer „leis“; das ist eine „spur“, die „bildl. vom niederfallen der lanzensplitter“ (Lexer, 1992) gekennzeichnet ist.[20] Daß beide Geschlechternamen vordergründig „der Mann aus Anjou“ und „der Waleise“ heißen, soll hier nur am Rande bemerkt werden. Diese Doppeldeutigkeit findet sich auch bei dem „Dritten im Bunde“: Feirefiz. Er ist einerseits der strahlende göttergleiche Held aus der persischen Mythologie „Firusia“, andererseits der „faire fiz“, wörtlich der „gemachte Sohn“: „Es ziemt Allah nicht, Sich einen Sohn zu gesellen. Heilig ist Er! Wenn Er ein Ding beschließt, so spricht Er nur zu ihm: ‘Sei!, und es ist“ (Koran, Sure 19, Vers 36). Er ist ein „Anschewin“ in zweifelhafter Mission: „als ein geschriben permint / swarz unde blanc her unde dâ“ (747 26 f.)“!
6.6 Wer ist der „unstaete geselle“ im Elsterngleichnis?
Unschwer läßt sich aus der vorliegenden Interpretation erkennen, daß der erste Teil des Elsterngleichnisses (1,1-6) eindeutig auf das Herz des Romanhelden und damit auf Parzival bezogen ist. Das Wort vom „unstaeten gesellen“, der die „swarze varwe“ (1,10 f.) hat und „nach der vinster“ fahren wird, zielt offenbar auf einen „Antihelden“. Zwischen beiden Gedankenblöcken steht mit den Versen 1,7-9 ein „felix-culpa-Teil“, der beide Teile sowohl verbindet als auch trennt. Die Vermutung, daß es sich im unmittelbar anschließenden Vers beim Terminus „der unstaete geselle“ (1,10) nicht um einen Begriff, sondern um das Negativbild eines Menschen handelt, ergibt sich aus der Form bzw. dem schlichten, bildhaften Verständnis des Textes.
„der unstaete geselle hât die swarzen varwe gar, und wirt ouch nâch der vinster var: sô habet sich an die blanken der mit staeten gedanken“ (1,7-14).
Übergangslos schließt sich dem im Text verhüllten Bild von der „glücklichen Schuld“, das Wort vom „unstaeten gesellen“ an, der die schwarze Farbe hat und zur Hölle fahren wird. Man kann hier, wie Bumke (1970, S. 275), von einer „sprunghaft-abrupten Aneinanderreihung von zum Teil unverständlichen Gedanken“ sprechen, die jedoch als dichterische Bilder nicht mehr verständlich sind.
Wenn von einem „unstaeten gesellen“ die Rede ist, sollte man primär fragen, wer der „unstaete geselle“ ist und nicht darüber reflektieren, was „unstaete“ begrifflich bedeutet. Auf die naive Frage danach (wörtlich: wer der „nicht stehende“, also „un-stehende geselle“ ist), gibt Wolfram selbst einige Verse weiter (2,15-24) eine ebenso bildhafte, wie plausible Antwort in der Satire auf das dubiose „verligen“ des „Helden“ Erec. Er ist der Prototyp des „unstaeten gesellen“.
Zu den archaischen Grundmustern der Wahrnehmung überhaupt gehören die in den dichterischen Bildern mehr oder weniger prototypisch enthaltenen Bildhandlungen. Das sind Bewegungen, die immer auch Sinnbewegungen sind, z.B. die Richtungsangaben „oben“ und „unten“, wie sie in „stehen“ (staete) und „liegen“ („unstaete“) enthalten sind. Mit ihnen kann in einem literarischen Zusammenhang durchaus die Vorstellung von „Heil“ und „Unheil“ verbunden sein: „Auferstehen“ als die gesteigerte Form des „Stehens“ und „verligen“ bzw. das „Liegenbleiben“ als Richtungsangabe für den Weg in die „vinsternis“. So sind auch im dichterischen Bild des menschlichen Herzens im Prologeingang die bildhaft „einkreisenden“ Bewegungen als archaische Grundmuster („zwivel“: vel-velum-Hülle; „bur“: Käfig – Brustkorb - Gerippe) dichterische Mittel, die den Ort bzw. das Zentrum der Handlung des ganzen Romans (im Herzen des Helden!) „räumlich“ nach Ort und Richtung eingrenzen.
Diesem „ Ortbildungsvorgang “ am Anfang des Prologs folgen im zweiten Teil (1,10) des „vliegenden bîspels“ (1,1-14) Angaben über die Richtungen des einzuschlagenden Lebensweges mit äußerst reduzierten, aber dennoch wirkungsvollen graphischen, also bildhaften Mitteln: „Staete“ und „unstaete“ sind also nicht nur begrifflich, sondern auch als vertikale und horizontale Richtungsangaben zu verstehen, die den Weg der aventiure „in die Welt“ versinnbildlichen, aber auch Körperhaltungen signalisieren. Formal handelt es sich um prototypische, exzentrische Bewegungen im Gegensatz zu den konzentrischen, umhüllenden, einkreisenden Sinnbewegungen im Prologeingang. „En miniature“ wird im „vliegenden bîspel“ - im Miteinander von konzentrischen und exzentrischen Sinnbewegungen - die gattungstypische Erzählstruktur des Artusromans insgesamt reflektiert.
Wenn Wolfram also mit der „felix culpa“ das Bild „Auferstehung“ assoziiert und diesem im unmittelbar anschließenden Vers das Bild der „unglücklichen Schuld“ (vom „unstaeten“ Gesellen, der in die „vinster varn“ wird) gegenüberstellt, so ist das nicht nur die Polarität von Auferstehung und Schuld, sondern auch die von „Aufrichtigkeit“ und „Verligen“, die den Textsinn von „staete“ und „unstaete“ begleitend veranschaulichen. So wird also mit der „Auferstehung“ des Christenmenschen bildhaft das „Unstehen“, d.h. das bewußte „Liegenbleiben-Wollen“ des „unstaeten gesellen“ verbunden. Mit einiger Sicherheit kann man davon ausgehen, daß hier konkret Erec gemeint ist.
In der Konsequenz seiner einmal eingenommenen „horizontalen“ Gerichtetheit des „verligens“ wird er „nach der „vinster var“ (1,12 „vinster“ bedeutet „finis terrae“), d.h. zum „Tellerrand“ fahren, um von dort in den lichtlosen Orkus unter der Erde (lat. tellus) zu stürzen. Bildhaft werden hier in „staete“ und „unstaete“ „Auferstehung“ und möglicher „Absturz“ auf Tuchfühlung einander gegenüber gestellt. Diese Deutung zeichnet sich in der „Verkleidung“ der Worte „staete“ und „unstaete“ ab.
„Staete“ weist hin auf Stehen. Entgegen dem Augenschein (daher evidenzlogisch nicht relevant) ist „stehen“ eine „ständig“ zu erbringende Leistung, ein dynamischer Vorgang: ein Balanceakt! Bei ihm ist in besonderer Wahrnehmungsfunktion der Gleichgewichtssinn des Menschen - zeitlich ununterbrochen - d.h. „ständig“ in Aktion. In „staete“ wird außerdem an den anthropologisch bedeutsamsten Schritt in der Menschheitsentwicklung erinnert, nämlich den „aufrechten Gang“, durch den sich der Mensch vom Tier unterscheidet, wie Anthropologen behaupten. „Staete“ ist ein Lernprozeß, der dennoch immer auch kulturell bedingt bleibt. Man muß das Stehen und Gehen erst erlernen, so wie man auch das „Selbst-verstehen“ erlernen muß.
Im übertragenen Sinn ist „staete“ dann ein geistiger Balanceakt, der „ständige“ Übung und Anstrengung erfordert, wie etwa das Tugendstreben in seinen verschiedenen Formen. „Ständig“ oder „stetig“, beide von stehen (staete) abgeleitet, haben nun einen zeitlichen Sinn: Staete ist im räumlich und zeitlich übertragenen Sinn die dauerhafte „Haltung“, die man „Aufrichtigkeit“ nennt. Indem man sich „aufrichtet“, d.h. „steht“, hat man einen Teil des „himels“, d.h. des Lichtraumes erobert, einen „Standpunkt“ (Topos), von dem aus man „weitsichtiger“, aber auch verantwortlicher ist. „Staete“ ist also dem im Eingang genannten „mannes muot“ zu- oder übergeordnet.
„Unstaete“ heißt wortwörtlich „unstehen“, nichtstehen oder liegen. Man „liegt“, wenn man müde, krank oder tot ist. „unstaete ist also vornehmlich ein Zeichen der Schwäche. Bewußtes „Liegen-bleiben-Wollen“ , m.a.W. „verligen“ jedoch ist gegen die eigene Natur gerichtet, im übertragenen Sinn Schuld bzw. „niederträchtige“, böse Gesinnung mit der Tendenz zur Hölle. „Unstaete“ ist für den Menschen ein „erniedrigendes Verhalten“ („Stehen“ oder Gehen „auf allen Vieren“, wie im Rausch), kein freies menschliches „Verhältnis“ zur Welt.
„Unstaete“ ist ein Wort, von dem man annehmen kann, Wolfram habe seine Zweideutigkeit (aus dem erwähnten literarischen Grunde) für den o.a. Kontext erst erfunden. Er spricht vom „unstehenden Gesellen“, um durch diese relativ holprig klingende und wohl auch in seiner Zeit ungewöhnliche Ausdrucksweise sein literaturkundiges Publikum für den „Un-Stand“ des „verligens“ hellhörig zu machen (als nicht standesgemäße Haltung). Die Wortwörtlichkeit als dichterisches Mittel anzuwenden, ist in diesem Falle so „naheliegend“ bzw. mhd. „verligend“, daß sie für Wolfram schon fast wieder „selbst-verständlich“ ist. Bumke (1997, S. 137) weist für einen anderen, noch viel extremer liegenden Fall von Wortwörtlichkeit hin: „Es ist Wolfram zuzutrauen, daß er das französische Lehnwort vilan ‘bäurisch’, ‘unhöfisch’ zu einem deutschen ‘viel an’ verdreht und dem ‘wenig an’ entgegengesetzt hat.“ Gemeint sind hier die Verse, die über die nur dürftig bekleidete Jeschute berichten: „nantes iemen vilân, der het ir unreht getân: wan si hete wênc an ir (257,23-25). - Ohne den Kontext von Wort und Bild läßt sich auch der „unstaete geselle“ nur schwer oder gar nicht verstehen.
„Unstet“ heißt nach heutigem Verständnis so viel wie unruhig, hin- und herbewegt, unzuverlässig etc. Man ist deshalb geneigt, diese Vorstellung im „vliegenden bîspel“ auf die „Elster“ als „unstaeten gesellen“ zu beziehen. Das Wort „agelster“ ist jedoch ein schwaches Femininum. Wenn es aber ausdrücklich im Vers heißt „ der unstaete geselle hât die swarzen varwe gar“ (1,11 f.), kann grammatisch die Elster nicht gemeint sein.
An anderer Stelle im Parzivalroman (732,6) ist davon die Rede, Parzival habe sich aus Liebe zu Conduiramours des Ehebruchs enthalten: „sich unstaete niete“. Wörtlich heißt dies, er habe sich des „Unstehens“, d.h. „Beiliegens“ bei einer fremden Frau enthalten. Die legale Art des ehelichen „Beilagers“ heißt „bîlëger“ oder „biligen“. Hier wird also die Unrechtmäßigkeit des Verhältnisses von Mann und Frau „unstaete“ genannt. Auf dem Hintergrund dieses Sprachgebrauchs sowie der wortwörtlichen und bildhaften Bedeutung von „unstaete“ als „Unaufrichtigkeit“ kann man im „unstaeten gesellen“ schon im Prolog einen ersten Hinweis auf den allseits bekannten „unstehenden“, d.h. „verligenden“ Zeitgenossen „Erec“ erhalten. Wolfram gelingt dieser Hinweis mit ganz einfachen stilistischen Mitteln, hier z.B. mit den Polaritäten von „vertikal“ und „horizontal“, die im „staete“ und „unstaete“ vielsagend mitschwingen. Er bedient sich in seiner Sprache graphisch eindrucksvoller Mittel, um auf kürzestem Wege ein brennendes, zeitgenössisches inhaltliches Problem aufzugreifen, nämlich die Begegnung von Mann und Frau in der besonderen Form geschlechtlicher Liebe. Bezeichnenderweise wird die Satire auf das „verligen“-Motiv (das „unstehen“) mit den Worten eingeleitet: „valsch geselleclicher muot / ist zem helleviure guot“ (2,17-18). Diese Textstelle korrespondiert mit dem Bild der „Höllenfahrt“ des „unstaeten gesellen“ in 1,11-12.
Das Leitwort des Parzivaleingangs „zwîvel“, sowie „staete“, „unstaete“ und andere Wörter erwecken zunächst den Eindruck, es handele sich bei ihnen um völlig abstrakte Begriffe. Bei genauerem Zuhören und der Wahrnehmung der „Umstände“ bemerkt man an dem, was „beiherspielt“, nämlich an der Bildhaftigkeit ihrer Bedeutungen, daß in ihnen die Genese vom Bild zum Begriff bzw. die anthropologischen Vorbedingungen vor der Reduzierung der Bilder auf Begrifflichkeit noch eine „bedeutende“ Rolle spielen und mitempfunden werden. Das geht so weit, daß man als Zuhörer sogar die den abstrakten Begriffen ursprünglich zugrundeliegenden Bilder und graphischen Sachverhalte bzw. anthropologischen „Umstände“ als Sinnrichtungen und Grundstrukturen des Elsterngleichnisses (1,1-14) nach folgendem Schema zuordnen könnte:
1. Teil: Ortbildungsvorgang
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Teil: Richtungsbildung im Parzivalprolog
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine solche Ort- und Richtungsbildungstruktur entspricht der Form nach dem Erzählschema des Artusromans als neuer Erzählform im 12. Jahrhundert. Die existentielle und seelische „Ortbildung“ im anthropologischen und künstlerischen Sinne, bei der das Herz des Helden stellvertretend für den ganzen Menschen im Mittelpunkt der Selbstkonstitution im Prolog steht, entspricht dem Hof als „Standort“ im Erzählschema der Artusdichtung (als Gattung). Im „Herzen“ und im „Hof“, bezeichnenderweise „Artus-Runde“ genannt, werden Positionen der persönlichen und gesellschaftlichen „Innenwelt“ der „Außenwelt“ gegenüber zeichenhaft „geortet“ und auf den „Punkt gebracht“.
Die Aneignung der Welt erfolgt in exzentrischen Bewegungen der aventiure, wie sie in den Vorstellungen von „staete“ und „unstaete“ angedeutet wird. In den extrem gegensätzlichen Körperhaltungen von stehen oder liegen zeigen sich sinnfällig und prototypisch gleich am Anfang des Romans zwei archaische Muster von Sinnfindung und Versagen auf dem Lebenswege. Als Grundeinstellungen entscheiden sie bei der subjektiven „Aneignung“ vonWelt und der durch sie bedingten Selbstfindung (Metamorphose) des Subjekts darüber, ob es am Ende seines Pilgerweges „Nichts“ oder „Alles“ erreicht hat. Sich tierisch unentschieden zu verhalten, wie die Elster (an „Allem“ und „Nichts“ teilhabend) oder „liegen zu bleiben“, ist für den Menschen im Hinblick auf sein Heil nicht möglich: Er muß sich immer wieder bemühen, „aufrichtig“ zu sein.
Der vorliegende Versuch, die zweite Hälfte des Elsterngleichnisses im künstlerischen Sinne anders zu deuten, wurde erst durch die Analyse eines Teiles der sogenannten „Frauenlehre“ ausgelöst, die sich als vernichtende Kritik Wolframs an der dichterischen Konzeption Hartmanns von Aue herausstellte. Der Verdacht, daß Wolfram im dichterischen Bild des „zwîvels“ auch Hartmanns aufgeblasenen zwîvel-Begriff aus der Gregoriuslegende karikieren wollte, liegt nahe. Aufgrund der Enitekritik und Erec-Satire im Parzivalprolog darf man annehmen, daß mit dem „unstaeten gesellen“ (d.h. dem „unstehenden gesellen“) auch Erec gemeint ist.
6.7 Die abstrakten Bilder des Prologs (1,1-1,14) als Eingangsrätsel des „Parzival“
Der spielerisch-künstlerische Umgang mit dem Eingang des Parzivalprologs bietet, wie die Studie zeigt, die Chance, den Text auch in einem radikal veränderten Sinne zu verstehen. Es ging nicht darum, dem bisherigen, überwiegend diskursiven Verständnis, wie es sich in Interpretationen und Übersetzungen spiegelt, ein anderes gegenüber zu stellen, sondern darum, den bildlogischen Hintergrund des ersten Doppelverses als Rätsel zu lösen. In einer veränderten „Version" der Deutung, bei der weder ein Buchstabe hinzugefügt noch eine Silbe weggenommen wurde, zeigte sich ein mystisch/dichterisches Bild, das dem hohen Abstraktionsniveau und der künstlerischen Gestalt des Textes durchaus entspricht. Es ist gleich, ob man ein so erscheinendes „abstraktes“ dichterisches Bild dem klassischen Verständnis des Textes als „Bodennähe" unterschieben oder seiner Abstraktheit wegen überordnen will: Die verschiedenen logischen Ebenen des Textes bilden mit ihrer vorder- und hintergründigen Struktur eine Sinneinheit.
Sowohl der Abstraktionsgrad der dichterischen Aussage als auch die Komplexität vieler, durchaus möglicher begrifflicher Variationen des Eingangsverses werden in einem solchen dichterischen Bilde auf schlichte Weise reduziert. Zugleich wird das Wort „zwîvel", wie es im Eingang verstanden werden kann, dem ungeklärten Verhältnis zu anderen begrifflichen Vorstellungen enthoben, weil es primär auf der bildlogischen Ebene angesiedelt ist. - Das gilt beispielsweise für strittige Fragen, wie:
- Ob der „ zwîvel [...] ohne weiteres mit ' unstaete ` gleichzusetzen." sei; wie es die Meinung Noltes ist (Klaus Bohnen, 1976, S. 5). Er schreibt: „[...] umstrittener Kernbegriff ist aber der 'zwîvel`. Die rein philologische Untersuchung dieses Begriffes überzeugt bei Nolte am ehesten;"
- Ob „bei ihm (Parzival) der zwîvel nicht der unstaete gleichgesetzt sein"kann, wie Hempel fragt (Hempel, 1951, S. 182);
- Ob „ zwîvel und unverzaget ein Gegensatzpaar bilden“, weil bei Rupp und Ohly „verzwîveln und verzagen häufig synonym gebraucht werden“ (Schirock, 1990, S. 124);
- Oder ob „ zwîvel“ eine „Entzweiung mit Gott" ist, oder „des Helden zwîvel Auflehnung gegen Gottes Schickung" bedeutet (Hempel, 1951, S. 184);
- ob „sich Wolfram hier auf den `zwîvel' des Gregorius-Prologs bezieht". Schirok beruft sich dabei auf einen anderen bekannten Wolframforscher: „Haug folgt m.E. zu Recht dieser Annahme" (Schirok, 1990, S. 123).
Die Liste solcher Widersprüche bzw. offenener Fragen in der Forschung ließe sich noch verlängern. Die bildlogische Analyse hat jedoch ergeben, daß das Wort „zwîvel“ im Eingangsvers über alle möglichen Bedeutungen hinaus einen ganz eigenen, elementaren bildhaften Sinn haben kann. Im Zusammenspiel der wichtigen Worte „zwîvel“, „herzen“ und „nâchgebûr“ zeigt der erste Doppelvers ein mystisch-dichterisches Bild eines Herzens, in dem man sinnbildlich schon die Konturen des Romanhelden selbst erahnen kann. Dieses Bild steht gleichzeitig auch prototypisch für die Lebenssituationen des Menschen schlechthin, wie:
1. „Der Mensch ist zwîvel. Es ist die Situation, in die jeder Mensch in der Welt geraten kann oder muß; und nur darauf kommt es an, ob und wie er in den Wechselfällen des Lebens aus diesem zwîvel herausfindet" (Rupp, 1961, S. 44).
2. „Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht rational aufeinander bezogen. Das Gesetz leiblich-seelischer Vorgänge wird nicht am wirklichen Leben abgelesen , sondern ist in bestimmter Struktur vorweg gegeben, und die Aufgabe der Dichters ist es, dieser Wahrheit Fleisch und Blut zu verleihen“ (W. J. Schröder, 1952, S. 64). Dies geschieht exemplarisch schon im Eingangsvers.
3. „Parzivals ‘zwîvel’ ist nicht Schwäche, sondern Stärke einer selbst wachsenden, das Maß ihrer Existenz in sich selbst tragenden Natur" (Hempel, 1951, S. 181).
Auf die Wolframforschung selbst bezogen könnten der Eingangsvers und seine Kernwörter „zwîvel" - „herzen“ - „nâchgebûr“, in der Reduktion ihrer Komplexität auf ein geheimnisvolles Gesamtbild, jenes Eingangsrätsel sein, auf das man als „Kennwort für die innere Parzivalhandlung nicht verzichten" (Bumke, 1970, S. 126) sollte. Der Form nach handelt es sich um ein Rätsel, in dem die Ebenbürtigkeit des Publikums mit dem Dichter spielerisch auf die Probe gestellt wird, denn „diz vliegende bîspel / ist tumben liuten gar ze snell / sine mugens niht erdenken“ (1,15-17). Man muß es „anders“ (2,16) als nur denkend (d.h. begrifflich) verstehen.
Jedenfalls haben alle Wörter im sprach- und bildlogischen Zusammenhang „der ersten Prologverse einen doppelten Stellenwert". In seinem Forschungsbericht zitiert Bumke die Arbeiten Wapnewskis, der u.a. „durch den Nachweis theologischer Parallelen und Einflüsse die entscheidenden Vorgänge der Dichtung verständlich zu machen suchte" (Bumke, 1970, S. 126). Der doppelte Stellenwert von dem Wapnewski spricht, bezieht sich allerdings auf eine dichterisch/theologische Deutung, die der o.a. künstlerisch-existentiellen Interpretation erst folgt. Hierzu bemerkt Bumke: „Das ist scharfsinnig gedacht; aber die krause Folge der Gedanken und Begriffe widersetzt sich jedem Auflösungsversuch" (1970, S. 166). An der Doppeldeutigkeit der Bilder des Prologs, wie sie in der vorliegenden Studie aufgezeigt wurde, kommt man nicht vorbei. Diese Zweideutigkeit wird mit dem Stilmittel der Äquivokation im Text „schwarz auf weiß“ realisiert. Dem Dichter gelingt es jedoch, den unterschiedlichen Sinn äquivoker Wörter im Rahmen der literarischen Form des Textes so zu deuten, daß sie erst in ihrem Zusammenspiel die Einheit eines dichterischen Bildes verwirklichen.
Diese Art der Deutung zeichnet sich nicht durch besondere „Scharfsinnigkeit“ aus. Sie ist auch nicht durch eine „diskursive“ Strecke von philosopischen und theologischen Begriffen gekennzeichnet, sondern eher durch eine ungewohnte spielerische, aber dennoch ernsthaft gemeinte Art des Zugangs. Möglicherweise bereitet ein derartiger künstlerischer Deutungsversuch nicht geringere Verständigungsschwierigkeiten als traditionelle Interpretationen. - Allerdings hat eine „Wahrheit aus Fleisch und Blut", von der W. J. Schröder im Zusammenhang mit dem Parzivalprolog spricht, eine größerer Affinität zu dieser bildlich vermittelten Deutung. Sie widersetzt sich eo ipso, d.h dichterisch bzw. künstlerisch vermittelt, einer einseitig begrifflichen, intellektuellen Kritik, d.h. ihrer „Auflösung" (Analyse).
Unter den „Alltagsbedingungen“ des verstehenden Umgangs mit Literatur als Kunst gibt es das Problem in dieser Schärfe nicht. Über Nähe und Distanz im Umgang mit Dichtung macht Lachmann in seiner Akademieabhandlung von 1835 über den Eingang des Parzival eine interessante Bemerkung, die darauf hinausläuft zu sagen, daß „ der Dichter wohl (hat) ein folgsames Anschmiegen der Aufmerksamkeit verlangen können". Es heißt weiter: „Zwar ist es mir immer vorgekommen als ob die feinen und scheinbar fernliegenden Beziehungen, welche der Dichter zu nehmen liebt, fast durchaus bequem aus den gangbaren Ansichten, Bildern und Redeweisen der Zeit hervorgingen, so daß sich ihre Veranlassung meistens sehr in der Nähe findet. Ich muss daher glauben, daß ein Zuhörer, der in denselben Lebensverhältnissen und ähnlichen Gedanken stand, auch dem rascheren Gedankengang des gewandten und vielseitigen Dichtergeistes hat folgen können; [...] " (zitiert nach Brall 1983, S. 4). Was nach der Erkenntnis Lachmanns für den Zuhörer des 12. Jahrhunderts als eine Wahrnehmungsbedingung galt, kann heute nicht grundsätzlich falsch sein. Insofern ist die vorliegende künstlerische Interpretation des Prologs der Versuch, „sehr in der Nähe“ des Textes jenes „folgsame Anschmiegen“ methodisch reflektiert nachzuahmen.
7. Die „stiure“ der vorliegenden Interpretation
Nach einem ungewöhnlichen Einstieg in seine Abenteuergeschichte mit einer Reihung von sich „überstürzenden“ (Haug, 1992, S. 164) dichterischen Bildern macht Wolfram - auf halbem Wege zwischen Eingang und Elsterngleichnis einerseits und Erec-Satire und Frauenlehre andererseits - eine Atem- und Denkpause (2,5-9). Er stellt sich zum erstenmal als Erzähler („ich“) vor und reflektiert über seinen Begleiter (wîsen man), was er ihm an „stiure“ bieten und von ihm an Unterstützung („stiure“) erwarten kann, und in welche Richtung („stiure“) die Reise geht:„ ouch erkannte ich nie sô wîsen man / ern möhte gerne künde hân / welher stiure disiu maere gernt / und was si guoter lêre wernt“. Hier „verdichtet“ Wolfram seine Aussage wiederum, wie im Eingang des Prologs („zwivel“ und „nach gebur“), mit dem Stilmittel der Äquivoktion durch das Wort „stiure“. Seine Feststellungen schließt er mit der Bemerkung: „dar an si nimmer des verzagent“; m.a.W. frei übersetzt: Bitte keine Angst, jetzt geht’s auf den Turnierplatz. Mit den Worten „beidiu si vliehent unde jagent“ leitet er umgehend die Hartmannkritik in Form einer bösen Satire ein.
Bevor in dieser Studie darauf Bezug genommen wird, soll dieselbe Pause zu einer Reflexion über den bisher eingeschlagenen Weg im Umgang mit dem Text genutzt werden. Mir erschien selbstverständlich, daß die Elster im sogenannten Elsterngleichnis das Subjekt der Handlung und damit auch das Subjekt des Verses „als agelstern varwe tuot“ (1,6) ist. Insofern tauchte dabei das Problem der Allegorese des Elsterngleichnisses, das der Forschung einiges Kopfzerbrechen macht, erst gar nicht auf. Wenn man dagegen dessen Übersetzungen und Deutungen auf ihre Syntax hin befragt, stellt sich heraus, daß die Elster meistens nicht das Subjekt des nach ihr benannten Gleichnisses ist; wie mir scheint, ein seltsamer Befund. Wegen der für die Deutung bevorzugten allegorischen Prämissen (schwarz= böse und weiß = gut) kann nämlich nicht die Elster selbst, sondern nur die Farbe ihres Gefieders die Rolle des Subjektes im Vers 1,6 übernehmen. Jede allegorische Interpretation - und meinesWissens gibt es bisher keine andere - geht im Vergleich grundsätzlich von der Farbe aus. Damit dieser stimmt, müssen folgende Prämissen gemacht werden:
1. Elster zu sein, bedeutet primär schwarz-weiß zu sein;
2. Auszusehen wie die Elster, d.h. „schwarz-weiß-sein“ bedeutet, gut und böse zu sein;
3. Also bedeutet Elster-Sein, gut und böse zu sein!
Nach diesem allegorischen Schema werden Begriff und Bild der Elster zunächst auf eine Besonderheit ihrer Existenz fixiert: die Farbe. Im zweiten Schritt wird das schwarz-weiße Aussehen gemäß Vereinbarung nach dem Deutungsschema des vierfachen Schriftsinnes mit etwas völlig Fremden, nämlich den moralischen Kategorien „gut und böse“ appliziert, so daß jetzt schwarz nicht mehr schwarz und weiß nicht mehr weiß ist, sondern schwarz nunmehr „böse“bedeutet und weiß entsprechend „gut“. Für jemanden, der diesem vorgängigen allegorischen Konsens nicht zustimmt, ist eine entsprechende Deutung völlig unsinnig; einem Afrikaner z.B. überhaupt nicht zu erklären.
Wenn Hempel vom „Elsternvergleich“ des Prologs in der Weise spricht, daß dieser nur „seine Einleitung schmückt“, daß ihm eine „ Farbsymbolik lehrhaften Gebrauchs“ anhaftet und er letztlich ein „Farbvergleich“ (Hempel, 1951/52 S. 170) sei, bemerkt man, daß es auf die Elster gar nicht ankommt. Ist also der Vergleich nur ein sogenanntes „Elsterngleichnis“ und damit ein sprachlich unzureichender Ausdruck für das eigentlich Gemeinte?
Haug vertritt im Gegensatz zu anderen Autoren (z.B. Brall) und zum Dichter selbst die Meinung, daß eigentlich jedermann es verstehen müsse: „Das Gleichnis mit der Elster soll also für tumbe liute schwer faßbar sein: es entwische ihrem Verstand wie ein schneller Vogel oder ein hakenschlagender Hase. Das mag zunächst überraschen, denn ist es wirklich so schwer zu verstehen, daß es Menschen gibt, die zugleich gut und böse sind ?“ (Haug, 1971, S. 701). Hier wird erkennbar, daß die Forschung den allegorischen Deutungsansatz bereits so weit verinnerlicht, daß allegorisches Verstehen „quasi selbstverständlich“ vorausgesetzt wird, d.h. im eben zitierten Zusammenhang nicht einmal mehr von „schwarz und weiß“, sondern stattdessen sofort von „gut und böse“ gesprochen wird.
Wegen der bisher einseitig bevorzugten allegorischen Deutung in der Forschung ist es notwendig, wegen der eigenen „naiven“ Selbstverständlichkeit, daß die Elster handelndes Subjekt des Elsterngleichnisses ist, nach philologischen Argumenten zu suchen, um diese Annahme zu rechtfertigen. Man könnte meinen, gegenüber den bekannten allegorischen Deutungsversuchen seien lediglich Subjekt und Objekt des Verses 1,6 vertauscht worden. Dadurch sei es zu einer Umkehrung des Sinnes von Vers 1,6 gekommen. Diese Deutung werde nicht vom Text gestützt. Das vorliegende Problem läßt sich grammatisch und syntaktisch auf die Frage zuspitzen: Ist „agelstern“ oder „varwe“ das Subjekt des Elsterngleichnisses, oder verbirgt es sich u.U. in einer anderen unscheinbaren literarischen Form (z.B. im Hilfsverb „ist“) im Text ?
7.1 Philologische Argumente zum Literaturstreit und Anfang des Prologs
Im relativ unkonventionellen bzw. „naiven“ Umgang mit Bildern bzw. Begriffen aus dem ersten Teil des Parzivalprologs konnte die Erörterung philologischer Detailfragen des Textes nicht hinreichend berücksichtigt werden. Sie hätte den Gedankengang unterbrochen oder gestört. Dichterische Bilder sind außerdem „flüchtige Beispiele“, auf die man schnell reagieren muß (1,16). Dennoch spielt „am Rande liegendes“ oder besser gesagt „Umständliches“ (s.S. 91 und 152) bei ihrem Verständnis eine große Rolle, darf also nicht vernachlässigt werden. - Damit die vorgestellten Thesen nicht nur gewagte Behauptungen bleiben, sollen die näheren Umstände des Textes unter philologischen Gesichtspunkten genauer untersucht werden. Exemplarisch werden daher anhand der Leitwörter „bickelwort“ - „zwivel“ - „nachgebur“ - „agelstern“ - „varwe“ einige wichtige wissenschaftliche Argumente in der oben genannten Absicht hier nachgereicht. Sie betreffen außer Überlegungen zur Grammatik und Syntax des Textes auch Fragen zur Wortgeschichte, der Textüberlieferung sowie des Wortumfeldes dieser Leitwörter. Diese „Umständlichkeit“ hat zwar einen gewissen Verzögerungseffekt im Ablauf der Darstellung zur Folge. Er läßt sich jedoch aus Gründen der Wissenschaftlichkeit rechtfertigen, weil der bisher eingeschlagene und noch zu gehende Weg dadurch plausibler erscheint.
Im vorliegenden Konzept spielt das Verhalten der Elster die entscheidende Rolle, sie handelt, nicht die Farbe. Das hat natürlich für das Verständnis des Gleichnisses weitreichende Folgen. Nicht zuletzt wegen der in ihrem Namen anklingenden „Agilität“ (der „agile stert“!), bot sich eine Deutung (mit der Elster als handelndes Subjekt) an, in der die Elster als Subjekt mit dem Subjekt des Eingangs (zwivel 1,1-2) eine Einheit bildet. In den bisherigen allegorischen Interpretationen befand sie sich als Trägerin eines „farbigen“ Gefieders lediglich in der passiven Rolle eines Vergleichsobjektes.
Vorbehalte gegen das Konzept könnten beispielsweise auch deshalb angemeldet werden, weil sich „zufällig“ - im weitesten Sinne des Wortes - zwischen der Deutung des Elsterngleichnisses und der Bickelwortanalyse auf dem sachlichen Hintergrund beider Bilder eine Konvergenzbewegung („Sinn und Unsinn“ bzw. „Alles und Nichts“) abzuzeichnen scheint. Dieser erste Eindruck täuscht, denn das Gegenteil, Divergenz, ist dabei ebenso festzuhalten. Um es genauer zu sagen, in einer eher spiegelbildlichen Entsprechung divergiert der Sinn beider Bilder eigentlich in entgegengesetzte Richtungen. Die Erkenntnis, daß sie „augenscheinlich“ übereinstimmen, handlungslogisch aber gegenläufig sind, war erst das Ergebnis voneinander unabhängiger Analysen und kein vorgängiges Konzept. Der Text selbst und seine satirische Brechung verfolgen logischerweise gegensätzliche Ziele.
7.2 Das sinngebende Umfeld von „zwivel“ und „nachgebur“
Auf dem Hintergrund des ersten Verses im Prolog wurden in den Wörtern „zwi-vel“ und „nach-gebur“ Äquivokationen vermutet. Einen zweifachen Sinn haben dieselben Wörter außerhalb des Verszusammenhangs als Äquivokationen ohnehin. Zum besseren Verständnis der folgenden Überlegungen sei an meine interpretierende Übersetzung (s.S. 141f.) erinnert, die so lautete: „Zwei-Fell, die das Herz umschließen, wie ein Vogelbauer, das ist für die Seele eine tödliche Bedrohung“. „Zweierlei Felle“ in diesem Sinne sind Harnisch und Haut.
Ein Ritter ohne Rüstung ist unvorstellbar. Wenn daher ein Ritterdichter im Kontext höfischer Dichtung bildhaft vom „zwi-vel“ als typischer Dualität ritterlicher Existenz sprechen möchte, so kann die menschliche „Haut“, als Erscheinungs- und Wahrnehmungsgrenze der leiblichen Existenz einerseits (als erstes „vel“) und die von hohem gesellschaftlichen Symbolwert getragene Ritterrüstung andererseits durchaus als eine zweite, „eiserne Haut“ und als sinnfällige Idee zu einem abstrakten Begriff von Rittertum verstanden werden. Der harnasch, eine Panzerung aus Kettenringen, umgibt im 12. Jahrhundert den Körper des Ritters wie ein elastisches Metallgewebe. Diese „zweite Haut“ ist Zeichen gesellschaftlichen Ansehens und ihrer Zwänge, eine höfische „Uniform“, die Einheit von Ehrenkleid und Zwangsjacke. Mit ihrer um Schwertlänge vergrößerten Reichweite des Armes ist sie Sinnbild höchstritterlicher Verfügungsgewalt über Leben und Tod und der durchaus zweifelhaften „Lizenz zu töten“ oder sich totschlagen zu lassen. Ihre gesellschaftliche Wertschätzung erkennt man z.B. daran, daß Parzival bereit ist, einen Menschen zu töten, nur um in den Besitz der Rüstung und ihres „Ansehens“ zu kommen.
Zum unerbittlichen Konzept von Sieg und Niederlage, Ehre und Verachtung, Leben und Tod gibt es für einen Mann der ritterlichen Gesellschaft keine Alternative. Lebensbestimmend ist für alle - Männer wie Frauen - ein darwinistisches Prinzip auf hohem gesellschaftlichen Niveau; nichtsdestoweniger ist es eine unmenschliche Lebensform, in der nur der Stärkere überlebt. Dieses schicksalhafte Selbst- und Weltverstehen wird gesellschaftlich verinnerlicht und bestimmt maßgeblich den „mannes muot“ im höfischen Leben und Sterben als ein animalisches, unmenschliches Schicksal, nach dem als „fliegendes Beispiel“ auch die Elster als Raubvogel prinzipiell lebt und handelt. Dieses komplexe gesellschaftliche Bewußtsein wird in seiner Gespaltenheit und Einheit von Wolfram als „zwivel“ vorgestellt. Deshalb wird es „gesmaehet unde gezieret“, zugleich verehrt und verachtet bei Mensch und Tier.
Das „zweifelhafte“ Selbstverständnis und die gesellschaftliche Geltung des Romanhelden haben also im übertragenen Sinne explizit mit dem Tragen eines „velles“, d.h. einer Rüstung zu tun. Wie das gemeint ist, kommt szenisch im Streit Parzivals mit Ither deutlich zum Ausdruck: Er streift sich nach dem Kampf dessen Rüstung wie das „Fell“ eines Beutetieres über sein Narrenkleid. Das führt bei seiner Entkleidung am Hofe Gournemans’ zu großer „Entrüstung“: „si erschrâken die sin pflâgen“ (164,8). - In der Krise seiner ritterlichen Karriere, im Endkampf mit Feirefiz, wird die aufs Höchste gefährdete „zwei-fell-hafte“ Einheit von Ritter und Rüstung vom Dichter mit den Worten „beidiu durch iser unt durch vel“ (747,11) kommentiert.
Das hier skizzierte Bild zielt auf eine durchaus milieu- und zeitbedingte Möglichkeit des Verstehens in der höfischen Gesellschaft des 12. Jahrhunderts. Gedanklich ist ein solches - „zweifels-frei“ - nur schwer nachvollziehbar: denn wer trägt heute noch mit „Selbstverständlichkeit“ einen Panzer als „zweites Fell“? Auf dem Hintergrund mittelalterlicher Wirklichkeit und Zwänge kann dagegen der leibliche und sprachliche Kontext von „zwi-fel“ und „gebur“ durchaus mit dem Verhältnis von „Ritterrüstung“ und „Vogelbauer“ verglichen werden, wie es im Eingangsvers assoziiert werden soll. Solche Assoziationen verbinden nicht nur die „Rüstung“ (als „zweites Fell“) mit dem „Bauer“, sondern beide darüberhinaus noch mit dem Bild der Elster. Eine „hanebüchene Volksetymologie“, die Wolfram gern „provoziert“ (Wolfgang Mohr, 1979, S. 229) ist als Begründung für eine solche Deutung gar nicht notwendig. Man kommt schließlich „Wolframs sprachlicher Haltung [ ] nicht voll auf den Grund, wenn man sein Wörtlichnehmen von Sprache nur im Etymologischen sucht.[..]. Den Bedeutungsgehalt von zwivel sollte man sich so weit offen halten, daß einem die Zeile bei jedem Wiederlesen aufs neue ‘bedenklich’ wird“ (Mohr, 1979, S. 229).
7.3 Das volkskundliche Umfeld von „agelster“
Brall weist ausdrücklich darauf hin: „Wie unvereinbar aber die symbolische Deutung menschlichen Daseins mit der Allegorese der Farben schwarz und weiß ist“ (1983, S. 18). Schirock setzt sich über die Schwierigkeiten so hinweg: „[..] die Mischung von Schwarz und Weiß [hätte] man auch an einem nicht fliegenden Tier demonstrieren können“; es käme eher „auf die Elster als Vogel“, ihren „Vogelflug“ und die „Geschwindigkeit“ an, „die für die tumben gar ze snel ist“ (1990 S. 125). Dieser Erklärung könnte man entgegenhalten: Die Elster ist, was ihre Fluggeschwindigkeit angeht, eher eine „lahme Ente“, die, wenn sie gesund ist, mindestens doppelt so schnell fliegt wie diese. Wenn es im Elsterngleichnis als dem „vliegenden bispel“ vor allem auf die „Geschwindigkeit“ ankäme, hätte Wolfram dies besser an einem Falken „demonstrieren können“, so wie sich ein Zebra als „nicht fliegendes Tier“ für einen Schwarz-Weiß-Vergleich empfiehlt.
Im oben zitierten Zusammenhang macht Brall eine interessante Bemerkung, an die man hier anknüpfen kann. Er sagt: „die Elster (steht) als Chiffre, als Wahrzeichen menschlichen Daseins, das keine weitere Ausdeutung verlangt, weil das Bild die Anschauung einer Idee festhält“ (Brall, 1983, S. 18). Das klingt abstrakt. Auf kulturgeschichtlichem Hintergrund läßt sich jedoch relativ leicht erklären, wie solche Ideen zustande kommen können: Vom Mittelalter bis in die Neuzeit war es üblich, gezähmte Elstern wegen ihres attraktiven Aussehens als „lustige Vögel“ und „sprechende“ Hausgenossen für Kinder oder Erwachsene zu halten. „Im Käfig oder dem Vogelhaus hielt man Singvögel im 12. Und 13. Jahrhundert; Walther von der Vogelweide führte nach dem typischen Bilde in den Liederhandschriften ein (!) Vogelbauer im Schilde. Gleiche Freude hatte man an sprechenden Staren, Raben, Elstern und Sittichen“ (Weinold, 1897, S. 100). Weil gezähmt, wurden sie häufig gar nicht eingesperrt, sondern konnten sich frei bewegen. Das gibt es auch noch heute. Von daher kennt man das listige und z.T. dreiste Verhalten des Vogels recht gut. - Das auffallende Interesse der Elster gilt blanken, das Licht reflektierenden Gegenständen wie Schmuck, silbernen Löffeln, Geld. Sie liebt überhaupt alles Glänzende und hat keine Hemmungen, es sich anzueignen. Im Volksmund (und in der gleichnamigen Oper von Rossini!) spricht man daher von der „diebischen Elster“. Nicht zu übersehen ist aber auch, mit welcher Brutalität dieselbe Elster kleinere Tiere malträtiert. Mit Küken, Jungvögeln und schwächeren Mitgeschöpfen macht sie nicht viel Federlesens, sondern tötet sie mit rabiaten Schnabelhieben, um sie sich anschließend einzuverleiben. In ihrem undurchsichtigen Verhalten, zugleich gut und böse, liebenswert und räuberisch, ist sie im metallisch glänzenden Gefieder das „vliegende bispel“ für einen Ritter bzw. für ein ritterliches Schicksal im Sinne des „zwi-vel“. Im Sinne Bralls ist die Elster also ein attraktives, liebenswertes Geschöpf, gleichzeitig aber ein gefährlicher Räuber, der seinen Mitgeschöpfen das Leben schwer macht.
Das lustig-listige, aber auch räuberische Verhalten korrespondiert - aus menschlicher Perspektive - mit ihrer Erscheinung. Was die „Elster „tut“, sieht man ihr an. Weil sie das reflektierende Licht (d.h. auch das Leben) liebt, erscheint es auf ihrer Haut bzw. ihrem Gefieder als weiße „varwe“. Weil sie gern tötet, d.h. mit Schnabelhieben das Lebenslicht anderer Tiere auslöscht, erscheint die Lichtlosigkeit, der „Schatten des Todes“ an ihr, als „schwarze“ Eigenschaft. Ihr Aussehen entspricht ihrem charakteristischen Verhalten, in dem sie den Menschen gleicht. Insofern läßt sich ihr Bild und ihr Verhalten als „Idee“ auf ihn übertragen.
Meines Erachtens ist es nicht nur selbstverständlich, daß im Elsterngleichnis die Elster wichtigste Figur und als Subjekt quasi Spiegelbild des „zwivels“ ist. Wolfram selbst nennt sie im unmittelbaren Anschluß an den Vergleich (1,1-14) „diz vliegende bispel“. Das einzige Wesen, von dem in den vorhergehenden Versen die Rede ist, und das wirklich „fliegen“ kann, ist die Elster! Sie ist - im Gegensatz zu „varwe“ im selben Satz - auch die einzige, die im landläufigen Sinn etwas „tuon“ kann. Wenn Wolfram selbst in 311,18-22 vom Handeln der „varwe“ spricht, so ist das gerade nicht allegorisch gemeint. An folgenden Übersetzungsbeispielen auf der Basis eines allegorischen Verständnisses des Verses 1,6 kann man leicht die passive Rolle der Elster erkennen:
1. Simrock, Karl (1849, S. 5): „Zu des edlen Mannes Preis, wie bei der Elster Schwarz und Weiß “.
2. Stapel, Wilhelm (1950, S. 7): er, der „unverzagte Mann“ ist „ wie die Elster weiß und schwarz“.
3. Mohr, Wolfgang (1977, S. 127): ... „geht in gestreiftem Kleide/ unverzagter Mannesmut/ wie es Elsterngefieder tut“.
4. Knecht, Peter (1993, S. 9): „...wo eines Mannes unverzagter Mut konfus gemustert gehen will wie Elsternfarben.“
5. Martin, Ernst (1976, S. 3): „Schmach und Ehre ist, wo sich bunt färbt nicht weichender Mannes Sinn, so wie die Farbe der Elster (abwechselt) “.
Wenn die Elster bei den oben zitierten Übersetzungen lediglich „Top-Model“ für die Farbe eines Federkleides ist, müßte bei solcher Rollenverteilung das „Elsterngleichnis“ logischerweise „Farbengleichnis“ (vergl. Hempel, 1951/52, S. 164 u. S. 170) heißen! Daß Wolfram nur einen allegorischen Vergleich im Auge hatte, ist nicht anzunehmen. Für diesen Fall wäre wohl auch das bedeutsame Wort „tuon“ eigentlich überflüssig. Was hätte die Elster bzw. die Farbe ihres „velles“ dann wirklich zu „tun“ gehabt, wie es ausdrücklich heißt? - Nichts! Das „Verhältnis“ von beiden wäre somit lediglich ein passives (m.a.W. keines!) gewesen und nur aufgrund des Aussehens und eines übergestülpten Vergleichs zustandegekommen. - Im übrigen heißt „varwe tuon“ lexikalisch (als Akkusativ mit „tuon“; s.S. 166) „färben“; „als agelstern varwa tuot“ (1,6) hieße dann: „wie die Elster sich färbt“.
7.4 Die Überlieferung von „agelstern“ in den Handschriften des Prologs
Was die Überlieferung betrifft, so könnte man aufgrund von Informationen aus der Sekundärliteratur - etwa bei Lachmann (1891) aus dem Fußnotentext zu seiner Transkription des Parzivalromans - annehmen, „agelster“ sei nur in drei späten Handschriften im Nominativ überliefert. Aus den Untersuchungen und der Veröffentlichung sämtlicher Handschriften des Parzivalprologs als Faksimiledruck durch Ulzen (1974) kann man jedoch nach kritischer Durchsicht erkennen, daß „agelster“ dort etwa zehn Mal mit Endungs-r aufgeführt ist, was bedeutet, daß dieses Wort im größeren Teil der vorliegenden Handschriften des Prologs (in verschiedenen Varianten) als Nominativ erscheint, (siehe Liste der Transkriptionen[21] des Textes der Handschriften), während ein behaupteter Akkusativ „agelstern“, der bei allegorischer Deutung vorausgesetzt wird, in den sechzehn Handschriften des Prologs nur vier bzw. drei Mal vorkommt.
In der Transkription des Parzivaltextes hatte Lachmann (1891) sich weitgehend auf die Leithandschrift D gestützt und und das dort bezeugte „agelstern“ vorgezogen. Im Kommentarteil zum Stichwort „agelstern“ bemerkt er lediglich, daß dieses Wort in der Haupthandschrift G als „agelsteren“ zu lesen sei. Dies mag ein Grund dafür sein, daß Martin (Neudruck 1976, S. 4) und andere später davon sprechen, „agelsteren“ sei in G überliefert. Das ist zwar der grammatisch richtige Akkusativ eines möglichen Nominativs „agelster“. Diese Form „agelsteren“ ist aber in der Handschrift G in Wirklichkeit gar nicht überliefert, sondern ergänzt. In der entscheidenden zweiten Hälfte des Wortes „agels“ gibt es einen fast völligen Textverlust. Ob sich der undeutliche Befund folgendermaßen erklären läßt?
Wenn also Lachmann für die eigene Transkription des Parzivaltextes die seiner Meinung nach grammatisch richtige Form „agelsteren“nicht übernimmt, obgleich er sie selbst im Kommentar als Akkusativ für Hss. G so angibt, kann dies bedeuten, daß er die entscheidende Frage nach dem Kasus dieses Wortes aus einem Gefühl der Ungewißheit noch offen lassen wollte ! Für eine solche Annahme spricht, daß er an gleicher Stelle im Kommentarteil seiner Transkription drei Handschriften zitiert, in denen das Wort „agelster“ („agelster“ in gg, „agelaster“ in dg, „aglester“ in d) eindeutig im Nominativ erscheint. Von diesen drei Texten zählt Handschrift „gg“, die angeblich mit Cgm 18 identisch sein soll, zu den ältesten Textzeugen! Unter der Voraussetzung, die hier nicht geteilt wird, daß „agelstern“ nur Objekt des Handelns im Vers 1,6 wäre, hätte also Martin (1976, S. 4) gegenüber Lachmann recht zu sagen, daß die in G angeblich überlieferte Form „agelsteren geeigneter [gewesen sei] den Vers zu füllen“, weil Lachmann es selbst so angegeben hatte. Bei der hier entscheidenden Frage nach dem Subjekt des Elsterngleichnisses (bzw. des Verses 1,6) sollte man sich also nicht davon abhalten lassen, selbst einige als Faksimiles (Anhang) zur Verfügung stehende Handschriften zu befragen.
Auch die Annahme, der Nominativ „agelster“ erscheine nur in späten Handschriften ist unzutreffend ! Im Text der ältesten Leithandschrift G fehlt z.B. der zweite Teil des Wortes „agelster“ bis auf den letzten Buchstaben „t“. Schemenhaft ist auch noch ein vorletzter Buchstabe „r“ zu erkennen. Wenn man die beschädigte Stelle im ausgezeichneten Faksimiledruck des Verlages Müller und Schindler, Stuttgart 1970, mit einer Lupe untersucht, stellt man fest, daß der letzte Buchstabe von „agel“auf keinen Fall ein „n“, sondern ein „t“ ist. Das Wort hieße dann „agelstert“, das sich später zu „agelsterz“ entwickelt haben mag. Damit steht fest, daß die Haupthandschrift „G“ dieses Wort im Nominativ zeigt, es also in der Leithandschrift „G“ Subjekt des Satzes ist. Die zahlreichen Abkömmlinge der Handschrift G bestätigen durch ihre Schreibweise diese These. Darüberhinaus scheint es sich bei „agelstern“ in Handschrift D um ein „moviertes“, d.h. von einem „Maskulinum abgeleitetes Femininum“ (Mettke, 1983, S. 144) zu handeln. Das Handeln, nicht das Aussehen der Elster hat also mit dem zweifelhaften ritterlichen Schicksal etwas tun.
7.5 Das Wort „nachgebur“ in den Handschriften
Die Frage ist hier, ob es sich bei diesem Wort um eine semantisch fixierte Verbindung („nachgebur“ = Nachbar) handelt, oder ob es, nicht zuletzt wegen der getrennten Schreibweise in zahlreichen Handschriften, nicht auch etwas anderes heißen kann oder gar zweideutig verstanden werden soll. Es ist nicht schwer herauszufinden, daß im Wort „gebur“ neben dem „Bauer“ (Landwirt) auch die Bedeutung „Käfig“ enthalten ist. In der untersuchten Sekundärliteratur fanden sich keine Andeutungen oder Kommentare zu derartigen Zweideutigkeiten von „nachgebur“. Weil Nichteindeutigkeit immer schon Vorbehalte provozierte, sollte man auch im Falle von „nachgebur“ die Quellen selbst befragen, die mit den Faksimiles der Prolog-Handschriften durch Ulzen allgemein der Forschung zugänglich gemacht wurden.
Lachmann hatte sich, wie bereits gesagt, bei der Transkription des Textes zwar für „nachgebur“ als einem Wort entschieden. Deshalb mag sich die Meinung eingebürgert haben, es handele sich auch bei getrennter Schreibweise in der Version „nach gebur“, um eine semantisch feste Wortverbindung. Die Annahme aber, daß die getrennte Schreibweise in vielen Handschriften sozusagen ein Beleg für die semantisch festgelegte Bedeutung „Nachbar“ sei, ist nicht haltbar. Sie ist jedenfalls keine philologische Begründung dafür, z.B. in der Transkriptionsliste aller verfügbaren Handschriften des Prologs (Ulzen) dieses Wort durchgehend als ein Wort aufzuführen. Diese Schreibweise stimmt tatsächlich mit den Handschriften weitestgehend nicht überein, ist also auch nicht überliefert, wie man den Eindruck haben könnte !
Es kann und soll nicht bestritten werden, daß es semantisch feste Wortverbindungen von getrennt geschriebenen Wörtern gibt, so daß man im vorliegenden Fall „nach gebur“ als „Nachbar“ übersetzen und auch ungetrennt als ein Wort schreiben kann, wie in der Handschrift „D“. Das funktioniert so bei allen aus einem Grund- und Bestimmungswort zusammengesetzten Wörten. Das Wort „Feder“, im dtv.-Lexikon als Beispiel für eine Äquivokation angegeben, kann einen zwei- oder sogar dreifachen Wortsinn haben (Vogelfeder, Schreibfeder, Uhrfeder). Die zutreffende semantische Festlegung erfolgt im Kontext mit dem jeweiligen Bestimmungswort zum Grundwort.
Die Äquivokation im Falle des Einzelwortes „Bauer“ ist von ganz anderer Art. Das Wort ist semantisch keineswegs so festgelegt, wie ein zusammengesetztes Wort „nachgebur“. Der „Bauer“ kann ein Landwirt oder Vogelkäfig sein. Ob „nach“ und „gebur“, selbst wenn sie unmittelbar nebeneinander stehen, eine semantisch feste Wortverbindung bilden, ist allein Sache des Kontextes mit anderen Wörtern oder eine Sache der Konvention, jedoch keine Regel.
Wolfram von Eschenbach verwendet Äquivokationen im eigentlichen Sinne recht häufig, was sich an vielen Beispielen belegen läßt. - Wenn man also weiß, daß er gerade an der Vieldeutigkeit der Sprache interessiert ist und sie sogar systematisch als Stilmittel verwendet (z.B. um seine Rätsel zu konstruieren), darf man davon ausgehen, daß er primär überhaupt nicht an semantischer Fixierung poetischer Sprache interessiert war, jedenfalls nicht so, wie es ein Historiker oder Jurist schon von berufswegen sein muß.
Für den vorliegenden Fall bedeutet dies: Grundsätzlich sind beide Schreibweisen aber auch beide Interpretationen nicht nur möglich, sondern sogar erwünscht und zwar in dem Sinne, daß der Text als dichterisches Bild einen Vordergrund mit Sujet (z.B. „Nachbar“) hat und dazu einen Text- bzw. Bildhintergrund, auf dem die äquivoken Bedeutungen untereinander und mit dem Vordergrund einen Kontext bilden, um dadurch andere und tiefergehende Assoziationen zu produzieren.
Ein solches Konzept, in dem zwei Bedeutungsebenen zugleich konkurrieren und harmonieren, mußte Gottfried von Straßburg wie „Unfug“, d.h. wie eine Einheit von Sinn und Unsinn erscheinen. Die hier vorgetragene Deutung des Prologtextes, sowohl des Eingangs (1,1-2) als auch des Elsterngleichnisses, besagt deshalb gerade nicht, daß frühere Deutungen etwa „falsch“ sind, sondern auf einem konzeptionellen Hintergrund zusammengehören und eine Einheit bilden. Im Mit- und Gegeneinander machen sie das aus, was m.E. typisch für die Struktur eines dichterischen Bildes bei Wolfram von Eschenbach ist. Wenn Gottfried bei Hartmann von Aue über Gebühr Eindeutigkeit und Klarheit betont, kann man - aufgrund des größtmöglichen Gegensatzes ihrer dichterischen Konzepte - vermuten, daß mit seiner Kritik die literarisch gewollte Offenheit des dichterischen Konzepts Wolframs als zweideutig im negativen Sinne kritisiert werden sollte.
Was die Textüberlieferung von „nachgebur“ im besonderen betrifft, so übernimmt Lachmann es in seiner Transkription des Parzivaltextes (1891, 6. Aufl.) als zusammenhängendes Wort aus der Leithandschrift „D“, dem St. Gallener Codex. Auch hier gibt es keinen Hinweis auf die getrennte Schreibweise von nach gebur, wie sie z.B. auch in den zwei ältesten Münchener Codices Cgm 18 und Cgm 19 zu finden ist. In den heute vorliegenden 16 Faksimiles des Parzivalprologs (Ulzen, 1974) läßt sich das Verhältnis von einheitlicher und getrennter Schreibweise dieses Wortes bzw. dieser Einzelwörter im Verhältnis 6:8 angeben! Bei zwei von sechzehn Handschriften gibt es einen totalen Textverlust des Eingangs, so daß man sagen kann: In der überwiegenden Zahl der verbleibenden Handschriften (nämlich bei 8 von 14) ist die getrennte Schreibweise vorherrschend! - So verdienstvoll es ist, die Handschriften als Faksimiles zugänglich gemacht zu haben, so bedauerlich ist es, wenn in der ihnen beigefügten Transkriptionsliste (Ulzen, 1974, S. 38) „nachgebur“ durchgehend nur als ein Wort verzeichnet ist. So entsteht der Eindruck, als ob die einheitliche Schreibweise von „nachgebur“ (als zusammenhängendes Wort) Überlieferung sei. Selbst wenn man mit Lachmann davon überzeugt ist, daß es sich um semantisch feste Wortverbindungen handelt, die man mit Recht als „Nachbar“ übersetzen könne, ist das kein Grund, die in Textzeugen graphisch fixierte Form von schwerwiegenden Wörtern eines dichterischen Textes indirekt zu korrigieren. Der Mangel ist insofern leicht zu beheben, als man durch einen Vergleich der Faksimiles mit den Eintragungen in der Transkriptionsliste die Fehler selbst korrigieren kann.
7.6 Etymologie des Wortes „agelstern“
Wenn es grundsätzlich richtig ist, wie Mohr sagt, daß man „Wolframs sprachlicher Haltung nicht voll auf den Grund“ kommt, wenn man „nur im Etymologischen sucht“ (Mohr, 1979, S. 229), so kann doch gerade bei der Erklärung des Wortes „agelstern“ die Wortgeschichte eine große Hilfe sein. Bei der bisherigen Suche nach der Entstehungs- bzw. Wortgeschichte von „agelstern“ ging man davon aus, daß das Wort von „agalastra“ abgeleitet werden müsse. Diese Ausgangsposition ist m.E. fragwürdig.
Martin macht im Rückgriff auf das Grimmsche Wörterbuch zu dieser Ableitung folgende kritische Bemerkung: „Das Wort [Elster] ist nicht völlig geklärt; das ahd. agalastra ist wohl zusammengesetzt aus aga =ags. agu ‘pica’ und galster ‘Zaubergesang’: Der häßliche Schrei erklang wie Verwünschung. Die romanische Form franz. agace geht wohl auf eine germanische Koseform zurück, wie diese sonst bei Eigennamen erscheint. Hochdeutsch fiel die eine Silbe - ga - durch Dissimilation aus“ (Martin, 1976, S. 4). Die Silbe „gal“ ist als Stamm noch im nd. „kallen“, engl. „call“, und im hd. „gellen“ oder „Nachti-gallen“ erhalten.
Jakob Grimm (Grimmsches Wörterbuch Stichwort agalaster, f. pica, elster) beurteilt die Wortgeschichte von Elster schon früher äußerst skeptisch. Er zählt eine Reihe von ahd., mhd., nhd und nd. Formen des Wortes auf und stellt abschließend die Frage, auf die es hier ankommt: „haben deutsche ihr wort zu den Romanen getragen oder ein romanisches ihrer sprache assimiliert?“
Weil also die Geschichte eines entscheidenden Wortes keineswegs geklärt ist und in der Sekundärliteratur m.W. kein neuer etymologischer Ableitungsversuch gemacht wurde, darf man sicherlich in der von Grimm angegebenen Richtung nach einer anderen Erklärung suchen: Eine naheliegende Lösung bietet sich dadurch an, daß man bei „agelstern“ - für den ersten Wortteil - unmittelbar auf das mhd. „ageleize“, adj., adv, emsig eifrig schnell“ zurückgehen kann. Es ist wohl so, wie Grimm vermutet, daß hier ein lateinisches Wort „agilis, e, leicht, beweglich, schnell, rasch, tätig, rührig, geschäftig“, das in der gleichen Form (agile) und Bedeutung heute noch in der italienischen und französischen Sprache gebraucht wird, frühzeitig und sinngemäß ins Mittelhochdeutsche übernommen und zu „ageleiz“ umgeformt wurde. Die Verbindung des Wortes „agil“ mit dem Wort „ster“, „stert“ bzw. „sterz“ als Grundwort bietet sich hier relativ selbstverständlich für eine weitere Deutung von „agelster“ an. Das Wort „agil“ ist auf lateinischem Hintergrundwissen durchaus verständlich und gebräuchlich, während „stert“ auch umgangssprachlich noch verstanden wird.
Grimm beschreibt die Entwicklung des Eigenschaftswortes „ster“ (der zweiten Worthälfte von „galster“ oder „agelster“) zum Substantiv („Schwanz“) so: „wie sterzen ‘hervorragen, hervorragen lassen’, zur idg. Basis sterd, einer erweiterung von ster ‘starr, steif sein’[wird],... gehört sterz nicht unmittelbar zum verbum. sterz ist ursprünglich der eher steife, stiel- oder stockartige teil als der hervorragende, vergl. schw. dial. styve ‘vogelschwanz’“. „agelstert“ bedeutet also: Emsiger, eifriger, agiler Vogel mit einem „hervorragenden“, langen Schwanz. Das ist eine durchaus zutreffende Beschreibung des Verhaltens und Aussehens der Elster in ihrem Namen. Analoge Wortbildungen sind im Grimmschen Wörterbuch für mhd. „stërzmeise“ (Schwanzmeise) oder spmhd. „wippstert“ oder „bickstert“ (Bachstelze) belegt. Mit einiger Sicherheit war „stert“ daher auch jene zweiteWorthälfte von „agels...“, (1,6), die in der Leithandschrift G fast ganz verloren ging.
Der größte Teil der sechzehn Prologhandschriften, die als Faksimiles vorliegen, weist „agelster“ als Nominativ aus; das sind 10 Belege. Das Wort „agelstern“, auf „n“ endend erscheint nur drei mal (!), während es sich bei den restlichen Angaben um „Ergänzungen“ handelt, die durch Punktieren als solche gekennzeichnet sind. Damit ist nicht nur von der Wortgeschichte, sondern auch von der handschriftlichen Überlieferung des Textes her gesichert, daß die Elster handelndes Subjekt im Vers 1,6 ist; nicht zuletzt deshalb, weil dieses Wort in der Haupthandschrift G mit hoher Wahrscheinlichkeit als „agelstert“ niedergeschrieben worden war.
Wenn in der Handschrift D anstelle des „t“ der Endungsbuchstabe „n“ bei „agelstern“ erscheint, so kann das durchaus literarische und nicht grammatische Gründe haben. Dasselbe gilt für die zweite Münchener Handschrift Cgm18 aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. In ihr ist das „n“ als Endungsbuchstabe verschwunden; es wird nur „agelster“ bezeugt. In beiden Fällen mag ein explosives „t“ in der Mitte des Verses - neben drei anderen „t“ im selben Vers - den Textfluß sehr gestört haben. Im ersten Fall könnte es durch den Konsonanten „n“ anstelle von „t“ geglättet worden sein; im zweiten Fall (bei Cgm 18) wurde dasselbe durch Elision des störenden „t“ erreicht, sodaß die ursprüngliche und ältere Form „ster“ (Schwanz) in „agelster“ übrig blieb.
Korrekturen im Umgang mit Wörtern lagen im 12. Jahrhundert im Trend der Zeit: „Apokope und Synkope ist bei Wörtern auf -l, -r, -m, -n sehr oft vorhanden“ (Mettke, 1983, S. 148f.). Am selben Ort heißt es über die „mhd. schwache Deklination“: „Jedes Adjektiv konnte mit einem n-Suffix substantiviert und individualisiert werden“ (Mettke, 1983 S. 149). Zum Problem der „Apokopierung und Synkopierung“ bei der Deklination von Feminina (agelster, sw. f) ist wichtig zu wissen: „Substantive auf -n bleiben z.T. ganz unreflektiert.[...] Diese Wörter haben z.T. schon im mhd. Doppelformen: ohne und mit ‘n’ (Mettke, 1983, S. 144)“. Demnach kann „agelstern“ sowohl Akkusativ als auch Nominativ sein; ebenso wie das Wort „varwe“ beides sein kann.
7.7 Das Verhältnis von „zwivel“ - „velle“- „varwe“
Unmittelbar vor der Verfluchung durch die Unheilsbotin Cundrie klärt Wolfram seine Zuhörer darüber auf, wie die Schönheit Parzivals, d.h. die „varwe“ seines „velles“ den „zwivel wol hin kann schaben“ (311,22). Um die Wirkung des schönen Felles gegen das andere zu beschreiben, beginnt er sinngemäß so: „Ich will euch nun von dem „velle“ (Parzivals!) etwas erzählen“:
„ich tuon iu von dem velle kunt“: an dem kinne und an den wangen sin varwe ze einer zangen waer guot: si möhte staete haben, diu den zwivel wol hin kann schaben (311,18-22).
Es wird also erklärt, wie die „varwe“ des „velles“, wenn sie denn genug Festigkeit hätte, gut zu gebrauchen wäre, um ein anderes „Fell“, den inneren zwivel nämlich, „wegzuschaben“. Die Beziehung von „Harnisch und Haut“ in Wechselwirkung mit dem Herzen“, wird damit vom Dichter ausdrücklich als ein „Außen - Innen- Verhältnis“ thematisiert. Der wortwörtliche und innere Zusammenhang von „vel“ und „zwi-vel“, wie er bei der hier vorgelegten Deutung des Eingangs als Äquivokation verstanden wurde, wird damit vom Dichter selbst anerkannt. Noch deutlicher als im o.a. Zitat aus der Handschrift D wird die Beziehung von „velle“ und „zwivel“ in der Haupthandschrift G durch die auffällige Verdoppelung bzw. Wiederholung beider Wörter belegt:
„in troubrem velle dane ware sin munt. (in D: „in trüeberm glase dan waer sin munt“) ich tuon von sinen velle chunt. an dem chinne un an den wange. sin varwe zeiner zange. ware guot die moht staete haben. die der zwifel chunde dan hin schaben. ich meine wip die wenkent unt an ir vriuntschaft uber denchent. sin glast was wibel state ein bant. ir zwifel gar gein im verswant“ (311,17-26).
Die indirekte Aufforderung, nach einer größeren Bandbreite von Deutungen zu suchen, gibt Mohr: „Man kommt Wolframs sprachlicher Haltung jedoch nicht voll auf den Grund, wenn man sein Wörtlichnehmen von Sprache nur im Etymologischen sucht. Er läßt sich von der Bildhaftigkeit der Sprache überraschen, wo sie begegnet, und man liest über sie hinweg, wenn man dafür kein Auge oder Ohr hat. Das fängt bei der ersten Zeile des Parzival an: Ist zwivel herzen nachgebur. Den Bedeutungsgehalt von zwivel sollte man sich so weit offen halten, daß einem die Zeile bei jedem Wiederlesen aufs neue ‘bedenklich’ wird“ (Mohr, 1979, S. 229). (Man vergleiche hierzu meine Ausführungen auf Seite 159-161.)
Dieses Wortwörtlichnehmen entwickelt Wolfram zu einem literarischen Stilmittel von höchster Präzision und Rationalität. So ist sein Spiel mit den äquivoken Bedeutungen von „zwivel“ zugleich albern und ernst gemeint. Wenn bei ihm von „zwei Fell’n in der Nachbarschaft des Herzens“ die Rede ist, wird man darin leicht die „Verspottung“ (d.h. Kritik) des Zwiveldiskurses im „Gregorius“ erkennen. Dasselbe „Stichwort“ („zwei-fel’“) jedoch, mit dem das theologisch und literarisch fragwürdige Konzept des Gegners aufgespießt wird, ist für Wolfram das Mittel zur Versinnlichung des gleichen Problems aus völlig anderer Perspektive. Es übernimmt mit seiner spezifischen Bedeutung eine besondere Funktion im eigenen Sprachspiel als Symbol für Verhüllung und „Eingesperrt-Sein“. Zwischen den verschiedenen Sinnebenen desselben Wortes, zwischen Kritik des Gegners und eigenem Konzept baut sich eine kaum zu überbrückende literarische Polarität auf.
Deshalb ist es m.E. auch nicht richtig zu sagen, Wolfram nähme das „zwivel-Motiv“ Hartmanns aus der „Gregoriuslegende“ auf. Während man sich anfangs noch über die ironische Verknüpfung des Hartmannschen „zwivels“ mit seinem „flügelschlagenden Gegenbild“ im Parzivalprolog [„zwivel (ist)... als agelster ... tuot] amüsiert, bleibt einem das Lachen im „Halse stecken“, wenn man erkennt, welcher Abgrund sich hinter dieser bildhaften Kritik in Wirklichkeit auftut: „daz muoz der sele werden sur“ (1,2).
Mit Bezug auf die Vieldeutigkeit der Sprache des Prologs weist Mohr auf eine Textstelle (311,17-15) hin, die man als Beleg und zum Verständnis des Eingangs im o.a. Sinne heranziehen kann: „Wolframs sprachliche Haltung ist wohl in allen, auch den seltensten Fällen, Anzeichen einer menschlichen Haltung, einer Offenheit gegenüber der Welt, in Freude und Jammer, Begreifen und Nicht-mehr-begreifen-können. Spiel ist es, heiter bis zur Albernheit, nachdenklich bis zum Tiefsinn, in den Altersdichtungen auch hart bis zum Zerbrechen. Nie aber ist es literarische Manier“ (Mohr, 1979, S 230). Die Szene in 311, 17-25 zeigt in ihrem Wortinventar eine klare Entsprechung zum Prologanfang: „Im Lauf der Verse klärt sich das Bild allmählich auf und nimmt Anklänge an den Prolog in sich auf: staete, triuwe, zwivel. Der Sinn, den zwivel hier hat, warnt übrigens auch davor, die Bedeutung des Wortes in der ersten Zeile des Prologs zu starr festzulegen“ (Mohr, 1979, S. 232). Von einer semantischen Festlegung ist dieses Wort ebenso weit entfernt wie „nachgebur“.
Die von Mohr zitierten Verse werden hier für die folgenden Überlegungen um die wichtigen vorangehenden Zeilen 311, 17 bis 19 ergänzt. Sie lassen nämlich erkennen, daß Wolfram im Bild einer „zange“[22] auf das „vel“, als der Hülle des Leibes (die etwas zusammenhält wie eine „zange“) zurückgeht. Im Zusammenwirken mit diesem Farbgrund - das sind die „velle“, von denen in Vers 311, 17 u.18 (in G) die Rede ist - hat die „varwe“ die Aufgabe, zu verhüllen und zu enthüllen. Das Wort hat also in dieser Zuordnung eine aktive Bedeutung und steht damit im Widerspruch zu einer bloß allegorischen Auslegung. - Auf diesem Texthintergrund läßt sich auch erklären, wie es gemeint sein könnte, wenn Wolfram von der „aktiven“ Farbe (bzw. Farbauswahl) spricht, die die Elster nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich durch ihre Wirkung „abstoßend“ („parrieret“) macht. Durch Schönheit des „velles“, nämlich der „varwe“, läßt sich nicht nur etwas „wegradieren“, sondern auch durch Häßlichkeit (Nichtfarbigkeit von schwarz und weiß) dem Menschen bzw. der Elster etwas „Abstoßendes“ applizieren. Davon ist u.a. im Elsterngleichnis die Rede.
Die Frage nach dem Zusammenhang von „zwi-vel“, „velle“ und „varwe“ hat ergeben, daß die „varwe“ erstens kein allegorisches Vergleichsobjekt ist, das sich mit Ungleichem (wie gut oder böse) vergleichen lassen muß; womit die allegorischen Deutungen zumindest fragwürdig geworden sind. Zweitens hat sich herausgestellt, daß das Bild des „zwivels“ mit dem Bild von „Fellen“ konzeptionell verbunden ist. Damit ist allerdings noch nicht geklärt, ob „varwe“ auch Subjekt des Elsterngleichnisses ist. Die Frage ist auch, ob sie handelndes Subjekt im Verhältnis zu mannes muot und dem Subjekt des Eingangs, nämlich „zwivel“, sein kann. Dem steht das Bild der Elster, als „agiler stert“ und die ungelöste Frage nach dem Verhältnis von Eingang und Elsterngleichnis im Wege. Obwohl also „varwe“ praktisch Subjekt des Verses 1,6 sein könnte - davon gehen die allegorischen Übersetzungen aus - ist dieses Wort m.E. dennoch nicht Subjekt des ganzen Elsternvergleichnisses.
7.8 Grammatik und Syntax des Eingangs und Elsterngleichnisses (1,1-1,6)
Entgegen der o.a. „vorläufigen“ Argumentation für „varwe“ als Subjekt lautet die Frage weiterhin: Werden „varwe“ oder „agelstern“ vom Text als Subjekt gestützt? Ist es also vom Text her grammatisch und syntaktisch zulässig zu übersetzen: Die Elster wählt ihre Farben nach dem Prinzip „Alles oder Nichts“ aus. - Aus philologischer Perspektive könnte man dem entgegenhalten, der Kasus von „agelstern“ im Vers 1,6 sei kein Nominativ, sondern ein Genitiv oder Akkusativ, könne also keinesfalls Subjekt sein. In der Konsequenz bedeutet dies: Nicht die Elster „tuot“ der „varwe“ (etwas) an, sondern die „varwe“ der Elster. Das ist, wie oben diskutiert, der satzlogische Hintergrund der üblichen, bisher vorgelegten Übersetzungen.
Im Gegensatz dazu steht aber „agelstern“ am Anfang des Satzes. Von seiner Satzstellung her wird damit signalisiert, daß dieses Wort Subjekt sein soll. Wer kompromißlos behauptet, varwe sei Subjekt, muß erklären können, warum es wider die Regeln der Syntax im Satz an zweiter Stelle - erst nach dem vermeintlichen Objekt (agelstern) - erscheint! Auch die Behauptung „varwe“ sei vom Kasus her einwandfrei als Subjekt zu identifizieren, zieht nicht, weil der Akkusativ dieses Wortes mit dem Nominativ gleichlautend ist. Im übrigen läßt sich auch über den Kasus von „agelstern“ trefflich streiten - oder auch nicht! In der Versübersetzung (1950 S. 473) wird es z.B. bei Stapel ausdrücklich (von ihm in Klammern gesetzt) als Genitiv, „wie (der) Elstern Farbe tut“, gekennzeichnet, während es in seiner Prosaübersetzung als Subjekt des Nebensatzes (Kasus =Nominativ) verstanden wird: „Schmach und Schmuck zugleich trägt der unverzagte Mann, den zuzeiten Verzagtheit überkommt, er ist wie die Elster weiß und schwarz“ (Stapel, 1950, S. 7).
Im Falle von „agelstern“ entscheidet m.E. also auch ein Endungs-n nicht allein darüber, ob ein Nomen Subjekt ist oder nicht. Das Problem ist: „In fast allen Sprachen ist ein Zusammenfall einzelner Kasus eingetreten (=Synkretismus, Verschmelzung). Im Deutschen sind der Abl., Lok., Instr. im Dat. aufgegangen (...) der Vok. stimmt mit dem Nom. überein, aber die Trennung der Kasus wird weiter beseitigt; der Akk. ist gleich dem Nom...“ (Mettke, 1983, S. 135). Über die Schwierigkeit der „Formenbestimmung“ und ihre „Entwicklung im Alt- und Mittelhochdeutschen“ sagt er weiter: „Aber die Funktion der abgefallenen Kasusendungen muß von anderen grammatischen Mitteln übernommen werden, um die syntaktischen Beziehungen klar erkennen zu lassen, z.B. dienen feste Wortstellungen oder Präpositionen dazu (vergl. das Franz. und Engl.)“ (Mettke, 1983, S. 135). - Von der syntaktisch festgelegten Wortstellung her, die wegen des „Zusammenfalls einzelner Kasus“ im 12. Jahrhundert zunehmend wichtiger wurde, dürfte also „varwe“ nicht Subjekt, sondern nur Objekt des Satzes sein.
Interessant ist für den vorliegenden Text darüberhinaus noch, was das mittelhochdeutsche Lexikon („Lexer“) vom „anomalen“ Verbum „tuon“ über das Verhältnis und Verständnis von „tuon“ zu den im Parallelsatz stehenden Verben zu berichten weiß: „tuon an. v. (...), thun, machen, schaffen, geben (mit acc. od. infin. zur umschreibung des einfachen vb.) - tuon kündigt das vb. eines parallelsatzes an, dient zur vertretung eines vorhergehenden vb., in dessen konstruktion es dann in der regel eintritt. - absol. thun, handeln, verfahren, sich verhalten, befinden“. - Das allgemeine Verb „tuon“ und damit auch das „Tun“ der Elster (Vers 1,6) stehen demnach - nicht nur zufällig, sondern aufgrund von Sprachregelungen - mit den besonderen „Tu-Wörtern“ des vorhergehenden Parallelsatzes, nämlich „gesmaehet, gezieret, parrieret“ (1,3-5) in einem Sinnzusammenhang. Diese Verben beziehen sich ihrerseits auf das zweifelhafte Schicksal (zwivel), das sich dem „mannes muot“ parrieret und nicht auf eine „varwe“, die gemäß allegorischer Übereinkunft „böse und gut sein“bedeuten soll. Wenn es also eine reguläre grammatische Beziehung zwischen dem „anomalen“ Verbum „tuon“ und den vorhergehenden Verben gibt, kann dies bedeuten, daß die Elster durch die alternative Auswahl ihrer Farben (des Tageslichts oder der Finsternis) genau so „gesmaehet unde gezieret“ und mit einem unerklärlichen Schicksal „parrieret“ ist, wie der „mannes muot“ mit seinem „zwivel“; was man bei der Elster am Gefieder erkennen kann. Damit wird von grammatischer und syntaktischer Seite die vorliegende „ nicht-allegorische“ Deutung des Verses 1,6 bzw. des Elsterngleichnisses bestätigt. Wenn also:
1. „varwe“ im Vers 1,6 aufgrund des o.a. tendenziellen „Zusammenfalls der Kasus“ sowohl Akkusativ als auch Nominativ sein kann;
2. „varwe“ als Akkusativ in Verbindung mit „tuon“ nur „färben“ heißt;
3. „varwe“ wegen seiner Satzstellung hinter „agelstern“ nach den Regeln der Syntax kein Subjekt sein kann;
4. dieses Wort von dem an Subjektstelle stehenden Wort „agelstern“, das selbst nicht nur Aktivität ausstrahlt, sondern mit seinem Gewicht das Wort „varwe“ überlagert, so daß man ihm die Rolle des Subjekts nicht zutraut;
5. das entscheidende Verb „tuon“ gar nicht primär mit der „varwe“, sondern eher mit den vorhergehenden Verben (insbesondere parrieren), vor allem aber mit „agelstern“ etwas zu tun hat;
6. da alles so ist, darf schließlich gefragt werden, ob „agelstern“ trotz seines Endungs-„n“ in der Haupthandschrift D, an dem man einen Akkusativ zu erkennen glaubt, nicht doch eher die literarische Form eines Nominativ „agelstern“ ist und aus diesem Grunde das Subjekt dieses Satzes sein kann. Es gibt folgende Gründe, die für diese Annahme sprechen.
7.9 Das Subjekt von Eingang und Elsterngleichnis
Allegorische Übersetzungen und Deutungen des Prologs, so plausibel sie auch zu sein scheinen, können keineswegs die syntaktischen und grammatischen Zusammenhänge zwischen Eingang (1,1-2) und Elsterngleichnis (1,3-14) erklären, weil die literarische Form ihrer Satzglieder (als Subjekte-Prädikate-Objekte) im Prolog wie die Kettenringe einer Rüstung ineinander greifen. So ist m.E. der „zwi-vel“ - als ritterliches Schicksal im Eingang des Prologs beschrieben - auch das unausgesprochene Subjekt der folgenden Verse 1,3-5. Er (der zwivel) ist als Pronomen, wie vom Lateinischen (est = er, sie, es ist) her bekannt, im Hilfsverb „ist“ des auf den Eingang (1,1-2) folgenden mehrgliedrigen Versgefüges (durch Enjambement verknüpft!) enthalten: Der erste Textteil lautet: „gesmaehet unde gezieret ist“. Dies ist die nicht versgebundene Form eines Satzes, in dem „ist“ am Satzende ein wenig deplaziert erscheint. Durch synkopische Verschiebung des Hilfsverbs vom letzten Platz auf den Anfang des folgenden Verses wird das äußerst bescheidene Hilfszeitwort „ist“ literarisch exponiert und stark aufgewertet. O ptisch, akustisch und durch seine analoge Form („ist swa“) wird es zu „ist zwivel“ und damit zum Anfang (!) in Beziehung gesetzt. In dieser hervorgehobenen Position wird es gleichzeitig auch noch mit dem folgenden Verbum „sich parrieret“ (1,4) verknüpft. Nicht nur das!
Die Konjugationsform „ist“ läßt sich ohne weiteres grammatisch als die 3. Person Singular des Hilfsverbs „sein“ identifizieren. Innerhalb des literarischen Kontextes bezieht sich „ist“ - wenn auch unausgesprochen - auf drei Personalpronomina „er-sie-es“. Normalerweise tritt nur eines von ihnen (z.B. „er ist“) als Subjekt zum Hilfsverb in Beziehung und wird auch dezidiert ausgesprochen. - Die Frage, warum Wolfram es nicht tut, sondern die übliche Ausdrucksweise variiert, läßt sich so beantworten: Durch Weglassen eines bestimmten Pronomens als Subjekt (von den drei möglichen) ergeben sich im vorliegenden literarisch-grammatischen Zusammenhang mehrere Deutungsmöglichkeiten. Sie zielen - mit einem gewissen Verstärkereffekt - alle in eine, d.h. folgende Richtung:
1. „ er ist “ kann sich auf „zwivel“ beziehen und würde bedeuten „gesmaehet und gezieret ist er, nämlich der „zwivel“;
2. im Falle von „ es ist “ zielt „ist“ auf „ daz “ als Anfang und Subjekt des zweiten Verses („daz muoz der seele werden sur“, 1,2). In „daz“ wird, wie bereits gesagt - die Summe des im ersten Vers über „zwivel“ Gesagten als ritterliches Schicksal verstanden (vergl. auch Hempel, 1951/52 S.167). Insofern wird hier der „zwivel“ als Subjekt im erweiterten Sinne (Amplifikation!) angesprochen;
3. wenn man „ sie ist “ als dritte Variante akzeptiert, ist neben den möglichen Subjekten „zwivel“, und „ritterliches Schicksal“ auch die Elster (mhd. agelster swf.) als lebender bzw. „vliegender“ Prototyp des „zwi-vels“ mit im Spiel als seine Illumination. Durch die grammatische Konstruktion der Verse wird so eine literarische Beziehung von „agelstern“ und „zwivel“ hergestellt. Die dritte Version würde als Deutung etwa so lauten: Sie (die Elster als vliegendes bispel) wird zugleich verachtet und verehrt, wo sie, etymologisch wie der „zwivel“ (adj. „zwei arten habend“), dem mannes muot parrieret, bzw. verglichen wird, weil sie sich ihre Farben nach dem Prinzip des größtmöglichen Gegensatzes (als Farbe von Tag und Nacht) ausgesucht hat. Diese Deutung wird nahegelegt, wenn man „parrieren“ mit seinem grammatischen Bezug auf „tuon“ so deutet, wie Benecke: „etwas setzen, das durch sein äusseres ansehen oder auch durch seine innere natur verschieden ist, zwischen oder neben ein anderes; durch diese gegensetzung abstechend machen“ (zitiert nach Tonomura 1971, S. 154).
So wird auf grammatisch einfache Weise die dreifache Beziehung zwischen „Eingang“ und „Elsterngleichnis“ gesichert und die fiktive Einheit beider hergestellt. Wolfram bedient sich hier des künstlerischen Mittels der Polarität, um eine besondere Wirkung zu erzielen: er sagt nicht, was nur auf einem viel umständlicheren und längeren Wege zu sagen oder zu erraten wäre (denn: „dâ vüere ein langez maere mite“! 3,27), sondern überläßt dem Hörer, das bewußt „Nichtgesagte“ von sich aus zu ergänzen. - Das geschieht nicht willkürlich, wie von Tonomura an einem anderen Beispiel gezeigt wurde. Die Tendenz dieser möglichen „Ergänzung“ ist in der grammatisch unvollständigen Konjugationsform von „sein“ als „ist“ ohne Pronomen vorgegeben und definiert (d.h. eingegrenzt). Es wird also keine (selbstgemachte!) Textlücke willkürlich ergänzt. Hier fordert eine bewußt ausgewählte literarisch-grammatische Form die Hörer dazu heraus, an der Sinnerschließung des Textes produktiv mitzuwirken. Der Sinn liegt jenseits der Grenze dessen, was man mit Worten sagen kann. Selbst etwas zu sein - wenn auch nur in der Form eines Kunstwerkes durch Beisteuer (stiure) - ist wichtiger als nur etwas zu bedeuten. Die auffällige Verwendung von „ist“ als „Hilfs-Zeit-Wort“ und Beugungsform von „sein“ bestätigt dies. Dieser Vorgang ist ein „samnen unde brechen“ (337,23-26) der Zeit im Medium des Wortes: Ihre „Verdichtung“ durch künstlerische Mittel.
„Zwei-fell“ als Subjekt bzw. ritterliches Schicksal im Eingang (1,1-2) des Prologs ist also sinngemäß und grammatisch auch das unausgesprochene Subjekt des folgenden Satzes „gesmaehet unde gezieret ist swa [...] “. Es ist im Hilfsverb „ist“ enthalten. Die hier bevorzugte Deutung würde lauten: Er (der „zwivel“) wird verachtet und verehrt, wo er sich dem mannes muot so verbindet, wie die Elster dies mit den Farben tut. Das Bild der Elster im Nebensatz („als agelstern varwe tuot“) korrespondiert also primär mit „zwivel“ und nicht „mannes muot“. Nicht, „ daß“ die Elster sich färbt, ist wichtig, sondern „ wie “ sie es alternativ nach dem Prinzip von „Alles und Nichts“ tuot. Sie wählt alle Farben und oder keine und macht sich durch diese Gegensetzung selbst farblich „abstoßend“. „Da Wolfram Farben als Lichtqualitäten wahrnimmt“ (Mohr, 1979, S. 231), stehen hier nur „Licht und Schatten“ bzw. die Farben von „Tag und Nacht“ zur Auswahl.
Diese Interpretation hängt nicht von der Deutung des Bickelwortvorwurfs im Literaturstreit ab, sondern von den literarischen Vorgaben in der Syntax und Grammatik der Verse 1,3-6, konkret von der Frage, wer außer dem „zwivel“ Subjekt und Objekt im sogenannten Elsterngleichnis insbesondere im Vers 1,6 („als agelstern varwe tuot“) ist.
7.10 Probleme bei der allegorischen Deutung des Parzivalprologs
Anhand einiger Beispiele soll noch auf einige Probleme der allegorischen Auslegung des Parzivalprologs aufmerksam gemacht werden. Die literarisch und grammatisch gesicherte Einheit von Eingang und Gleichnis wird m.E. durch jede allegorische Deutung zwangsläufig in Frage gestellt. Wenn sie überzeugend sein soll, muß man „tricksen“, beispielsweise E rgänzungen zum Text erfinden , um das vermeintliche Fehlen des Satzsubjektes in 1,3-6 auszugleichen oder auch Textteile wegfallen zu lassen. Dadurch kann es zu Sinnenstellungen kommen.
Brall (1983, S.160) hat ausdrücklich auf das Problem der Allegorese des Parzivalprologs hingewiesen. Tonomura (1971, S. 156 f.) befaßt sich mit dem speziellen Problem unzulässiger Ergänzungen des Textes im Gefolge allegorischer Deutung: „Bei dieser Auslegung muß man notwendigerweise das ergänzen, was mit unverzaget mannes muot in Verbindung stehen soll, insofern es im Text fehlt“. Man weiß z.B. nicht, was (oder wer) „gesmaehet, gezieret und parrieret“ werden soll; also wird ergänzt, was zum „mannes muot“ zwar nicht recht paßt, aber mit „zwivel“ etwas zu tun hat: Wankelmut, Feigheit Mißtrauen usw. Am Beispiel des Wortes „parrieren“ demonstriert Tonomura den von ihm kritisierten Sachverhalt konkret so: „Das Ergänzungswort ist bei Bartsch und Martin ‘Gegenteil’ und bei Stapel, Maurer und Rupp dessen konkreter Begriff ‘Zagheit’ bzw. ‘Verzagtheit’.[.. ] es dürfte wohl eine bessere Lösung sein, wenn man den Satz ohne Ergänzung verstehen könnte. Wir meinen damit, daß sich parrieren von 1,4.[..] ‘sich bunt machen’, ‘scheckig werden’ bedeutet. Der Satz braucht dann keine Ergänzung“ (Tonomura, 1971, S. 157). Er selbst schlägt folgende Übersetzung vor, die „keine Ergänzung“ braucht: „Schande und Ehre sind da, wo unverzaget mannes muot schwarzweiß wird wie die Farbe der Elster.“
Bei dieser Deutung werden die Verben „gesmaehet unde gezieret“ substantiviert und zu Subjekten eines neuen Hauptsatzes gemacht, obwohl das Hilfsverb „ist“, mit dem sie verbunden sind, nur auf ein Subjekt schließen läßt. Durch diese Übersetzung ist zwar die Ergänzung eines Subjektes im o. a. S. nicht mehr nötig; dafür entsteht aber ein anderes Problem: die willkürliche Entfernung einer anderen wichtigen Textstelle. Wenn nämlich „parrieren“ schon sich „bunt machen“ heißt, hat man keine Verwendung mehr für „varwe tuot“. Was geschieht also mit dem im Text scheinbar überflüssig gewordenen anomalen Verbum „tuot“ bzw. „varwe tuot“? Es heißt im Kontext mit „varwe“ als Akk. „färben“, so wie parrieren „bunt machen“ bedeuten kann.
Beide Verben können m.E. aber nicht synonym gebraucht werden, wie Tonomura es in der eigenen, ebenfalls nur allegorisch zu verstehenden Übersetzung indirekt tut. Sie haben einen je eigenen Sinn: Es soll wohl primär gesagt werden, daß der „zwivel, wo er sich dem mannes muot parrieret, diesem in „abstoßender Weise“ ein Aussehen verleiht, d.h. Farbe gibt. Dies gilt auch für die Elster. „Färben“ im ursprünglichen Sinne ist immer etwas Positives. Im Russischen gibt es nur ein einziges Wort für rot und schön. Zu der Farbe „rot“ wird in der Regel im positiven Sinne „Blut“ assoziiert, was Leben heißt und schön ist. - Nicht ohne Grund hat die Komplementärfarbe dazu, nämlich „grün“, für Wüstenbewohner eine ähnliche Bedeutung: Oase - Schönheit - Wasser - Überleben. Diese Farben sind natürliche Sinnbilder des Lebens, wie sie für Ideologien Symbole eines „besseren Lebens“ sind, sowohl für das diesseitige als auch das jenseitige: Rot signalisierte es im Kommunismus, die Komplementärfarbe grün im Islam. Man kann leicht nachvollziehen, daß auf einem ähnlichen lebensnahen Erfahrungshintergrund „Farblosigkeit“ bzw. „Lichtlosigkeit“ oder die Mischung von Helligkeit und Dunkelheit (z.B ein trüber Tag) als „abstoßend“ (vergl. Beneckes Deutung von „parrieren“) empfunden werden kann.
Allegorische Deutungen der Prologverse 1,3-6, die „Ergänzungen“ im o.a. Sinne brauchen, gehen m.E. von einem Mißverständnis des Textes aus. Man kann „gesmaehet unde gezieret / ist swa sich parrieret / unverzaget mannes muot“nicht etwa übersetzen: „verachtet und verehrt ist, was sich dem unverzagten m. m. verbindet“, sondern nur:„verachtet und verehrt ist wo (er-sie-es als Subjekt!) sich dem mannes muot so verbindet, wie es die Elster mit der Farbe tut.“ - Die unmittelbare Nachbarschaft von „swa“ (wo!) und „sich“ im Text verleitet dazu, den ersten Buchstaben (s) des Wortes „sich“ akustisch dem vorhergehenden „swa“ anzuhängen, so daß aus der adverbialen Bestimmung (Bestimmung des Ortes, „wo“ sich mit dem Subjekt etwas ereignet!) nun das Relativpronomen „swaz“ entsteht. Dieser grammatische Fehler verleitet dann dazu, nach dem zu suchen, „ was “ sich, als vermeintlich fehlendes eigenes Handlungs- und Satzsubjekt der Verse 1,3-6, dem mannes muot verbindet.
Abschließend seien auch noch einige Bemerkungen zum alles entscheidendenVerhältnis von „zwivel“ und „agelstern“ erlaubt, welches über das tertium comparationis „vel“ vermittelt wird. Daß die Assoziation „velle“ (bzw. „Felle“) im Umgang mit „zwivel“ nicht nur erlaubt, sondern notwendig ist, um den Sinn eines dichterischen Bildes zu enträtseln, konnte hier durch den Rückgang auf die Textstelle 311, 17-26 (In Hss. D und G!) eindeutig belegt werden. Dieses Wörtlichnehmen-Dürfen des Textes, das der Dichter am Beispiel „velle“ selbst expliziert, hat m.E. unmittelbare Folgen für ein allegorisches Verständnis der Dichtung: Es wird in diesem Fall damit ausgeschlossen.
Die literarischen Beziehungen von „zwivel“, „vel“ und „agelstern“ waren bereits an anderer Stelle im Zusammenhang mit der Grammatik des Textes erörtert worden. Anhand des Hilfsverbs „ist“ konnte eine dreifache Beziehung zwischen Eingang und Elsterngleichnis nachgewiesen werden. Diese Deutung läßt sich durch die folgenden Überlegung stützen: Die der Allegorese zugrundeliegende „Folgerichtigkeit“ - drastischer gesagt, die Logik der rhetorischen Floskeln - hat mit Realität wenig bzw. gar nichts zu tun. Sie schwebt wie eine Wolke über der Wirklichkeit des geschichtlichen Selbst- und Weltverstehens. Wolfram macht nun nichts anderes, als daß er - um im Bild zu bleiben - dieses freischwebende Verhältnis von oben und unten „erdet“. Dadurch kommt es zu einer „geistes-blitzartigen“ Verkürzung der Beziehung von Sprache und Wirklichkeit, d.h. zu einem „literarischen Kurzschluß“ im positiven Sinne. Das läßt sich am Umgang mit dem Wort „zwivel“ stichwortartig belegen:
1. „zwivel“ leitet sich etymologisch von „zwifal“ „zwei arten habend“ ab. Die allgemeine Vorstellung von Zweifel hat also stets mit „einem Zweierlei“ von irgendetwas zu tun.
2. „zwivel“ heißt aber auch - wortwörtlich und im spezifischen Sinne - zwei „velle“ habend; wie im Text in 311,17-19 und anderswo („iser unde vel“) indirekt belegt ist.
3. Wenn man nun die allgemeine Bedeutung (Nr.1) inhaltlich mit der besonderen (Nr.2) assoziiert, ergibt sich folgende Version von „zwivel“: „zwei arten von vellen habend“. Das heißt im vorliegenden Fall Elster und (oder) im übertragenen Sinne Mensch zu sein.
Dieser assoziative Hintergrund läßt ahnen, daß im Eingang und Elsterngleichnis „zwivel“ und „agelster“ per „Definition“ als die allgemeine und besondere Erscheinungsform des „zwivels“ zusammengehören. Auf unkonventionelle Weise stellt Wolfram die Beziehung von Wortgeschichte und Wörtlichkeit im Text her. Indem er so verschiedene Bedeutungsebenen miteinander verbindet, schafft er die Basis für die „radikale“ Bildhaftigkeit und Realitätsnähe seiner Sprache, die im literarisch-künstlerischen Sinne unnachahmlich und rational „unbegreiflich“ ist. Sein Stil richtet sich nicht zuletzt gegen die Erklärung der Welt mit den Leerformeln eines angeblichen Schriftsinnes.
7.11 Ist das Elsterngleichnis eine „Gregorius“-Parodie?
Aus der Überlieferung von „agelster“ in den Handschriften, in denen diese (bis auf drei) als handelndes Subjekt belegt ist, und der hier vorgelegten grundsätzlich anderen etymologischen Ableitung des Wortes „agelster“ ergibt sich, daß dem Namen der Elster - in seiner Grundbedeutung „agiler-ster(t)“ - mehr Gewicht beigemessen werden muß. Wer die Elster und ihr Verhalten kennt, wird zugeben, daß diese etymologische Ableitung überzeugender ist als jene von „agalastra“, dem singenden, aus der Antike stammenden Zaubervogel; eine Deutung, von der schon J. Grimm nicht ganz überzeugt war. Weil bei Wolfram von Eschenbach alle Namen bedeutungsvoll sind, ist es erstaunlich, daß man dem Namen „agelster“ (außer im Elsterngleichnis) in der Forschung bisher wenig oder gar keine Aufmerksamkeit geschenkt hat.
Aufgrund der Wortgeschichte von Elster liegt der Verdacht nahe, Wolfram habe nicht nur den „zwivel“- Begriff durch Aufnahme des „zwivel“-Motivs kritisieren, sondern auch die Hauptfigur des „Gregorius“ selbst als „agel-ster“ parodieren wollen. Diese Einschätzung steht nicht im Widerspruch zu der Annahme, die hier vertreten wird, daß die Figur der Elster sozusagen als „personifizierter zwivel“ in den Zusammenhang von Eingang und Elsterngleichnis, d.h. in das Konzept des Wolframschen Menschenbildes im Parzivalprolog voll integriert ist. Dennoch stellt sich die Frage: Soll im Bild der Elster, ihrer wichtigtuerisch-krächzenden, flügelschlagend-schwanzwippenden, Aufmerksamkeit-heischenden, dazu noch mit einem zweideutigen Namen versehenen Figur, ein ironisch-erotischer gefärbter Kommentar zur Figur des „Gregorius“ abgegeben werden? Läßt sich u.U. das Verhältnis von Elster und Gregorius mit dem des Pferdes zu Erec in der „Erec“-Satire vergleichen?
Eine Variante in der Deutung des Elsterngleichnisses, wie sie sich in dieser Fragestellung andeutet, mag entsprechend der Vorgabe des Dichters, manchen „liuten gar ze snel“ (1,16 f.) erscheinen. Dennoch könnte man sich vorstellen, daß ein solches Verständnis die Kehrseite derselben Medaille ist. Eine solche gewöhnungsbedürftig Fragestellung sollte man m.E. nicht ganz außer acht lassen.
Wäre es also nicht denkbar, daß Wolfram im Bild eines „komisch sprechenden“, dreisten Vogels, der dazu „namentlich“ und in natura mit einem „agilen stert“ ausgestattet ist, das werbewirksame Auftreten und die Dreistigkeit des Helden „Gregorius“ parodieren wollte, der die „abstoßendste“ Seite der Sexualtät, nämlich den Inzest, mit dem religiösen Thema Glauben zu einem pseudo-theologisch-sexologischen Diskurs verquirlte? Hatte Hartmann nicht in seinem literarischen Konzept das zu „Schmähende mit dem zu Verehrenden“ auf gewaltsame und „abstoßende Weise“ miteinander und mit dem mannes muot gepaart; „parrieret“, wie Wolfram im Prolog sagt? - Durch diese Manipulation wurde die „Heilige Wissenschaft“ (als die sich Theologie verstand) zum Vorwand, sich u.a. inhaltlich dem „Thema Nr.1“, Sexualität und Erotik, zu widmen, dazu noch in einer formal ebenfalls abstoßenden Weise: Geheucheltes Interesse an Theologie, wirkliches Interesse an einer „sensationellen“ Fehlform der Sexualität, dem Inzest.
Wenn man nach den Gründen für die harte Kritik Wolframs fragt, scheint es - außer dem dichterischen Konzept - vor allem der gesellschaftliche und literarische Geltungsanspruch Hartmanns gewesen zu sein, durch den er sich herausgefordert fühlte. In einer englisch-amerikanischen Kurzformel kommt die gemeinsame Wurzel allen menschlichen Geltungstrebens, das hier die entscheidende Rolle spielt, deutlich zum Vorschein: In Amerika spricht man z.B. in einem Atemzug von „common appeal and sex appeal“. Daß diese Formel in der Alten und Neuen Welt auch in negativem Sinn ihre Gültigkeit erwiesen hat, braucht nicht eigens durch abstoßende Beweise belegt zu werden.
Weil Mord und Totschlag, ähnlich wie im 12. Jahrhundert, die Sensationsgier nicht mehr befriedigen konnten, mußten - damals wie heute - andere Themen her, z.B. der Inzest. Wie zur Veranschaulichung des hier diskutierten Problems aus dem 12. Jahrhundert, spielt sich gegenwärtig, d.h. im 20 Jahrhundert, ein ähnlich gelagerter Fall als Theater vor den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit ab: In sogenannter „Ausübung richterlicher Gewalt“ und zum Zwecke angeblicher „Wahrheitsfindung“ und der Durchsetzung von „Recht und „Gerechtigkeit“ wird der Fall eines elfjährigen Jungen (Kindes) behandelt, der mit seiner jüngeren Schwester angeblich Inzest betrieben haben soll. Der Fall selbst soll hier nicht kommentiert werden. Eins steht jedoch fest: An der professionellen Heuchelei in den Medien Presse, Funk und Fernsehen und durch gesellschaftlichen Konsum des Themas „Inzest“ werden enorme Gewinne in der Form von Geld und Geltung verbucht.
Ebenso selbstverständlich wie Hartmann war Wolfram von Eschenbach an Sexualität und Erotik in hohem Maße interessiert. Er machte keinen Hehl daraus, daß er Freude daran hatte. Was ihn am literarischen Konzept des „Gregorius“ erbost haben muß, war die nicht zu übersehende „vogel-heit“ (Lexer:„vogel-heit stf. zu starker geschlechtstrieb, geilheit“), um einen passenden mittelalterlichen Ausdruck zu verwenden. Es wäre verwunderlich gewesen, wenn er auf eine Kritik des „geilen“ Konzeptes der Gregoriuslegende Hartmanns von Aue verzichtet hätte. In diesem Sinne kann man im Bild der Elster mit dem zweideutigen Namen „agelster“ durchaus eine Parodie des „Helden“ der „Heiligenlegende“ sehen. Sie ist vernichtende Kritik durch „Lächerlichmachung“ und Verballhornung einer sensationslüsternen, erniedrigenden Betrachtungsweise der - gerade von Wolfram von Eschenbach - hochgeschätzten und menschlichsten Dinge der Welt, Sexualität und Religion.
Die abartige Kommunikationsform, jemandem „den Vogel zu zeigen“, ist die nicht ganz salonfähige Art, einem anderen aus irgendeinem Grunde seine Geringschätzung zu vermitteln. Wolfram zeigt mit der Elster zwar auch jemandem einen „komischen Vogel“ als Spiegelbild seines Verhaltens. Man kann ihm aber deswegen nicht den Vorwurf einer persönlichen Beleidigung eines anderen machen. Erstens ist die Form dieser Kritik so verschlüsselt, daß man sie u.U. gar nicht bemerkt oder auf den ersten Blick erkennt. Expressis verbis ist im Text ohnehin nichts gesagt. Zweitens appliziert Wolfram seine Kritik nicht der Person des Gegenspielers, sondern der Figur seiner Dichtung. Drittens wird die Elster, obwohl sie Ausdrucksträger der gegen Hartmann gerichteten Parodie ist, von Wolfram dem Konzept der eigenen Dichtung einverleibt und zur handelnden Figur umgepolt.
Dasselbe gilt übrigens für den „zwivel“. Das, was Wolfram am Hartmannschen „zwivel“-Konzept kritisiert, läßt sich im Eingang des Parzivalprologs m.E. als eine Hälfte, die dunkle Seite des „zwi-vels“ erahnen. Von dieser dunklen Hälfte des Menschenbildes bei Hartmann schließt er sich selbst nicht aus; sie wird nur nicht gutgeheißen. Ausdrücklich stellt Wolfram für sich und seinen Helden fest: gesmaehet unde gezieret / ist swa sich parrieret / unverzaget mannes muot / als agelster varwe tuot“. Das bedeutet: der „zwivel“ ist menschliches Schicksal für jeden, und jedermann verhält sich im Grunde wie die „Elster“. - Die besondere Kritik an der Dichtung des Kontrahenten geht also nach einer Metamorphose des kritisierten Motivs nahtlos in das eigene Konzept über. Insofern ist das Verhältnis Hartmanns von Aue und Wolframs von Eschenbach durch eine eigentümliche Mischung aus Akzeptanz und Ablehnung gekennzeichnet. Man ist versucht zu sagen: Sie sind durch eine Haß-Liebe miteinander verbunden.
7.12 Nachtrag zur Bickelwortinterpretation
Die Deutung des Literaturstreites anhand der relativ pragmatischen Bickelwortanalyse hat eine hohe Priorität; nicht zuletzt deshalb, weil sich ihre Annahmen für das Verstehen des Parzivalprologs als brauchbar erwiesen. Im Zuge des Revisionsverfahrens vorliegender Dissertation wurde deshalb nachdrücklich gefordert, in der Sekundärliteratur noch einen Beleg zu suchen, „ daß um 1210 ein ähnliches Verständnis von bickelwort denkbar ist, wie das, was [der Autor] vorführt “. Die Frage lautet also, ob Knöchelspiele im 12. Jahrhundert nach ähnlichen Regeln gespielt wurden, wie sie im Rahmen dieser Studie aus Formen und Funktionen der Bickel und der statistischen Auswertung von Spielversuchen deduziert worden waren.
Die naheliegende Idee, aus den für die Germanistik wiederentdeckten Bickeln nach künstlerischen Gesichtspunkten Strukturen eines Glücksspieles abzuleiten, ergab sich daraus, daß trotz intensiver Suche in Nachschlagewerken und germanistischer Sekundärliteratur keine Regeln dafür zu finden waren. Auch in Computernetzen und im Internet waren zu dieser Frage zunächst keine Antworten zu finden. Das galt auch für Wörter, wie „talus“, „topel“ „astralagi“, „hasard“ u.a., die mit Bickeln und einem Glücksspiel etwas zu tun haben.
Für Geschicklichkeitsspiele mit denselben Bickelwürfeln, d.h. für einstmals beliebte Kinderspiele der Mädchen, gibt es umfangreiche Untersuchungen im volkskundlichen Bereich. Genaue Spielregeln dafür werden von Irmgard Simon im Anhang zu ihrer Arbeit über „Knöchel- und Steinchenspiele in Westfalen“ (1990) und im „Rheinischen Wörterbuch“ (1. Bd. S. 676) vorgelegt. Regeln für das schon in der Antike und im Mittelalter verbotene, zweifelhafte Glücksspiel mit Bickeln, das im o.g. Literaturstreit von Bedeutung ist, sind auch hier nicht ausfindig zu machen. Die interessante und in viele Einzelheiten gehende Untersuchung erstreckt sich über einen Zeitraum von der Antike bis ins 19. Jahrhundert.
Simon (1990, S. 120) spricht davon, daß wir „Dank guter wissenschaftlicher Aufarbeitung [...] eine ziemlich klare Vorstellung vom Astragalus als Universalspielgerät“ in der Antike besitzen. Sie selbst identifiziert fünf Arten von Knöchelspielen; drei davon sind Geschicklichkeitsspiele und zwei Glücks- bzw. Hasardspiele, die hauptsächlich von Männern bzw. Erwachsenen gespielt wurden. „Nach den meisten Berichten bestand das komplette Spielgerät, wie schon erwähnt, aus vier Spielknöcheln und einem Ball“ (Simon 1990, S. 132), während beim Glücksspiel in der Regel ein Würfelbecher benutzt wurde.
Über Glückspiele bis zum Ende des 19. Jahrhunderts enthält „nur ein einzelner Archivbericht Mitteilungen darüber, daß man ‘in ländlichen Schenken mit Vorliebe Bickelknochen’ zum Würfeln verwendet hat. Als besondere Spielergruppe werden die sog. Kohlentreiber angegeben, denen ‘das Geld bekanntlich sehr locker’ gesessen habe. Die Spielregeln konnte der Berichterstatter nicht mehr in Erfahrung bringen, doch sei es, wie er schreibt, eines der gefährlichsten Glücksspiele gewesen“ (Simon, 1990, S. 140f.). In einer Fußnote hierzu heißt es: „In den 90er Jahren (19. Jahrh. d.V.) sei ein Metzgermeister beim Knöchel-Würfelspiel auf der Zugfahrt zum Elberfelder Viehmarkt um seine ganze Existenz gebracht worden“.
Die meisten Knöchel wurden den Fußgelenken von Ziegen und Schafen entnommen. Die „ältere Generation habe (jedoch) mit Knöcheln vom Schweinefuß gespielt“. Unter Bezug auf einen „Gewährsmann“ wird weiterhin berichtet, „daß alte Leute hie und da behaupteten, die ‘echten’ Bickelknochen müßten von den Gelenkknochen eines wilden Tiers stammen. Am begehrtesten seien die Knöchel eines Wildschweines gewesen“ (Simon, 1990, S. 130 f.).
Zur Geschichte dieses Spieles bemerkt Simon (1990, S. 120): „In Hissarlik-Troya fand Schliemann viele Schafsknöchel (Lemke 1906 S. 47)“. In den „MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA Bd. XVI, Chronika pontificum Romanorum“ wird bestätigt, daß in bzw. vor Troya das Spiel mit Knöcheln erfunden worden sein soll: „Fertur, quod in ista civitate ludus taxillarum sit inventus. Ibique Hercules suffocavit gigantem“ (Thomas Ebendorfer 1994, S. 279). Auch Isidor von Sevilla (um 6oo) befaßt sich in Liber VIII (De bello et ludis) seines etymologischen Wörterbuchs („Isidori Hispalensis Episkopi Etymologiarum sive Originum“) mit Würfelspielen und ihren Gefahren: „Proinde nihil esse debet Christiano cum Circensi insania, cum inpudicitia theatri,.[...] cum luxuria ludi. Deum enim negat qui talia praesumit...“ (Isidor, Lib VIII, liii-lxiv). Nachdem er in je zwei kurzen Sätzen Calculis, Tesseris und andere beschreibt, macht er eine interessante Bemerkung über jene Würfelspieler (in: „de figuris aleae“), die sich durch die Natürlichkeit der Formen veranlaßt sehen, die Kunst der Würfelbilder zu üben: „Quidam autem aleatores sibi videntur phsyiologice per allegoriam hanc artem exercere“ (Isidor Lib. VIII, liii- lxiv). Damit sind offensichtlich Knochen als Würfel gemeint. Über Spielregeln, die ihrem Aussehen und Funktionieren (und nicht einem Zahlensystem) entsprechen, erfährt man leider nichts.
Die Ergebnisse umfangreicher Recherchen im Bereich der Volks- bzw. Kulturkunde sollen hier nur insoweit referiert werden, als sie für die genannte Problemstellung relevant sind, denn Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der Parzivalprolog und nicht ein historisches Bickelspiel. Die eigenen Erfahrungen im Umgang mit dem Bickelspiel und die Deduktion eines Regelsytems aus den charakteristischen plastischen Formen und der besonderen Funktionsweise der Würfel, deren Ergebnisse durch Versuchsreihen empirisch-statistisch abgesichert wurden, kennzeichnen eigentlich nur ein Übergangsstadium innerhalb der Studie. Die Ergebnisse der literarischen Studie selbst bestätigen - unabhängig davon, ob historische Prämissen ein antikes Spielsystem bestätigen oder nicht - die Folgerichtigkeit und „Nützlichkeit“ des mit der Deduktion eingeschlagenen Weges, m.a.W.: das relativ abstrakte Zwischenstadium könnte man auf sich beruhen lassen, weil es seinen Zweck erfüllt hat.
Andererseits weiß man erst aufgrund des „abstrakten Umweges“, wonach in der Sekundärliteratur gesucht werden sollte. Die Ähnlichkeit zwischen abstrakt formulierten und zumindest teilweise wiedergefundenen historischen Glücksspielregeln, auf die im folgenden Bezug genommen wird, könnten konkret veranschaulichen, was im o.a. „Übergangsstadium“ als Gegensatz von „alles und nichts“, „positiv und negativ“, „gut und böse“ nur abstrakt beschrieben wurde. Bei dem antiken Knöchelspiel, über das Rohlfs berichtet, entscheidet z.B. ein Glücks- oder Unglückswurf tatsächlich darüber, ob man „König“ oder „Dieb“, Richter oder Gerichteter wird, ob man sich als solcher ein Urteil erlauben darf oder mit „Schlägen“ bestraft wird (Rohlfs, 1963, S. 11). Ein wirkliches Verstehen des Bickelspiels als Glücksspiel im 12. Jahrhundert sowie eine sachlich zutreffende Deutung des bekannten literarischen „bickelwort“-Vorwurfs hängen zweifellos auch von solchem Hintergrundwissen ab.
Rohlfs sagt in seinem Werk „Antikes Knöchelspiel im einstigen Großgriechenland“ über die Spielregeln des Astragalusspieles: „Durch das verschiedene Fallen der vier Würfel waren 35 Kombinationen gegeben, die alle ihren besonderen Namen hatten! So setzt das Astragalus-Spiel viel Erfahrung und umfangreiche Kenntnisse voraus. Im Gegensatz zum Würfelspiel, das mit seinen klaren und eindeutigen Zahlenwerten von jedermann leicht gespielt werden konnte. Die Beherrschung der Spielregeln und der einzelnen Würfe im Astragalus-Spiel war also eine förmliche Wissenschaft. Ihre Modalitäten scheinen in theoretischen Anleitungen („qui valeant tali“) genau festgelegt gewesen zu sein“ (1963, S. 9).
Rohlfs kann zwar die Regeln des antiken und komplexen Glückspieles mit Knöcheln nicht exakt identifizieren. Andererseits berichtet er sehr genau über historische „Spielformen, von denen sich die eine oder andere bis in die moderne Zeit nachweisen läßt“ (Rohlfs, 1963 S. 10f.) Als Beispiel sei hier eine „ethnologisch besonders interessante“ Form genannt, die „außerhalb Italiens ihre genauen Parallelen hat: angefangen von Persien über den türkischen und arabischen Orient, Griechenland bis nach Spanien“ (Rohlfs, 1963, S. 10f.). Diese Spielform ist gekennzeichnet durch ein Prinzip von Gratifikationen und Sanktionen, durch das schon die positiv oder negativ gekennzeichneten Sprüche auf den Orakelsäulen der Antike namentlich mit gleichlautenden Namen von Wurfbildern des Astralagusspieles verbunden waren.
Mit Hilfe der Forschungsergebnisse von Gerhard Rohlfs, die ihm „auf vielen Reisen aus erster Hand zugeflossen sind“ (1963, S. 8) kann das hier infrage stehende, aus Formen und Funktionen deduzierte System von Gratifikationen und Sanktionen beim Bickelspiel als ein „ähnliches“, auch im 12. Jahrhundert gültiges Spielsystem belegt werden. Wenn schon bei den Germanen und Römern das Knöchelspiel bekannt war, darf man sicherlich davon ausgehen, daß durch die Kreuzzüge das Glücksspiel und die komplexen Regeln des hier beschriebenen Knöchelspieles aus der griechischen Antike der höfischen Gesellschaft vermittelt und verstanden wurden.
Der o.g. Autor betont zwar, daß sein „Beitrag zur Geschichte des Astragalus-Spieles [..] in erster Linie onomosiologisch sein [will]: er gilt mehr den Bennungen als den Formen und Regeln des Spieles“ (Rohlfs, 1963, S. 8 ff.). Er geht u.a. den Namen nach, welche die vier Seiten des Astragalus (=Bickel) oder die Wurfbilder in verschiedenen Regionen hatten und betont vor allem die Wichtigkeit der Wurfbilder im Verhältnis zu Zahlenwerten; konstatiert aber auch: „Die Vielheit der Varianten (der Namen der Würfelseiten! d.V.) macht die etymologische Lösung zu einem desperaten Problem, zumal auch im modernen Griechenland trotz unserer wiederholten Recherchen sich nichts findet, was zur Lösung der Herkunftsfrage beitragen kann“ (1963, S. 19). Seine Informationen sind dennoch geeignet, auf indirektem Wege Aussagen über Spielformen und Spielregeln zu ermöglichen, obwohl Bemerkungen hierzu eher beiläufig gemacht werden.
Dem Bickel- bzw. Knöchelspiel, das mit dem Astragalusspiel verwandt ist, wird „ein sehr hohes Alter“ bescheinigt. „In der griechischen Antike wird das Knöchelspiel schon bei Homer (II. 23,88) erwähnt: im Jähzorn tötet der kleine Patroklus den Spielgefährten wegen eines Disputs [...] beim ‘Spiele der Knöchel’. Aus vielen antiken Zeugnissen wissen wir, daß die Griechen leidenschaftliche Astragalus- Spieler gewesen sind“. Weiter heißt es im Text: „Zu einem griechischen Gastmahl war das Spiel mit den Astragalen fast eine rituale Ergänzung“ (Rohlfs, 1963, S. 6). Seiner Meinung nach hat „in der römischen Antike [..] das Spiel nicht die gleiche Verbreitung gefunden“ (1963, S. 6), wie in Griechenland.
Glücksspiele mit Knöcheln waren bei den Römern beliebt und bekannt. Mancher hatte wegen seiner Spielleidenschaft sein ganzes Vermögen verloren. Würfelspiele waren deshalb - außer bei den Saturnalienfesten - verboten. „Kaiser Augustus selbst war ein so begeisterter Würfelspieler, daß der Biograph Sueton über ihn berichtet:...’er spielte ohne Hehl und Heimlichkeit zu seinem Vergnügen fort, selbst noch als Greis und nicht bloß bei dem Saturnalienfest, sondern auch an anderen Fest- und Werktagen...’ In einem Brief an Tiberius schreibt Augustus: „Meine Tischgesellschaft war die dir bekannte... Bei der Tafel haben wir alten Leute so gestern wie heute ganz gemütlich unser Spielchen gemacht. Wir würfelten so, daß wer den Hund oder Sechser warf, für jeden Wurf einen Denar in den Pott setzen mußte, und wer die Venus warf, das ganze bekam“ (Archäologischer Park Xanten 1994, Museumsbrochüre, 3. Auflage S. 10). Es geht also darum, daß man nicht nur gewinnen oder nichts gewinnen, sondern verlieren kann, was man zuvor noch besaß. Rohlfs macht ausdrücklich darauf aufmerksam, daß „die sehr komplizierte Technik des Astragalus-Spieles nach Becq de Fouquieres die Ursache dafür gewesen [sei], daß diese Spielweise die Antike nicht überlebt hat...“ (1963, S. 9). Es ist jedoch anzunehmen, daß es in der von ihm beschriebenen Variante als Glücksspiel auch das Mittelalter erreichte und so gespielt wurde.
Wie bereits gesagt, ergeben sich „Durch das verschiedene Fallen der vier Knöchel [..] 35 Kombinationen [..], die alle ihren besonderen Namen hatten“ (Rohlfs, 1963, S. 9) In der vorliegenden Studie hatte sich bei der statistischen Auswertung der Würfelserien (von je 5x 30 Würfen mit vier Bickeln) ebenfalls eine auffallende „Häufigkeitsverteilung der Würfe“ (Kombinationen im Anhang!) ergeben. Bei 150 Würfen war es dabei zwar nur auf eine Anzahl von 28 Wurfbildern gekommen. Durch eine größere Anzahl von Versuchsserien wäre man der genannten kritischen Zahl von 35 sicher näher gekommen. Die Anzahl von „ 35 Wurfkombinationen “, die Rohlfs nennt, und „die alle ihren besonderen Namen hatten“ (1963, S. 9), scheint praktisch die obere Grenze der möglichen Kombinationen mit vier Würfeln gewesen zu sein, obwohl theoretisch (4x4x4x4) ihre Anzahl bedeutend größer sein könnte, es aber in Wirklichkeit nicht ist. Hierfür gibt es keine Erklärung. Auf diesen seltsamen Befund wurde schon auf S. 49 hingewiesen.
Aufgrund dieses Sachverhaltes kann man davon ausgehen, daß die in der vorgelegten Arbeit angestellten Spielversuche und ihre statistische Auswertung in bezug auf Regelhaftigkeit und Ähnlichkeit der vorgelegten Wurfbilder, die mit ihrem Namen auch eine Bedeutung hatten, relativ nahe an die in der Literatur gemachten Aussagen über historische „Wurfkombinationen“ heranreichen. Wichtig ist, daß es im historischen Bickelsspiel eine begrenzte Anzahl von Würfelkombinationen mit guten oder weniger guten Bedeutungen gab, deren Zuordnungen man als Spieler kennen mußte. - Ähnlich scheint es beim Würfelorakel[23] (z.T. mit 5 Würfeln) gewesen zu sein, wo namentlich festgelegte Wurfbilder zu positiv oder negativ tendierenden Orakelsprüchen gehörten. Rohlfs nennt „67 griechische Namen für einzelne Würfe gegenüber nur vier lateinischen Namen“ (1963, S. 7). Er verweist in diesem Zusammenhang in einer Fußnote (s.S. 12) auf Sittig, der die Häufigkeitsverteilung für die vier verschiedenen Seiten des Bickelwürfels als ein Verhältnis von 7:10:35:48 Prozent ermittelt hatte. Wenn diese Zahlenverhältnisse von den absoluten Zahlen in der vorliegenden Studie (S. 47) geringfügig abweichen, so hat das vielleicht seinen Grund darin, daß die eigenen Versuche mit Schweinebickeln und die in der Literatur (bei Sittig) genannten mit Schafs- oder Ziegenbickeln gemacht wurden. Für das Glücksspiel wurden, wie bereits oben gesagt, lieber die Knöchel eines Wildschweines genommen, vielleicht deshalb, weil sie etwas anders funktionierten - Der Unterschied besteht darin, daß die Schafs- und Ziegenknöchel zwar auch eine unregelmäßige Form, aber nur in der Längsrichtung je „zwei Breitseiten und zwei Schmalseiten“ (Rohlfs, 1963 S. 12) haben. Die Schweinebickel haben dagegen drei Längsseiten und eine Standfläche (Position „stönneke“!), auf der sie wie ein „Türmchen“ stehen können. Weil dieser Wurf sehr selten und eindrucksvoll war, wird er vermutlich beim Glückspiel die „Königsposition“ signalisiert haben. Ein Schafsbickel kann z.B. diese bedeutsame Standposition nicht einnehmen. Auf seinen abgerundenen Enden ist er eben nicht „selb-ständig“. Insofern ist die bei Rohlfs im Bildanhang, Bild Nr. 6a gezeichnete (!) Würfelposition kaum möglich. Die Abbildung 6a zeigt m.E. also nicht den „zweitschwierigsten und zweitseltensten Wurf“, wie man durch seinen Hinweis auf dieses Bild von Seite 13 meinen könnte.
„Die Spielform besteht in folgender Prozedur. Aus einer größeren Zahl von Spielbeteiligten wird mittelst (sic.) der beiden schwierigsten und seltensten Würfe der ‘König’ und der ‘Richter’ gewählt. Dann beginnt das allgemeine Spiel. Wer mit dem Spielwert 3 herauskommt, hat nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren (in Spanien „no le passa nada“); oder er darf den Wurf wiederholen, weshalb dieser Wurf im südlichen Apulien z.T. ‘doppia’ (dubbla, tubbula) ‘genannt wird. Wer den gemeinsten und häufigsten Wurf (4) wirft, erhält eine Zahl von Schlägen (mit einem geknoteten Tuch oder Strick), deren Menge vom König bestimmt wird und die vom Richter ausgeführt werden. Kommt im Laufe des Spiels neuerlich eine 1 oder eine 6 heraus, so hat der ‘König’ oder der ‘Richter’ seine Rolle an den Nachfolger abzugeben. Von der Grundform diese Spieles gibt es manche regionale Abweichungen, indem z.B. der ‘König’ durch den ‘Richter’ ersetzt ist und an die Stelle des ‘Richters’ der ‘Knüppel’ (la mazza), der Schlagemeister (mazzeri) oder der Henker (span. v erdugo) usw . tritt. Wer den gemeinsten Wurf (4) wirft, wird mit despektierlichen Namen bedacht: Schwein, Esel, Räuber, böser Mann, Arsch, Bauch (wegen der konvexen Fläche). Wenig einheitlich sind die Benennungen des neutralen Wurfes (3): Brunnen, Grube, Loch, Schüssel (nach dem hohlenTeil dieser konkaven Fläche)“ (Rohlfs, 1963, S. 11). (Die Ziffern beziehen sich auf die Nummern, mit denen die Bickelseiten im Anhang bei Rohlfs gekennzeichnet sind).
Unschwer läßt sich in der o.a. Beschreibung unter Nr.4 die „Bickel- bzw. „Bäuchleinseite“ und unter Nr. 3 , dem „neutralen Wurf“, die „gatje“-Position des Knochenwürfels identifizieren. Zum Konzept des alternativen „Alles oder Nichts“ gäbe es nach den hier genannten Regeln noch eine eigene Position des „Unentschieden“, die in der vorliegenden Studie (S. 54) jedoch nicht als eigene Null-Position, sondern als „Grenze“ beschrieben ist: „Auf diese Weise ist in der Wertskala die Vorstellung einer „Grenze“ und die Bewegung des Hin und Her um einen „Mittelwert „Null“ enthalten“. Rohlfs sagt: „nichts gewonnen und nichts verloren“; man „darf den Wurf wiederholen“ (1963 S. 11). Diese sozusagen „aufschiebende Wirkung“ eines Wurfes ändert zwar nichts an der notwendigen und gewollten Entscheidung, steigert aber die Spannung des Spielvorgangs, indem das Schicksal ein zweites oder drittes Mal herausgefordert werden kann bzw. darf.
Für die Regeln des antiken Knöchelspieles zitiert Rohlfs noch einen bzw. zwei andere Autoren: „Für Arachowa (bei Delphi) gibt H.N. Ulrichs folgenden Beschreibung: ‘Wer den König wirft, befiehlt. Wer den Vezir wirft, erhält einen Stock oder Prügel in die Hand und stellt sich zum König. Wer den ‘Dieb’ wirft, wird von den ‘Bäckern’ (Wurf 4), die wegen der Häufigkeit des Wurfes gewöhnlich viele sind, vor den König geführt und verklagt, daß er Brot gestohlen hat. Der König hört die Klage und Verteidigung und läßt darauf dem Dieb durch seinen Vezir eine Anzahl Schläge zuzählen (Reisen und Forschungen in Griechenland, Bd. I, 1840, 138) Ganz ähnlich wird die arabische Form des Spieles beschrieben: der Dieb wird bestraft, während an die Stelle des Bäckers der Bauer tritt, der dem König ein Lamm stiftet (Thomas Hyde, De ludis Orientalium, Oxoni 1694, II S. 165) ; ähnlich bei H. Petermann, Reisen im Orient I, 1860, S. 157“ (Rohlfs, 1963, S. 11f).
In der Darstellung des genannten Autors finden sich einige Unklarheiten bezüglich der Bedeutung bestimmter Einzelpositionen von Würfeln im Verhältnis zu ihrem Gesamtbild, das in der Regel von vier Würfeln bestimmt wird. Geklärt ist zum Beispiel nicht, warum bestimmte Positionen aufschiebende oder gar keine Wirkung haben, wie die häufig vorkommende „Loch“ bzw. gatje-Position. Ungeklärt bleibt auch warum die „Bauch-Position“ des Würfels eine pejorative Bedeutung hat, während beide Positionen gemeinsam im Gesamtbild des Venuswurfs vereinigt, Gewinn bzw. Sieg bedeuten. Solche Detailfragen waren vielleicht nicht zu klären; sie sind auch hier nicht zu beantworten.
Der gegen Wolfram im Literaturstreit gerichtete Vorwurf könnte also auf dem Hintergrund historischer Spielregeln u.a. die Vorstellung enthalten, daß dieser seine Autorität einem „Zufall“ verdanke und sich im „Reich der Dichtung“ mit Bickelworten („mit bickelworten welle sin“ Tr. 4641) eine Autorität anmaße, die ihm nicht zustehe. Darin eingeschlossen liegt der Vorwurf, er agiere und urteile in der Auseinandersetzung mit den Dichterkollegen willkürlich und „zufällig“ wie ein „König“ oder „Richter“ im Glücksspiel der Hasadeure. Daß Wolfram von Eschenbach die Kritik so verstanden hat, mag u.U. mit ein Grund dafür gewesen sein, daß seine „Erec-Satire“ als Antwort darauf - für den, der sie verstand - so gnadenlos ausfiel.
Wie die Recherchen gezeigt haben, gibt es also eine Ähnlichkeit zwischen der von mir in der Studie deduzierten Struktur des Bickelspiels einerseits und den historischen Spielregeln eines Glückspieles mit Knöcheln andererseits. Man kann also davon ausgehen, daß ein „Verständnis von Bickelwort um 1210“ dem der Studie zugrundeliegenden durchaus entspricht. Daß man daraus Schlüsse für die Deutung des Bickelwortvorwurfes im Literaturstreit des 12. Jahrhunderts ziehen darf, kann wohl nicht bestritten werden. Auch weiterreichende Folgerungen, wie sie z.B. in der nun folgenden Interpretation des zweiten Teiles des Prologs als Enite-Kritik oder Erec-Satire erscheinen, sind nach eigenem Verständnis nicht mehr als ein Deutungsversuch unter anderen, der hiermit zur Diskussion gestellt werden soll. „Von längst Erwogenem, Vermutetem, Postulierten und Nachzulesendem“ (Schröder 1980, S. 181), das einem Leser zugemutet werden soll, kann dabei jedoch keine Rede sein.
8. Die Enite-Kritik, ein Bilderrätsel im Text der Frauenlehre
Was bisher zum ersten Teil des Parzivalprologs und seiner Interpretation vorgetragen wurde, gilt gleichermaßen für seinen zweiten Teil, der Neuinterpretation eines Teiles der Frauenlehre mit ihrer Enitekritik und der zugehörigen Erec-Satire. Auf die Figur Enites wird so reflektiert: „ich enhân daz niht vür lihtiu dinc / swer in den cranken messinc / verwurket edeln rubîn / und al die âventiure sîn“ (3,15-18). Abweichend von den üblichen Übersetzungen - sie dennoch im Sinne eines Bickelwortes „ergänzend“ - haben diese Verse einen rätselhaften Sinn, den es zu erraten gilt. Änliches gilt für die Textstelle 2,15-22, die sich als Erec-Satire zu erkennen gibt.
Man kann als Interpret eine Satire nicht als solche identifizieren und deuten, wenn man ihre kritischen Grundannahmen nicht akzeptiert. Im künstlerischen und kritischen Sinne ist man also darauf angewiesen, „Partei zu ergreifen“. Wolframs Text fordert - wie bereits angemerkt - selbst eine Art „Beisteuer“ („stiure“), d.h. eine „Selbstbeteiligung“ am Prozeß des Verstehens dichterischer Bilder. - Macht man sich den Stand der Erec-Forschung zu eigen, wie er sich z.B. in den neueren wissenschaftlichen Analysen (überwiegend im Sinne Hartmanns) darstellt, wird man die Erec-Satire Wolframs im Parzivalprolog weder identifizieren noch verstehen können; m.a.W.: die künstlerische Nähe zum Text und zur Sache, um die es geht, zwingt einen Interpreten in diesem Ausnahmefall zur persönlichen Entscheidung für die künstlerische Position Wolframs gegen die Hartmanns von Aue.
8.1 „Inhalte“ als Rätsel im Literaturstreit
W.J. Schröder weist darauf hin, daß der Parzivalprolog zweiteilig gegliedert ist: „Der Prolog bis 2,20 führt also die Hörer in die mystische Denkform ein und leitet die dichterische Form des Romans von dieser her. Mit 2,23 beginnt der zweite Hauptteil. Wolfram, der bisher immer auch zu „tumben liuten“ ohne Unterschied des Geschlechtes sprach, unterscheidet jetzt die Bedeutung des Gesagten für Männer und Frauen“ (W. J. Schröder, 1951/52, S. 140). Im Zusammenhang mit der Textstelle, die hier untersucht werden soll, macht Schröder eine weitere merkwürdige Aussage: „Die Männer haben das religiöse Problem auszukämpfen [...] Die Frauen sind gleichsam Gefäße des Guten, das naturhaft in ihnen ruht [...] Sie stehen nicht im Lebenskampf“ (W.J. Schröder, 1951, S. 142). Diese Aussage ist m.E. mit einem Fragezeichen zu versehen.
Hempel markiert die Verse 2,17-20 als „eine der meist umstrittenen Stellen des ganzen Eingangs“ (Hempel, 1951/52, S. 176) und fährt fort: „Völlig übergangslos, ähnlich wie nach 1,2, setzt mit 2,17 ein neuer Gedankengang ein, und das zusammen mit der weiter beibehaltenen Bildlichkeit des Ausdrucks, die einer eindeutigen Verknüpfung im Wege steht, hat (sic!) es verschuldet, daß die Stelle vom valsch geselleclichen muot, bis heute unverstanden geblieben ist“ (Hempel, 1951, S. 176). Hilfreich ist sein Hinweis, daß Wolfram „mit 2,15f. [...] vergleichend die beiden Ritterepen Hartmanns heran (zieht), [...] sich versitzen ist fast gleichbedeutende Variante des bekannteren sich verligen, das Erecs Schwäche bezeichnet [...].“ (Hempel,1951/52, S. 175). Daß dieser Vergleich „vliehent unde jagent / entwîchent unde kêrent / lasternt unde êrent“ (2,10-12) in der Erec-Satire (2,20-22) den Höhepunkt seiner Kritik ereicht, wurde in der Forschung bisher nicht bemerkt.
Die Nahtstelle zwischen dem ersten und zweiten Teil des Prologs ist der Doppelvers „Diese manger slaht underbint / jedoch niht gar von manne sint“ (2,23/24). Er stellt die Verbindung zwischen „angeblicher Männerlehre“ (Hempel, 1951/52, S. 166) und Frauenlehre her. Diesem Anfang der Frauenlehre, der zugleich Abschluß der sog. „Männerlehre“ ist, gilt in Verbindung mit der Isolde- und Enitekritik in den Versen 3,7-18 des Prologs meine besondere Aufmerksamkeit.
Erst aus der Perspektive der Frauenlehre ergibt sich ein interessanter Blick zurück auf die „Männerlehre“ in den Versen 2,15-24, die sich in einer Reihung von dichterischen Bildern als radikale Kritik an dem Helden Erec und dem Schöpfer dieser literarischen Figur herausstellt. Beide, sowohl die Enitekritik als auch die Erec-Satire, sind Rätsel bilder des Prologs. Wegen ihrer Doppeldeutigkeit würde Gottfried von Straßburg sie mit seinem selbst erfundenen Parameter für die Einheit von Sinn und Un-Sinn - das ist sein Vorwurf gegen die dichterischen Bilder Wolframs - als „Bickelwörter“ bezeichnen. Die Analyse dieser dichterischen Bilder als komplexe Reihe gibt den Blick auf die inhaltliche Seite des Parzivalprologs frei.
Die Analyse des „bickelwortes“ aus dem Literaturstreit, die existentielle Deutung des Elsterngleichnisses, die Herstellung des Sinnzusammenhanges zwischen dem Elsterngleichnis und dem „zwîvel“ des Prologeingangs konnten bisher die Frage nicht klären, um welchen Inhalt bzw. Sachverhalt Gottfried, Hartmann und Wolfram sich wirklich gestritten haben könnten. Die Leidenschaftlichkeit der Auseinandersetzung läßt jedoch darauf schließen, daß man sich nicht nur um formale Aspekte der Dichtersprache, sondern um gesellschaftlich in höchstem Maße interessierende Inhalte gestritten haben muß. Es ging ums Ganze, wie Hempel mit Recht sagt.
Ganz vermutet, wenn die Zuhörer Gottfrieds seinen Text und die darin enthaltene „Anspielung auf eine bestimmte Wolframstelle“ verstehen wollten, habe dies „eine Vertrautheit mit dem Parzivaltext vorausgesetzt, wie man sie in der Studierstube, aber nicht auf dem Turnierplatz erwerben kann“ (Ganz, 1967, S. 71). Mit Bezug auf eine Aussage von John Meier fügt er hinzu: „Die Forschung sah sich daher auch - vielleicht nicht ganz wider Willen - gezwungen, zu bewundern ’welch eine Tiefe und Weite der literarischen Bildung, welch eine Feinheit des Verständnisses und Leichtigkeit der Auffassung, welch eine Abrundung und Gleichmäßigkeit der Bildung das alles voraussetzte’“ (J. Meier, 1907, S. 507).
Man kann durchaus der Meinung sein, daß bestimmte Stellen (z.B. Enite-Kritik und Erec-Satire) aus dem Prolog, wenn sie denn verstanden und weitererzählt wurden, woran kein Zweifel besteht, ein derart „dröhnendes Gelächter“ verursacht haben könnten, daß Bildungstheoretiker des 19./20. Jahrhunderts u.U. an der „Tiefe und Weite einer literarischen Bildung“ hätte verzweifeln lassen (außer Ernst Robert Curtius). Wolfram selbst legt größten Wert auf den eigenen Ritterstand, so daß sich die Frage stellt, warum die „Feinheit des Verständnisses und die Leichtigkeit der Auffassung“ nicht ebensogut zur Stimmungslage und zum Milieu eines Turnierplatzes oder einer höfischen Kemenate, als zu einer klösterlichen Studierstube passen sollten. Um welche Textstellen geht es also, und was mag der inhaltliche Hintergrund des Gelächters gewesen sein? Jeder, der sich um den Parzivalprolog bemühte, hat die entsprechenden Verse sicherlich mehrfach gelesen oder gehört.
Expressis verbis erfährt man zwar nichts von strittigen Inhalten. Man kann wiederum nur raten und sich darüber hinaus den „nonverbalen“ Zeichen und Hinweisen in der Form von stilistischen Mitteln im Text anvertrauen, sofern man ihre „Sprache“ versteht. Hier liegt das eigentliche Problem im Umgang mit dem Parzivalprolog: „Alles wird mit allem bildhaft in Beziehung gesetzt. Welchen Erkenntnisgewinn die Zuhörer aus dieser verwirrenden Bildersprache ziehen konnten, ist undeutlich“, sagt Bumke (1997, S. 136).
Ein Erkenntnisgewinn hängt nicht nur vom methodischen Bewußtsein des Rezipienten, sondern ebenso von seinem individuellen künstlerischen Selbst- wie Textverständnis ab. Dieses „Vorverstehen“ ist eher ein ganzheitliches Welt- und Selbstverstehen, als ein wissenschaftlich-historisches Verstehen. Zeitgeschichtlich bedingt, ist es ein jeweils anderes beim Zuhörer des 12. und des 20. Jahrhunderts. Insofern erhebt die folgende Darlegung nicht den Anspruch „extremer“ Wissenschaftlichkeit, sondern ist der Versuch, an „vliegenden bîspelen“ (1,15), „vorwissenschaftliche“ Erfahrungen zu artikulieren, um damit erst die Bedingungen wissenschaftlichen Verstehens herzustellen bzw. zu verbessern.
Die Frage nach dem Inhalt des Streites ist deshalb wichtig, weil er (Inhalt) als Teil eines Ganzen im dichterischen Bild nicht nur eng mit der Form verbunden ist, sondern weil ihr beiderseitiges Verhältnis über die Qualität dieser Ganzheit entscheidet. In der mittelalterlichen Kunst kann man generell der Frage nach der Dignität des Sujets, wenn man den Begriff „Inhalt“ vorläufig damit umschreiben will, nicht ausweichen. Aus der Sicht der Literatur- und Kunstwissenschaft des 20. Jahrhunderts wird diese Frage gern vernachlässigt, z.B. aus einer l’art pour l’art-Mentalität.
Da sich die dichterischen Bilder Wolframs durch einen hohen Grad von Abstraktheit auszeichnen, ist es so mühsam, ihre „Inhalte“ zu identifizieren und ihre Form zu dechiffrieren. Beide sind eng miteinander verwoben. Die Inhaltsfrage wird auch deshalb hier gestellt, weil man, wenn sich darauf eine Antwort fände, der sog. „Literaturstreit“ den Beigeschmack des bloß Theoretischen verlöre. Aus der Schärfe der Auseinandersetzung kann man erahnen, daß es nichts Belangloses oder Esoterisches gewesen sein kann, über das man stritt.
Wolfram selbst hat zum Verhältnis von Inhalt und Form dichterischer Bilder im Parzivalprolog dezidiert Stellung bezogen und zwar in der Gegenüberstellung zweier Frauenbilder, die sich in der Frauenlehre des Prologs befinden. Diesen Teil der „Frauenlehre“ (2,25-3,25) - ein Vorspann von 114,5 - könnte man deshalb auch als Formenlehre bezeichnen. Daß die Interpreten seine Aussagen zum Formproblem bisher weder erkannt noch richtig gewürdigt haben, läßt sich auf einen Fehler bei der ersten Übersetzung an dieser entscheidenden Stelle des Prologs zurückführen.
8.2 „ich enhân daz niht vür lîhtiu dinc“ (3,15-3,18)
Wie es zu diesem Mißverständnis kam, läßt sich erklären, wenn man die erste Übersetzung des „Parzival“ von San Marte (1836, S. 3) mit vielen nachfolgenden bis auf den heutigen Tag vergleicht. Es ist zu vermuten, daß seine von der Satzkonstruktion her nicht gestützte Übersetzung einer wichtigen Stelle aus der Frauenlehre durchweg alle folgenden beeinflußte und auf eine falsche Fährte lenkte. Der als Überschrift zitierte Vers (3,15) und die drei folgenden sind bisher nicht sinngemäß interpretiert worden.
Wolframs Kritik eines falschen Frauenbildes (Isolde) endet so: „die lobe ich als ich solde, daz safer ime golde“ (3,13-14). Die unmittelbar anschließenden Verse (3,15-18) wurden fälschlicherweise zu einem Frauenlob hochstilisiert. Hier handelt es sich jedoch um eine spezielle Kritik an der Figur Enites aus dem Erecroman und am dichterischen Konzept Hartmanns überhaupt. Unmittelbar anschließend an die Isoldekritik in den drei vorhergehenden Versen steigert sich Wolfram in der Schärfe seiner Kritik erheblich. Er sagt:
„ich enhân daz niht vür lîhtiu dinc, swer in den cranken messinc verwurket edeln rubîn und all die âventiure sin“ (3,15-18)
San Marte übersetzt diese vier Verse und bezieht sie auf die folgenden zwei:
„(dem glîche ich rehten wîbes muot) diu ir wîpheit rehte tuot“ (3,17-18)
„Nicht tadeln aber mag ich’s lassen, Wenn edeles Rubines Blitzen, Und was Du kostbares (!) magst besitzen, Du willst in schlechtes Messing fassen.- Ein Stein unscheinlich eingehüllt, Das ist des rechten Weibes Bild“ (San Marte, 1836, S. 3).
Dieses Mißverständnis wird seither in der Forschung weitergereicht. Der Text selbst sagt jedoch etwas völlig anderes als die bisherigen Interpretationen. Weil Wolfram das Frauenbild Gottfrieds mit einer goldgefaßten Glasscherbe (Isoldes Unmoral) verglich, gingen San Marte und nach ihm viele Übersetzer, entsprechend einem tradierten allegorischen Deutungsschema, („schwarz verhält sich zu weiß, wie böse zu gut“) davon aus, daß der Dichter dem negativen Bild Isoldes im Goldrahmen ein positives Bild des edlen Rubins im Blechrahmen gegenüberstellen wollte. Wie im Fall des Elsterngleichnisses versagt auch hier die Allegorese: Ein edler Rubin in einer billigen Blechfassung kann für eine Frau nicht „vorbildlich“ sein.
Wie San Marte so übersetzt Spiewok sinngemäß: „Umgekehrt halte ich es nicht für wertlos, wenn jemand einen edlen Rubin mit all seinen geheimen Kräften in billiges Messing faßt. Damit möchte ich das Wesen einer rechten Frau vergleichen.“ (Spiewok, 1981, S. 11) Mit geringen Abweichungen ist dies der Tenor der meisten Übersetzungen dieser Textstelle.
Zuhörer oder Leser, die keine Erfahrungen im Umgang mit Edelsteinen und ihrer kunsthandwerklichen Gestaltung als Schmuck haben, mag diese Übersetzung nicht nachhaltig stören. Sie vertrauen der Autorität des Dichters und fragen nicht nach der des Übersetzers. Wolfram soll also tatsächlich gesagt haben, ein edler Rubin in einer billigen Messingblechfassung („cranken messinc“) sei wertvoll und im übertragenen Sinn sogar ein Vorbild für das Wesen einer rechten Frau? Das ist hier die Frage!
Einem Goldschmied käme es aufgrund seines verstehenden Umgangs mit wertvollen Materialien und Schmuckgestaltung niemals in den Sinn, einen edlen Rubin in Messingblech zu fassen oder ein so verfertigtes „Unding“ auch noch als „wertvoll“ zu empfinden. Ihn etwa als Zeichen der Zuneigung einer Frau zu schenken oder ein solches „Machwerk“ als Sinnbild für eine edle Frau zu betrachten, ist ein Mißverständnis. Ein natürliches Empfinden sagt, daß ein wertvoller Edelstein (ein edler Rubin) in billiger Fassung in seiner Erscheinung und seinem künstlerischen Wert in grober Weise beeinträchtigt, im weiteren Sinne des Wortes entwertet und „erniedrigt“ wird. Auf diesem Standpunkt des Künstlers muß man beharren, selbst dann, wenn der Dichter des Parzival solches gesagt haben sollte, w as er aber gar nicht tat! Sein Text behauptet das Gegenteil dessen, was Interpreten hineingedeutet haben.
Über die Beurteilung von Kunstgegenständen, die in Form eines dichterischen Bildes auf die literarische Ebene geraten, kann man selbstverständlich als Kunsthandwerker mit einem Wissenschaftler streiten - oder eben nicht streiten. Die Aussagen beider sind zugleich richtig oder falsch, weil sie nicht vergleichbar sind. Ich behaupte jedenfalls, daß ein in billiges Messingblech gefaßter Rubin im künstlerischen Sinne eine Mißgestalt ist. Das gilt auch im übertragenen literarischen Sinne für das entsprechende dichterische Bild.
Man muß nicht einmal subjektiv befangen sein, um aus der Kombination der herabsetzenden Worte „crank“, „verwurket“ im Zusammenhang mit billigem „messinc“ ohne weiters herauszuhören, daß hier mit dem edlen Rubin etwas Fragwürdiges geschieht. Nach kunsthandwerklichen Regeln soll ein edler Stein durch eine Gold- bzw. Edelmetallfassung in seinem Wert gesteigert und gleichzeitig als Schmuckstück tragbar gemacht werden. Durch eine unedle Fassung wie Messing, das als Material nur eine Mischung von Kupfer und Zink und damit ein „Bastard“ ist, wird das Ganze (die Einheit von Stein und Fassung) ein „Unding“ (lihtiu dinc). Ein Edelstein wird in seiner Erscheinung dadurch so beeinträchtigt, daß ein „fassungsloser“, natürlicher Zustand vorzuziehen wäre. Die minderwertige Fassung macht einen edlen Rubin „untragbar “. Dies ist offenbar der kunsthandwerkliche Befund hinter dem kritischen Bild Wolframs von Eschenbach. Im übertragenen Sinne handelt es sich hier um die radikale Kritik am dichterischen Konzept Hartmanns von Aue. Sie bezieht sich auf die Gestalt der Enite in Hartmanns „Erec“.
Bei der notwendigen Recherche in verschiedenen Übersetzungen fand sich aus dem Bereich der Literaturwissenschaft zum Glück wenigstens ein (einziger) Gewährsmann für die hier vorgetragene Interpretation dieser Textstelle. Es ist Karl Simrock (1849, S. 7). Er übersetzt die kritische Stelle (3,15f) völlig anders als alle anderen so:
„Des Mißgriff auch ist nicht gering, Der in den schlechten Messing Verwirkt den köstlichen Rubin.“ (3,15-17)
Simrock bezeichnet den edlen Rubin in Messingfassung als „ Mißgriff “, nicht deshalb, weil er sich in kunsthandwerklichen Dingen besser auskannte als andere, sondern weil es so im Text steht ! Damit sind von Wolfram also beide Formen, sowohl das „safer ime golde“, als auch der in den „cranken messinc verwurkete edele rubin“ als Fehlformen künstlerischer Gestaltung identifiziert worden. Darauf kommt es bei dieser Textstelle an. - Trotz der ausgesprochen negativen Beurteilung des Bildes stellt Simrock dennoch über diesen „Mißgriff“ eine Beziehung zum „rechten Frauentum“ her, was wiederum ganz unverständlich ist. Er fährt also fort:
„Dem gleich ich echten Frauensinn und alle seine rothe Gluth“ (sic!).
Ein derart bildhafter „Un-fug“, den Simrock sicherlich selbst bemerkte, aus Texttreue aber hingenommen hat, ist Veranlassung genug, sich noch einmal mit dieser Textstelle genau zu befassen, um Wolfram von Eschenbach in dieser Angelegenheit selbst entscheiden zu lassen. Er sagt in dichterischer Form nichts anderes als: 1. Ein wertloses Sujet (Isolde) wird durch den glanzvollen Darstellungsrahmen als „safer ime golde“ nicht ehrenwerter, als es ohne ihn schon minderwertig genug ist; 2. Ein wertvolles Sujet (Enite als Eva-Typos) wird dagegen in einem billigen Rahmen („cranken messinc“) in seinem Wert stark herabgesetzt.
Nicht zu übersehen ist, daß Wolfram Enite in dieser Kritik als literarische Figur Hartmanns von Aue sehr hoch einschätzt. Indem er beide Fehlformen (Isolde im Gold- und Enite im Blechrahmen) mit dem Bild echten Frauentums und seinen inneren Werten in Beziehung setzt, resümiert er: „(dem gliche ich rehten wibes muot). diu ir wipheit rehte tuot“ (3,20-21) (!). Sinngemäß könnte man also die o.a. kritische Stelle so übersetzen: „Demgegenüber halte ich es für verantwortungslos („lîhtiu dinc“ = verantwortungslos), wenn man einen edlen Rubin (bzw. Inhalt oder Sujet) mit einem wertlosen Rahmen faßt“. Als roter Edelstein ist der Rubin für Wolfram das Zeichen der Liebe (der Frau) und der Liebesreligion (Christentum). Diese Aussagen zur Form der Dichtung in der „Frauenlehre“ bereitete er zehn Verse vorher (2,23) mit einem allgemeinen Hinweis auf defizitäre Formen des gesellschaftlichen Umgangs so vor:
8.3 „Dise manger slahte underbint - iedoch niht gar von manne sint“
Mit der Feststellung „diese manger slahte underbint - jedoch niht gar von manne sint“ schließt Wolfram seine vorhergehende Betrachtung des „unschicklichen“ Verhaltens von Männern“ im gesellschaftlichen Umgang am Hofe (unhöfisches Verhalten) ab. Sinngemäß kann diese Überleitung so verstanden werden: „Die mangelhafte Art und Weise, mit den Gegensätzen (d.h. Polaritäten von Mann u. Frau) in der höfischen Welt umzugehen, ist nicht allein eine männliche Ungezogenheit.“ - Stillschweigend sollte der Hörer hier ergänzen: sondern auch die der Frauen. Gemeint sind offenbar Formfehler im Verhalten, welche die ganze Gesellschaft betreffen. „underbint“ ist im Lexikon definiert als etwas, „was zwischen zwei dingen (sic!) ist, um sie zu verbinden oder zu trennen“ (Lexer, 1992). Das ist aber auch eine annähernde Beschreibung für die „Wirklichkeit“ einer künstlerischen und gesellschaftlichen Form des Umgangs mit Dingen und Menschen: Kunst als Form hat eine sinnfällige ganzheitliche Wirkung, indem sie zugleich verbindet und trennt. Sie ist ein „samnen unde brechen“ (337,23-26), wie Wolfram am Ende des sechsten Buches sagt.
Der Vers „dise manger slahte underbint“ (2, 23) ist damit wohl als „unkultiviertes Verhalten“ zu verstehen. Das Wort „slahte“ spielt hier eine sinngebende Rolle. Eine ähnliche Bedeutung findet man noch heutzutage im niederdeutschen Sprachraum: Wenn eine Mutter sich über Ungezogenheiten ihres Sprößlings ärgert, macht sie gern den Vater des Kindes dafür verantwortlich: „Das hat er von Dir“. Bei einem niederdeutsch sprechenden Ehepaar würde der gleiche, nicht immer böse gemeinte Vorwurf lauten: „Dat sleht em van de naobers nich an“! Diese witzige, uralte Redewendung wird noch heute von vielen Leuten ebenso unreflektiert wie selbstverständlich gebraucht wie die Redensart: „Das hat er von Dir“. In Wirklichkeit handelt es sich beim niederdeutschen Satz um eine relativ komplizierte grammatische Konstruktion nach Art einer doppelten Verneinung. Positiv gewendet heißt es nur: Er ist Deines Geschlechtes; auf hochdeutsch: „Die Art der Ungezogenheit stammt von dir“. Eine solche Bedeutung von nd. „sleht“ schwingt im mittelhochdeutschen Wort „slahte“ mit. Die Textstelle, „diese manger slahte underbint iedoch niht gar von manne sint“ (2,23f) mit der die Erec-Kritik abschließt, lautet sinngemäß: Dieses unkultivierte Verhalten ist nicht nur eine männliche Verhaltensweise. Das gilt besonders im Hinblick auf Isolde und Enite, den beiden Frauengestalten Gottfrieds und Hartmanns von Aue.
Nachdem Wolfram das Frauenbild Gottfrieds von Straßburg aus dessen Tristan blitzlichtartig ausgeleuchtet hatte („die lobe ich als ich solde das safer ime golde“ (3.13-14), trifft nun seine Kritik (3,15-18) mit voller Breitseite Hartmann von Aue. Wolfram hatte seinen Dichterkollegen namentlich bereits in Vers 143,21-25 erwähnt, wie Bumke (1997, S. 15) bemerkt „mit leisem Spott“. An derselben Stelle hatte er aber auch schon angedroht, Enite und ihre Mutter Karsnafide „werdent durch die mül gezücket unde ir lop gebrücket“ (143,29-144,1) für den Fall nämlich, daß Parzival am Artushofe nicht gebührend empfangen würde.
Um die o.a. Behauptungen mit Hilfe des Textes zu belegen und die Absichten Wolframs zu erkennen, bedarf es also größtmöglicher Genauigkeit bei der Übersetzung der auf die Isoldekritik folgenden Textstelle: „ich enhan daz niht vür lihtiu dinc“ (3,15). Wörtlich übersetzt heißt das: „Ich halte Daz nicht nicht für eine Leichtfertigkeit“; m.a.W.: Ich halte es für eine Leichtfertigkeit“. Die erste Verneinung ist in „enhan“ enthalten. Das „en“ ist ebenso wie „ne“ als Vorsilbe eine Negationspartikel und heißt: nicht, „das „verbum oder den ganzen unabhängigen Satz negierend“ (Lexer, 1992). Die zweite Verneinung „niht“ ist klar erkenntlich. Grammatisch richtig und positiv gewendet lautet der Vers also: „ich halte das für eine ausgesprochen leichtfertige Sache“. Ein möglicher Doppelpunkt am Ende dieses Verses würde den Sinnzusammenhang zur nachfolgenden Aussage noch deutlicher machen, denn jetzt wird genau gesagt, „wer“ so unverantwortlich handelt: „swer in den cranken messinc verwurket edeln rubin“ (3,16-17).
Jeder zeitgenössische und literaturbewußte Zuhörer am Hofe verstand, daß Wolfram in diesem Bild nicht etwa von Goldschmiedearbeiten sprach, sondern von zeitgenössischer Literatur. Um Mißverständnisse zu vermeiden, fügt der Dichter deswegen hinzu: „und al die aventiure sin.“ Das letzte Wort dieser Versgruppe, das Personalpronomen „sin“, steht zum Anfangswort „ swer“ in direkter Beziehung, kann sich also kaum auf den zuvor genannten „ edlen Rubin mit all seinen geheimen Kräften“ beziehen, wie Spiewok den Vers 3,18 („und al die aventiure sin“) übersetzt.
Man wußte also, daß diese Kritik einem Dichter galt. Wer konnte es, wenn man schon die zeitgenössische Literatur am Hofe kannte und Gottfried bereits seine Kritik abbekommen hatte, anders sein als Hartmann von Aue? In der Gegenüberstellung und Auseinandersetzung mit den beiden Frauenbildern Isolde und Enite, die prototypisch für die Dichtung Gottfrieds und Hartmanns stehen, klärt Wolfram die Beziehungen von Inhalt und Form in der Literatur auf kürzest mögliche Weise, d.h. im dichterischen Bild: Isolde wird mit dem „blauen Glasfluß“, also wertlosem Material (Inhalt) in Goldfassung, d.h. der Sprache Gottfrieds, verglichen. Wenn in einer solchen Zuordnung von zwei Frauentypen die eine wegen ihrer ehebrecherischen Verhältnisse als billiger Glasfluß in literarischer Goldfassung markiert wird, kann die andere Figur, von Wolfram mit einem edlen Rubin verglichen, nur Enite sein. Die Textstelle im „Erec“, auf die sich Wolfram bezieht, lautet: „vür ir brust wart geleit / ein haftel wol hande breit / daz was ein gelpher[24] rubin / doch überwant im sinen schin / diu maget vil begarwe / mit ir liehten varwe.“ (Er.1560 ff.) Sie ist deshalb Edelstein, weil sie als literarische Figur des „Erec“ auf dem zugrundeliegenden heilsgeschichtlichen Schema der Schöpfungsgeschichte konzipiert wurde und sowohl literarisch als auch theologisch eigentlich nur als „zweite Eva“ verstanden werden kann. Man muß dazu freilich den biblischen Hintergrund der Geschichte kennen und anerkennen.
Die immer wiederkehrenden erotisch anmutenden Textstellen in der Kleiderbeschreibung Enites, in denen die „Transparenz“ des Hartmannschen Konzeptes besonders deutlich wird, haben den Sinn, die paradiesische, unverhüllte Schönheit Enites, „wie sie der Schöpfer aus seiner Hand hervorgehen ließ“ auszudrücken. Aus dem Anfang des „Erec“ sind z.B. folgende Stellen zu nennen: 310; 323; 329; 332; 336; 339; 354; dazu zählt auch die „Einhorngeschichte“ (Er. 1317), die in der - durch Wiederholung gesteigerten - zweiten „Beschreibung des Pferdes“ reflektiert wird. Die Aussage Hartmanns scheint zu sein: Gott ist der Schöpfer der Schönheit Enites. Er ist dafür verantwortlich in einem vordergründigen und hinterhältigen Sinne: Vordergründig soll sich jeder, auch Erec und die Zuhörer, an der Erotik erfreuen; hinterhältig: Gott ist damit gleichzeitig für alles verantwortlich, was daraus erwächst, z.B. auch für das „verligen“. Daß der Schöpfer schuldig ist, läßt der Dichter Enite in ihrer erweiterten Totenklage wiederholt vorbringen:
„herre, ich zige dich missetât“ (Er. 5799); „wan mir anders geschiht / von dir ein unreht gewalt“ (Er. 5829 f.); „er hât mir armen wîbe / verteilet an dem libe“ („verurteilt“) (Er.5996 f.); „sô hât doch got den minen lîp / sô unsaelic getan (Er. 6037).
Diese Schuldzuweisungen richtet sie an den „höveschen got“. Dennoch hofft sie, wie Rodney Fisher meint, daß „ihre eigene Vorbildlichkeit und die zugrundeliegende ritterliche Gesinnung Erecs seine Unvernunft schließlich überwinden werden“ (Fisher, 1975, S. 172). Worauf diese Hoffnung gründet, ist nicht zu erkennen.
Im Kontext von Enites „Schönheit als Schuld“ am verligen-Problem Erecs wird eine Art Sündenfall vorgestellt und hochstilisiert. Wenn das Erbsündeschema nicht von Anfang an - durch die zerrissene Kleidung Enites hindurchschimmernd - mitempfunden würde, wirkte das „verligen“ eo ipso wie ein Pseudoproblem im Grenzbereich von Ernsthaftigkeit und Lächerlichkeit. Es wäre damit weitaus weniger gefährlich. So aber ist die pervertierte biblische Geschichte Hartmanns von Aue, die immer wieder auf die Figur der Eva und die wirkliche Heilsgeschichte direkt anspielt, nach Meinung Wolframs eine verlogene literarische Form für den an sich „wertvollen Inhalt“: Enite als Eva. - So wie der edle Rubin Enite in den „cranken messing „verwurket“ ist, ist es auch die Figur in der „aventiure“ (3,18) Hartmanns von Aue. Der Terminus „verwurket“ wurde wohl deshalb gewählt, um die Beziehung zum „gewirkten“ Mantel des Pferdes, mit dem Erec später identifiziert wird, anzudeuten. Auch im Neuhochdeutschen klingt im Verbum „verwirkt“ der ursprüngliche Sinn „falsch gewebt oder gestrickt“ nach. Auf dieser Linie liegt der Sinn von „verwurket“.
Diese Kritik an den bekannten Dichterkollegen konnte und sollte dem literaturkundigen Publikum nicht verborgen bleiben. Wolfram bringt mit seinen beiden Bildern für die gegensätzlichen Frauengestalten zum Ausdruck, daß in beiden Fällen die dichterische Einheit von Inhalt und Form nicht gegeben ist! Im Falle Hartmanns von Aue nennt er dessen Dichtung sogar „verantwortungslos“, weil sie sich nach Inhalt und Form - auf die religiöse Wahrheit bezogen - total widersprechen. Das gilt nicht nur für die Gestalt Enites, sondern noch mehr für die Figur des Erec. Erst aus der Perspektive dieser Stelle, der sog. „Frauenlehre“ (3,15-19), erkennt man die Verse 2,15-29 als Erec-Parodie.
Im ersten Teil des Prologs - in den Versen 2,15-24 - wird in einer Reihung von „Komik-Bildern“ der Inhalt der Erec-Geschichte als Parodie referiert, indem Wolfram das Problem des „verligens“, das in Hartmanns Dichtung im Zusammenhang mit der Schönheit Enites die zentrale Rolle spielt, gleichzeitig satirisch verändert und vernichtend kommentiert. Der Anlaß für den abgrundtiefen Spott, mit dem er Hartmanns Dichtung überzieht, ist die Tatsache, daß dieser in seinem Werk die widersprüchliche Figur der Enite erschuf; deshalb, weil sie einerseits völlig unschuldig ist und trotzdem die größten Beleidigungen und Demütigungen Erecs hinnehmen muß. Andererseits ist sie „irgendwie“ für alle Übel der sich entwickelnden Geschichte verantwortlich. Ein Beispiel dafür ist die „Episode mit dem - bei Hartmann namenlosen - Grafen Galoain, der Enite dem Helden abspenstig machen will“ (Brunner 1993, S. 108). Hartmann ergreift „die Gelegenheit, ausführlich darzulegen, wie der an sich edle und gute Graf aufgrund der überwältigenden Schönheit Enites in Liebe zu ihr entbrennt und wie sich dadurch sein Verhalten zum Schlechten wendet“ (Brunner, 1993, S. 109).
8.4 „verligen“ und verlogen
Die Verlogenheit der ganzen Geschichte wird dadurch auf die Spitze getrieben, daß die Erlösung Erecs von seinem Übel nicht mehr auf christliche Weise durch innere und äußere Umkehr (Metanoite) erfolgt, sondern mit Hilfe altgermanischer Mythologie. Nicht ohne tieferen Sinn ist es, daß Erec nach seiner „resurrection“ und seinem Sieg über Oringles (den er als Bösewicht erschlägt) gemeinsam mit Enite sein Pferd besteigt („vür sich sazte er die künegin“ Er. 6733). Die Versöhnung des Paares findet auf dem Rücken eines Pferdes - Erec als Sieger und „Erhöhter“ - statt („ daz si wolde vergeben / als ungesellecliches leben“ Er. 6796 f).
In der endlosen, „überzeitlichen“ „Pferdebeschreibung“ wird exemplarisch und stellvertretend die Metamorphose Erecs zum Erlösten und „Erlöser“ am Beispiel eines außergewöhnlichen Pferdes vorgeführt. Germanische Mythologie feiert hier fröhliche Urständ. Die Möglichkeit, daß heidnisch-mythische Assoziationen bei den Zuhörern auftauchen und reaktiviert werden, wird von Hartmann jedenfalls billigend in Kauf genommen. Das ist Rückfall in Heidentum und Aberglauben, eine gespaltene Haltung, die genau dem entspricht, was Wolfram als „zwîvel“ bezeichnet: Gespaltenheit zwischen Christentum und Heidentum in den eigenen Reihen und religiöser Verrat auf literarischer Ebene. Was Jeremias für das Haus Israel beklagt, gilt hier für das Christentum und seine literarischen Vertreter: „Denn verraten, verraten hat mich das Haus Israel“ (Jer. 5,11). Jeremias geißelt am Anfang dieses Kapitels die Treulosigkeit seines Volkes: „Durchstreifet die Gassen Jerusalems , seht euch um, überzeugt euch selbst, sucht nach auf seinen Plätzen, ob ihr einen findet, der recht tut, dann will ich ihr verzeihen, spricht Jahwe. Sind Deine Augen nicht auf Treue gerichtet, Jahwe?“ (Jer. 5,1). Ähnlich beginnt Wolfram: „will ich triuwe finden aldâ si kann verswinden als viure in dem brunnen, und daz tou von der sunnen?“ (2,1-4). Von den „Vornehmen des Volkes, die den Weg und das Recht Jahwes kennen“ (Jer. 5,5) sagt Jeremias im Namen Jahwes: „Ich mache sie satt. Dafür brechen sie die Ehe und treiben sich im Hurenhaus herum. Feiste, wohlgebaute Hengste sind sie, jeder wiehert nach dem Weibe seines Nächsten“ (Jer. 5,7-8). Mit diesen Zitaten soll nicht angedeutet werden, daß es sich hierbei um eine mögliche Quelle für Wolframs Erec-Satire handelt, sondern nur auf ein bereits bekanntes biblisch-literarisches Bild für den treulosen Mann („Erec“) hingewiesen werden, das im Prologtext verborgen, aber erst noch zu erraten ist: Im Kontext biblischer Aussagen werden bereits vom Propheten Jeremias die „Söhne“ des Gottesvolkes als „feiste Hengste “ bezeichnet. Wolfram bezieht sich in seiner Kritik des „verligen“-Motivs ebenfalls auf das artgerechte Verhalten von Hengsten [25], von dem man wissen muß, wenn man seine Erec-Satire im Parzivalprolog als solche erkennen und verstehen will. Der Terminus „Hengst“ wird im Zusammenhang mit dem vorhergehenden Zitat in seiner neuhochdeutschen Bedeutung gebraucht. Tatsächlich heißt das männliche unbeschnittene Pferd im 12. Jahrhundert „ros“. „Die nhd. Komposita Zuchthengst, Deckhengst, Springhengst etc. weisen in ihren Prononcierungen den Hengst eindeutig als Beschäler aus“, sagt Beate Ackermann-Arlt (1990, S. 88f). Sie kommentiert den Unterschied von beiden Pferdearten im Hinblick auf ihre epische Funktion so: „Die negative Bedeutung von hengst unterstreicht seinen Gebrauch als Schimpfwort“ (S. 99). In der Erec-Satire spielt Wolfram beide Bedeutungen gegeneinander aus.
Bei Hartmann wird nicht nur die christliche Auferstehungslehre parodiert, wenn Erec sich nach seinem Scheintod aus seinen Grabtüchern wie ein „Auferstandener“ aus der „Verpuppung“ herausschält, um als Sieger über den eigenen Tod und seine Feinde zu triumphieren. „The fact must be accepted that ‘symbolically’ Erec dies and afterwards is alive again. Symbolically, his new life is the result of a miracle; it is far removed from the everyday sphere of natural phenomena“ (Willson, 1955, S. 5 ff.). Willson hebt auf die Christus-Symbolik ab, wie es - weiter unten - auch Eva Tobler in ihrer sorgfältigen Analyse tut.
Was mit Erec zwischenzeitlich in einer „Heilkur“ bei den Schwestern des Zwergenkönigs geschah, ist an der o.a. zweiten Beschreibung[26] des Pferdes abzulesen. Danach erlöst er gar als „rundumerneuerter Heiland“ ein Menschenpaar (Mabonagrin und seine Geliebte) aus den verderblichen Verhältnissen eines Paradiesgartens; kaum zu glauben, daß ein Menschenpaar aus dem Paradies befreit werden muß [27] . Hier zeigt sich wiederum ein religiöses Motiv mit umgekehrten Vorzeichen.
Das ist für Wolfram perverse Literatur und ungebremste Schamlosigkeit, nicht weil es hier etwa um Erotik oder Nacktheit Enites und Erecs Super-Sexualität beim „verligen“ geht, sondern, weil es um einen ebenso mutwilligen wie schamlosen Umgang mit der Schöpfungsgeschichte selbst geht, die den Verlust des höchsten Gutes durch Adam und Eva als Parodie nacherzählt. In der aventiure Hartmanns wird die Schöpfungsgeschichte respektlos und eigennützig parodiert und kolportiert. Das maere Hartmanns ist für Wolfram aus dieser Perspektive der „cranke messinc“, in den der edle Rubin Enite (als Eva) „verwurket“ ist. Das „vel“, im „zwîvel“ des Eingangsverses (des Parzivalprologs) könnte ein Zipfel jener Verhüllung sein, unter der die Nornen (die Schwestern des Zwergenkönigs in Zusammenarbeit mit der Fee Famurgan und Enite) in der Pferdebeschreibung Erec auf geheimnisvolle Weise in einen Erlöser verwandelt hatten. Sein animalisches Verhalten in der „verligen-Szene“ wird „mythisch verbrämt“, tabuisiert und sanktioniert. „Und es ist gewiß zutiefst symbolisch gemeint, wie im Palast des Guivreiz auch Enite selbst, die guote (7220), ihren Gatten mit treuer Sorge pflegt, so daß seine Seitenwunde bald schoene unde vol heil (7224) wird“ (Tax, 1963, S. 31). Über die symbolische Bedeutung des Pferdes bzw. der Pferdebeschreibung sagt Tax: „Die Frage aber, welche Funktion diese Szene im Ganzen von Hartmanns Roman haben könnte, ob sie gar [...] symbolisch gemeint sei und welche sinnbildliche Bedeutung sie in diesem Falle habe, ist kaum gestellt, geschweige denn beantwortet worden“ (Tax, 1963, S. 29). Für Tax liegt der Gedanke nahe, daß der Dichter durch die Schilderung von Enites Pferd „die letzte Erhöhung und Krönung seiner Heldin schon an dieser Stelle gestaltet“ (S. 31). Wenn denn ein Roß „notwendig zur ritterlichen Existenz gehört“ (S. 31), so doch eher zu der eines Ritters. Meines Erachtens wird in der „Wiederholung der auffallenden Pferdebeschreibung“ eher Erec mit seinem Pferd identifiziert. Daß auch Enite dabei „erhöht“ wird, widerspricht diesem Einwand keineswegs. Man kann in dieser „Beschreibung“ durchaus eine symbolisch verschlüsselte Form der „Huldigung, Lobpreisung und Heiligsprechung“ des Helden „Erec“ erkennen.
Hugo Kuhn weist mit Recht auf die „ständige Motivverdoppelung“ (S. 26) als stilbildendes Element hin und versucht, „ob sich nicht gerade in diesen Wiederholungen ein Gesetz ausfindig machen läßt“ (Kuhn, 1973, S. 26). Er nennt sie einen „epischen Doppelpunkt“ mit der „Mahnung an die Hörer“: „Merkt auf Wiederholungen“ (Kuhn, 1973, S. 34) und auf die gesteigerte Bedeutung in der Wiederholung. Allerdings übersieht Kuhn die wichtigste Motivverdoppelung in der sich wiederholenden „Pferdebeschreibung“. Bei der Frage nach dem formalen und inhaltlichen „Zusammenhang des Ganzen“ (S. 39f), von Teil I und II des Erec, kommt er deshalb in große Verlegenheit: Die „Pferdeknechtsdienste Enitens in Teil I und II“, sowie „das Pferdegeschenk in Teil I und II bei der Wende (werden) gleichsam als Entschädigung“ (1973, S. 40) gedeutet. Selbstkritisch fährt Kuhn an dieser Stelle fort: „Das ist gewiß sehr fein - aber es befriedigt nicht ganz: es fehlt darin die inhaltliche Verbindung von Teil I und II“. Das Pferdegeschenk in Teil II ist keineswegs nur „Entschädigung“. In der nachfolgenden Interpretation wird versucht, mit Hilfe der „wiederholten“ und damit in der Bedeutung „gesteigerten“ „Pferdebeschreibung“ diese „inhaltliche Verbindung“ herzustellen. Dieser Weg wird, wenn man Kuhns Ausführungen richtig versteht, von ihm selbst nahegelegt. In der Hartmann-Satire des Parzivalprologs wird Erec nicht zuletzt wegen dieser Pferdegeschichten mit einem Hengst („drite biz“ und andere Metaphern) verglichen.
Weil Hartmann seine Zweifel am Christentum exemplarisch mit seiner „verligen“-Problematik auf einem fragwürdigen, aber allgemein besonders interessierenden erotischen Niveau inszeniert hatte, und gleichzeitig dem Schöpfer der schönsten Frau der (höfischen) Welt vorgeworfen hatte, er habe sie zu schön erschaffen, so daß sie Erec und der Gesellschaft zum Verhängnis wurde, erhält er von Wolfram in dichterischer Form eine dieser „verligen-Situation“ völlig angepaßte, wenn auch nicht „jugendfreie“ Antwort. Sie läßt „Erec“ durch die Parodie des „verligen“-Motivs auch nach achthundert Jahren noch besonders lächerlich erscheinen. Wolfram von Eschenbach hält nämlich in einer Reihung von dichterischen Bildern für das „verligen“ Erecs eine völlig andere, ernüchternde Erklärung bereit, als Hartmann von Aue sie sich für seinen „superpotenten“ Helden Erec ausgedacht hatte: Er erklärt ihn auf unnachahmliche Weise kurzerhand für impotent.
Was mit dem „verligen“ eigentlich gemeint ist, sagt Hartmann von Aue selbst nicht. Weder Enite noch Erec äußern sich dazu. Es läßt sich jedoch leicht erraten: „verligen“ ist ein Kunst- bzw. Tabuwort, ähnlich dem „schlafen“, wenn es in einem ganz bestimmten Sinne gebraucht wird. Wenn heute jemand sagt, er habe „ mit einer Frau geschlafen“, weiß jeder, daß er gerade das nicht getan, sondern sich im Gegenteil auf intensivste Weise mit ihr beschäftigt hat. Auch in dieser Umschreibung ist nichts Genaues gesagt; man weiß aber trotzdem, was gemeint ist: Hier geht es um ein Tabu. Dasselbe gilt für den Begriff des „verligens“, wie er bei Hartmann von Aue verstanden werden muß.
Zum besseren Verständnis des verligen-Problems und der dazu passenden Erec-Satire bietet sich ein kurzer Rückblick auf den Eingang und das Elsterngleichnis an. Schon am Anfang des Prologs lassen sich Tendenzen erkennen, die folgerichtig zur Erec-Satire führen. Im Bild des „zwivels“ und der Elster, dem „flügelschlagenden zwivel“ mit dem „agilen stert“, hatte Wolfram nicht nur das dubiose theologisch-literarische Konzept des Glaubenszweifels im „Gregorius“ parodiert, sondern auch die darin enthaltenen (hypertrophierten) gesellschaftlichen und sexuellen Geltungsansprüche des Dichters (common appeal and sex appeal) radikal in Frage gestellt. Die „dekadente“ Form, das sachlich ernsthafte Problem des Glaubenszweifels durch Überfrachtung mit Erotik und Sexualität zum „Thema Nr. 1“ hochstilisieren zu wollen, scheint es gewesen zu sein, die Wolframs Kritik herausforderte. Unter dem Vorwand theologischen Interesses hatte Hartmann im „Gregorius“ das „Inzest“-Tabu thematisiert und damit die Geschlechtsbeziehungen zwischen Bruder und Schwester, Mutter und Sohn zum allgemein interessierenden Gesprächsstoff gemacht und auf verhängnisvolle Weise mit der „zwivel“-Diskussion verknüpft. Es geht hier nicht um die Frage, ob aus literarischer Sicht, nicht zulezt auch aus Gründen der Unterhaltung und Selbstwerbung so etwas erlaubt sei, sondern darum, wie Wolfram von Eschenbach im 12. Jahrhundert darauf reagierte. Das Bild der „zwei Felle“ in Verbindung mit dem komisch krächzenden „agel-stert“, das m.E. dem Dichter des „Gregorius“ in kritischer Absicht appliziert werden soll, gibt schon von Anfang an die Richtung der Wolframschen Kritik vor, in der im zweiten Teil des Prologs mit der Erec-Satire der Höhepunkt erreicht wird. Die folgende Deutung, die keinesfalls als Übersetzung mißverstanden werden darf, will selbstverständlich nicht ausschließen, daß es nach wie vor noch andere Möglichkeiten des Textverständnisses gibt.
9. Die Erec-Satire als Reihung von rätselhaften Bildern
„Fast alle neueren Deutungen folgen Kuhns Interpretation“, nach der die Dichtung Hartmanns „der Parallelität zwischen Weltdienst und Gottesdienst“ (Tax, 1973, S. 308) verpflichtet ist. Unabhängig vom möglichen Vorwurf gegen einen Interpreten des 20. Jahrhunderts, ob er „vom Charakter der dichterischen Religiosität Hartmanns, bei der Göttliches im Weltlichen aufscheint und Menschliches auf Religiöses hin transparent ist“ (Tax, 1973, S. 309) etwas verstanden hat oder nicht, zielt Wolfram selbst mit seiner Erec-Satire kritisch auf das mehr oder weniger pseudoreligiöse Konzept Hartmanns im Erecroman und in der höfischen Gesellschaft.
In der heutigen Diskussion ist es inzwischen eine ernst zu nehmende Frage, „wie weit die religiöse oder heilsgeschichtliche Analogie geht“ (Tax, 1973, S. 308) oder überhaupt gehen darf, damit sie als Analogie aus künstlerischer Sicht nicht untragbar wird. So gesehen ist die Erec-Satire im Parzivalprolog selbst und ihre Deutung auch eine Frage an die Germanistik selbst: wegen der von ihr behaupteten Religiösität im Konzept Hartmanns von Aue.
In der vorliegenden Studie handelt es sich deshalb zunächst um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem theologischen Konzept des „Erec“ aus der Perspektive der christlichen Lehre. Auf die Bibel als „Offenbarungsliteratur“ bezogen, gibt es nämlich keine dichterische „fiktive Christlichkeit“ im Unterschied zur kirchlichen, weil es keine zwei Arten von Religiösität und christlicher Wahrheit gibt.
9.1 „Umständliches“ zum „verligen“ - Motiv und zum Verhalten Erecs
Die Identifizierung einer Textstelle im Parzivalprolog (2,15-24) als Erec-Satire macht es, trotz des engen Rahmens der vorliegenden Studie also notwendig, zum problematischen Hauptmotiv des „Erec“ Stellung zu nehmen, um damit ein Vorverständnis für Wolframs Anliegen zu gewinnen. Diese Bemerkungen mögen zwar die durchgehende Interpretation des Prologtextes stören, aber eine Satire ist nicht verständlich, wenn man nicht weiß, was darin parodiert wird. Es ist davon auszugehen, daß ein heutiger Leser das Hauptmotiv des „Erec“ nicht so selbstverständlich präsent hat, wie man dies beim literaturkundigen Hörer im 12. Jahrhundert erwarten konnte. Wolfram sagt selbst: „solt ich nu wîp unde man/ ze rehte prüeven als ich kan/ dâ vüere ein langes maere mite / nu hoert dirre âventiure site“ (3,27). Einem Interpreten bleibt die etwas „umständlichere“ Beschreibung des vorliegenden Problems nicht erspart.
In der Sekundärliteratur zum „Erec“ findet man kaum einen Autor, der sich zum „verligen“ - Motiv des „Erec“ direkt äußert. Wenn in Erec-Seminaren die Rede darauf kommt, wird ein Hochschullehrer kaum der Versuchung widerstehen, dazu eine delikate Bemerkung zu machen, was in der Hörerschaft nachhaltige Heiterkeit auslöst. Man wird gern zugeben, daß sich das vorliegende Problem dazu anbietet.
Das wichtige Thema „Sexualität“ wird in der Regel mit solchen Anmerkungen vorschnell ausgeblendet und bleibt literarisch weiterhin ein „Tabu“: ganz im Sinne Hartmanns von Aue! Die Frage, ob Sexualität allen Ernstes auch etwas mit Religion zu tun haben könne, gerät damit ebenfalls von vornherein aus dem Blickfeld. Im 12. Jahrhundert gab es jedoch eine heftig geführte theologische Diskussion (Anselm von Canterbury) um Urstand und Urschuld (nach der Lehre der Väter), in der die menschliche Geschlechtlichkeit eine herausragende Rolle spielte. Nur auf diesem Hintergrund kann man, sowohl das Hauptmotiv des „Erec“ als auch die Kritik Wolframs daran im Parzivalprolog überhaupt verstehen.
Das Problem der Forschung lag bisher darin, daß man den wirklichen Grund der Auseinandersetzungen im sog. Dichterstreit nicht kannte und sich daher auch den scharfen Angriff Gottfrieds von Straßburg auf Wolfram von Eschenbach im „Tristan“ nicht erklären konnte. In der Annahme, er richte sich gegen Wolfram, ist die Forschung sich heute einig. - Meines Erachtens irrt Hempel jedoch, wenn er die Kritiken im Parzivalprolog überwiegend gegen Gottfried gerichtet sieht: „[...] die ironischen Bilder von 1,15-2,22 zum mindesten haben vorwiegend, wenn nicht ausschließlich die Richtung auf den einen Gegner, auf Gottfried“ (Hempel, 1951/52, S. 166).- Daß Wolfram ihn kritisierte, steht außer Frage. Die Erec-Satire und die Enite-Kritik im Prolog belegen jedoch, daß die Dichtung Hartmanns eher die Zielscheibe seiner Kritik war.
Hartmanns „verligen“-Motiv vor dem Hintergrund der Schönheit Enites als neue Eva, ihre eigenen Schuldgefühle als Verführerin, die Schuldzuweisungen Erecs an sie, ihre Büßerrolle etc. waren vor diesem religiösen Hintergrund durchaus ernst gemeint. Weil sie nicht nur literarisch, sondern auch im religiösen Sinne ernst genommen werden wollten, waren sie der Anlaß zur herben Kritik Wolframs. Das sexuell, erotisch und religiös eingefärbte Leitmotiv des „Erec“ wird von ihm ironisch zur Satire verdichtet und damit die Hauptfigur des „Erec“ vernichtend kritisiert. Man könnte Wolframs Spott wegen seiner Radikalität für überzogen halten, wenn sie nicht auf religiösem Hintergrund in der Auseinandersetzung mit Hartmann von Aue gerechtfertigt gewesen wäre. Das wichtige Eingangsmotiv des „verligens“ steht aus einem bestimmten Grunde in Beziehung zur sog. „Pferdebeschreibung“.
Franz Josef Worstbrock kommentiert: „Hartmanns Beschreibung von Enites Pferd ist nicht nur eine von ihm geschaffene Kernstelle des Erec-Romans, sie hat auch ein eigenes literaturästhetisches Gewicht, eines, das ihr in der deutschen Literatur vielleicht sogar epochale Bedeutung verleiht“ (Worstbrock, 1985, S. 25). Wolfram begegnet dieser Ausweitung (Amplifikation) des Romangeschehens ins Wunderbare mit einer entsprechenden Abbreviatur in Form einer „Erec-Hengst-Satire“ in vier Versen (2,19-22). Sie ist im Parzivalprolog das tertium comparationis zwischen dem Ausgangsmotiv des „verligens“ und der „Pferdebeschreibung“ im „Erec“.
Man kann sich über solche „ freizügige(n) Deutungslüste, denen auch Hartmanns Zelterbeschreibung zum Opfer gefallen ist“ (Worstbrock, 1985, S. 23) mokieren. Worstbrock seinerseits hält sich in seiner umfangreichen Studie strickt an das von Hartmann verordnete Sprachverbot zum „verligen“- Tabu. Mit einem verharmlosenden Satz wird dieses dubiose Motiv lediglich gestreift: „Das höfische Minneverhältnis konnte dem verligen zum Opfer fallen, Erec die Trennung von Tisch und Bett verfügen [...]“. An der Tatsache, der von Wolfram konzipierten und im Parzivalprolog identifizierten Erec-Satire, gibt es keinen Zweifel. Im Gewande der Äquivokationen - vorausgesetzt man wählt durchgehend bei ihnen die passenden Wortbedeutungen aus - kann man sie im Text selbst erkennen. Insofern geht auch der gegen Tax gerichtete Vorwurf „freizügiger Deutungslüste“ (Studien zum Symbolischen in Hartmanns „Erec“, Ztschr. für dt. Philologie 82, 1963, S. 29-44) ins Leere.
Im Rahmen dieser Studie soll auf das „verligen-Motiv“ des „Erec“ nur soweit Bezug genommen werden, als dadurch das weitere Verhalten der Figuren im Sinne Hartmanns erklärt und andererseits Wolframs sarkastische Reaktion darauf verständlich wird. Zu diesem Zweck - und um den Weg der Darstellung des Problems abzukürzen - sollte man sich in die Rolle Wolframs von Eschenbach versetzen, um aus seiner Perspektive das eigenartige Verhalten der Hauptfiguren zu begreifen. Das bedeutet nicht, daß man sich als Interpret hinter der Kritik und der Figur des Dichters verstecken wollte. Aus dieser Perspektive soll auch der heutige Stand der Erec-Forschung kurz referiert und reflektiert werden.
Durch das „cranke“ Motiv wird nach seiner Ansicht nicht nur die Form des Erec-Romans zum „cranken messinc“, in den der „edele rubin“ (Enite) „verwurket“ ist (siehe oben). Auch die krankmachende Wirkung moralisch fragwürdiger und pervertierter christlicher Motive auf die höfische Gesellschaft war nicht zu übersehen. Deshalb greift Wolfram kompromißlos an. Hartmann lieferte allerdings mit seinem dubiosen Motiv selbst die Vorlage für die gegen ihn gerichtete Satire.
Wolfram kehrt das erotische Bild des „verligens“ um, indem er das äußerlich bösartige und übertriebene Machtgehabe Erecs - in der sog. „verligen“-Szene - als Zeichen seiner „Ohnmacht“ und als Folge seiner sexuellen Impotenz umdeutet. Durch eine Reihung von derben, stark sexuell eingefärbten dichterischen Bildern bescheinigt er Hartmann von Aue gleichzeitig dichterische „Impotenz“, was die Auswahl seiner Motive und Inhalte angeht.
Auf diese Kritik hat Hartmann selbst nicht geantwortet, vielleicht auch nicht mehr reagieren können, weil er schon verstorben war. Sein Erecroman entstand (Ursula Schulze, 1883, S. 24) um 1185, spätestens 1192, also etwa eine Generation früher als Wolframs Parzivalprolog. Stellvertretend erfolgt also eine Erwiderung auf diese Satire durch Gottfried im Literaturdiskurs des „Tristan“ (Tr. 4619-4688). Dieser Text läßt eindeutig erkennen, daß er gleichzeitig Lob und Verteidigung Hartmanns von Aue und Schelte für Wolfram sein soll.
Die radikale Satire Wolframs auf das zentrale Motiv eines anderen Dichters läßt einem Interpreten keine Alternative, es etwa gutzuheißen oder aus Gründen der Pietät zu übersehen. Aus christlicher Perspektive ist nicht einzusehen, daß ausnahmsweise die „ere“ des Romanhelden Erec , im Gegensatz zur immer schon verbindlichen kirchlichen Lehre , im fiktiven Romangeschehen der ausschlaggebende Grund für dessen ewiges Heil (Er. 10124f) und die Erlösung der ritterlichen Gesellschaft sein soll.
Die Gottgefälligkeit des Helden, auf die Hartmann anscheinend großen Wert legt, hat mit Christlichkeit überhaupt nichts zu tun. Sie entspricht in etwa der „Christlichkeit“ der Nibelungen, die es für ihre Pflicht hielten, zuerst die Hl. Messe zu besuchen, um sich nach dem Schlußsegen des Priesters gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Die Virtuosität der sprachlichen Gestaltung des Hartmannschen Textes ändert nichts daran, daß sein dichterisches Konzept im „Erec“ aus der Perspektive der Hl. Schrift und der eines christlichen Bewußtseins als Perversion der Glaubenslehre betrachtet werden muß. - Wenn sich die inhaltliche Kritik Wolframs als Satire stichhaltig erweist, ist das auch von Bedeutung für die Beurteilung der Form des „Erec“. Diese Frage steht jedoch hier nicht zur Diskussion.
Der Einwand, Hartmann von Aue habe durch seine persönliche Teilnahme am Kreuzzug seine Christlichkeit und die seines Werkes hinreichend unter Beweis gestellt, (ganz anders als ein heutiger Interpret es kann, der diese kritisiert), verfehlt den Sinn der Kritik an seinem religiösen Konzept. Die guten Absichten werden keineswegs bestritten. Es geht hier auch nicht um Schuldzuweisungen an den Dichter, sondern darum zu belegen, daß wesentliche Inhalte des Christentums, das ja aus einer Jahrtausende alten Wüstenreligion hervorgegangen ist, von der Ritterschaft bzw. der höfischen Gesellschaft, die ihre germanische Herkunft nicht verleugnen konnte und wollte, noch gar nicht angemessen rezipiert worden waren. Die Frage stellt sich heute noch, ob man die Ritterschaft trotz zahlreicher Kreuzzüge überhaupt schon als christliche Gesellschaft bezeichnen konnte, von bekannten Ausnahmen abgesehen.
Da dieselbe christliche Lehre - sowohl im 12. als auch im 20. Jahrhundert - gilt, ist leicht zu erkennen, daß Hartmanns dichterische Motive eine durchgehend häretische Struktur haben. Diese Perversionen der christlichen Lehre mit dichterischen Mitteln als gefährliche Irrlehre zu markieren, betrachtet Wolfram als seine Aufgabe. Darin liegt der eigentliche Sinn seiner kompromißlosen Satire. Sie richtet sich auch gegen einen Zynismus, der auf dem Hintergrund eines falschen Gottesbildes „nichtige“ Motive (z.B. falsche Liebes- und Ehrbegriffe) idealisieren möchte. In seinen Augen handelt Hartmann als Dichter ebenso wie die Elster im Parzivalprolog, die für sich ihre Farben nach dem Prinzip von „Alles und Nichts“ aussuchte.- Es scheint dagegen ein Problem der heutigen Germanistik zu sein, religiösen Fragen in der Dichtung die gebührende Bedeutung beizumessen oder sie richtig einzuschätzen. So wird Erecs Verhalten, das insgesamt mit Christlichkeit überhaupt nichts zu tun hat, dennoch in älteren (Kuhn) und neueren Arbeiten als durchaus christlich und vorbildlich interpretiert. Die „religiöse Problematik und Erecs Stilisierung zum christlichen Fürsten (weise) auf eine spezifische Funktion des deutschen Erec hin“, meint Ursula Peters (1975, S. 193).
Von Tobler (1984) wird Erec als wörtliche Analogie zur Christusfigur gedeutet. Diese Exegese mag im Sinne Hartmanns richtig sein, weshalb man nicht von Fehlinterpretation sprechen möchte. Erstaunlich ist nur, daß der Erecroman - inhaltlich gesehen - nicht als eine Parodie auf die christliche Lehre empfunden wird. Das Problem ist die falsche Deutung des christlichen Glaubens durch die Dichtung Hartmanns von Aue, die man sogar aus der Perspektive eines „naiven“ („wenn ihr nicht werdet wie die Kinder“) Verständnisses des Christentums nicht übersehen kann. Ihre „blendende Form“, die sich nicht der religiösen Wahrheit verpflichtet fühlt, war im kirchlich-religiösen Sinne eine große Gefahr für die Hörerschaft und in Wolframs Augen nur „Blendwerk“. Ein „höfischer Gott“, als selbstgemachtes Gottesbild in Form einer dichterischen Fiktion, ist auch für die Germanistik im Umgang mit mittelalterlicher Literatur fragwürdig. Wolfram erlaubt weder sich noch seinen zeitgenössischen Kollegen ein „Reservat“ für solche literarischen Vorstellungen. Daher kann man seine Kritik am „Erec“ verstehen. Wenn es einem höfischen und sich christlich verstehenden Dichter grundsätzlich erlaubt wäre, mit einem fiktiven („höveschen got“), von der christlichen Lehre abweichenden Gottesbild[28] zu operieren, gäbe es kein Wahrheitskriterium (im christlichen Sinne) mehr. Ein solches gilt zwar nicht für die heutige Literaturwissenschaft; aber es galt für das hohe (oder „finstere“) Mittelalter. Der „Erkenntnisgewinn“ solcher Dichtung strebt dann nicht nur gegen „Null“, sondern schlägt ins Gegenteil um: in Verwirrung. Konträr zu dieser Meinung wagt Antonin Hruby die Hypothese: „Hartmann (bilde) [...] die Avantgarde des moralphilosophischen Denkens seiner Zeit [...]“, und seine „Sittenlehre (stimme) grundsätzlich“ mit der „Moraltheorie des Thomas von Aquino“ überein (Hruby, 1977, S. 212 f.).
Wolframs Urteil über das Grundmotiv des „Erec“ wird in der Literaturwissenschaft des 20. Jahrhunderts sicherlich nicht gern akzeptiert. Die traditionelle „Verbindlichkeit“ der Religion im religiösen und gesellschaftlich-kulturellen Leben des 12. Jahrhunderts gibt es heute nicht mehr. Daraus folgt andererseits, daß eine „aufgeklärte“ Literaturwissenschaft ohne eine künstlich „naive“ Einstellung zur Religion (die selbstverständliche ist abhanden gekommen), wie sie hier bereits als „naives“ kreatives Verhältnis zur Kunst in Anspruch genommen wurde, kaum eine Chance hat, die „Erec“-Satire im Parzivalprolog als solche zu entdecken; aus dem einfachen Grunde, weil man sie gar nicht erwartet und deshalb nicht danach sucht.
Das in der heutigen Forschung weniger kritisch bewertete zentrale Problem des „verligens“ ist andererseits für literaturwissenschaftliche Interpretationen und Analysen immer noch Ausgangspunkt aller möglichen Betrachtungen. Das trifft zu für thematisch ganz unterschiedliche Varianten zum Thema von Minne und Ritterpflicht, die z.B. verstanden werden als:
- „eine zeittypische Variante des jeder Gesellschaftsordnung eigenen Grundproblems ‘Beruf und Familie’ (Wapnewski, 1962);
- Neubewertung der Rolle der Frau als Vermittlerin ritterlichen Heldenmuts auf dem Hintergrund religiös-sittlicher Konflikte (Hruby, 1964);
- Relation von ehelicher und höfischer Minne, vorgeführt an einer Ehekrise und ihrer Überwindung (Ruh1967);
- Verletzung und Wiederherstellung des göttlichen und sozialen ordo (Cramer, 1972)“ etc., um nur einige der vielfältigen Themen zu zitieren, die sich aus dem „verligen“-Motiv des Erecromanes ergeben (zitiert nach: Schulze, 1983, S. 15f). Auf diese erweiterten Aspekte kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden.
Wolfram interveniert mit seiner Satire direkt beim zweifelhaften Grundmotiv des Romans. Er opponiert gegen die unverständlichen Bestrafungsaktionen, Leiden und Beleidigungen, welche wie eine Rahmenhandlung (wie ein „cranker messinc“) die Figur Enites umgeben. Er nennt Enite einen „edeln rubin“ und sagt deshalb: „ich enhan daz niht vür lichtiu dinc, swer in den crancen messinc verwurket edelen rubin und al die aventiure sin“, d.h.: „ich halte es für verantwortungslos, wenn man einen edlen Rubin mit einer solchen Geschichte umgibt“. Wolfram bezeichnet Enite als „edlen Rubin“, weil sie von Hartmann selbst mit einem „gelphen rubin[29] “ verglichen wird: „daz was ein gelpher rubin / doch überwant im sînen schîn / diu maget vil begarwe / mit ir liechten varwe“ (Er. 1562-1565). Da die Romanheldin Enite unschuldig ist, interpretiert er das Verhalten Erecs in einem ganz anderen Sinn als Hartmann von Aue: Aus einem delikaten, von diesem verheimlichten Grund, ist nicht Enite, sondern Erec allein verantwortlich für die Katastrophe! Es handelt sich um eine ebenso einfache wie plausible Erklärung für die Zuhörer des „Erec“, die mit Recht nach dem wirklichen Schuldigen fragen.
Auch die Forschung im 20. Jahrhundert stellt hartnäckig die Frage (Wapnewski, 1973, S. 47 u. 51f.) nach der Schuld Enites und kann mit der Erklärung Wolframs zufrieden sein. Hartmann selbst ist im Grunde von der Unschuld seiner Heldin überzeugt, schweigt sich aber aus konzeptionellen Gründen aus, weil dann die Fehlkonstruktion des Motivs erkannt würde! Erec darf in der „Erlöserrolle“ - konzeptionell bedingt - der Schuldige nicht sein. Wenn man also der unausgesprochenen Argumentation Hartmanns folgt, kommt als der eigentlich „Schuldige“ nur der Schöpfer selbst in Frage.
Die Unerklärbarkeit der Schuld Enites ist in der Erec-Forschung zwar diskutiert worden, die Frage danach aber bis heute unbeantwortet geblieben: „Die Antwort der Forschung zeugt von Verlegenheit“ sagt Wapnewski (1983, S. 51), der das ungelöste Problem der Hartmannforschung zwar angesprochen, jedoch nicht mit der gewohnten logischen Konsequenz ausdiskutiert hat. Der Hinweis darauf, ein zweites Motiv (Wapnewski, 1964, S. 53) habe das erste des „verligens“ überlagert, klingt pietätvoll ausweichend. Im Hinblick auf die eigene gewagte Aussage, die schließlich zur Identifizierung der Erec-Satire im Parzivalprolog führte, besteht dafür durchaus Verständnis. Andererseits läßt sich die Pervertierung der christlichen Lehre durch die Dichtung Hartmanns nicht einfach übersehen. Die Identifizierung und Interpretation einer Textstelle als Erec-Satire, die hiermit vorgelegt wird, dürfte weder in der Wolfram- noch in der Hartmann-Forschung einhellige Zustimmung finden. Als Interpret sieht man sich daher, nicht zuletzt wegen der Schärfe der Auseinandersetzung, vor die Alternative gestellt, sich für oder gegen die Position des einen oder anderen Dichters zu entscheiden.
Zum Problem von „Erecs Schuld und Enitens Unschuld bei Hartmann“ (Fisher, 1975, S. 160f.) sagt Fisher unter Bezug auf einen andern Autor, mit dem er einer Meinung zu sein scheint: „Cramer behauptet weiter, (eine) ‘unverdiente Strafe’ komme in der mittelalterlichen Literatur so selten vor, daß man zu einer Suche nach deren Anlaß genötigt sei [...] Wir wären also nahezu verpflichtet, nach einer Antwort auf die Frage zu suchen, warum Enite ihr Los verdient.“ W arum sie ihr Los nicht „verdient “?, scheint mit der vorhergehenden Frage identisch zu sein.
Man kann sich also in der Situation des Interpreten - sozusagen - auf einen moralischen Notstand für die Suche nach dem wirklich Schuldigen im Erecroman berufen. Wapnewski legt den Finger auf den wunden Punkt im dichterischen Konzept Hartmanns, das bei ihm „Arrangement“ genannt wird und stellt fest: „Enite muß vorausreiten, und sie soll schweigen bei Todesstrafe. Ist das brutale Willkür, läßt primitive männliche Empörung sich hier an einer Unschuldigen aus? Das Arrangement meint mehr, nämlich es bezeichnet die totale räumliche und akustische Trennung der beiden, deren totale Sinneinheit zur Katastrophe führte.“ (Wapnewski, 1973, S. 47). Dieses Argument scheint nicht ganz überzeugend gewesen zu sein; denn dieselbe Frage wird in präzisierter Form unter einem anderem Aspekt noch einmal gestellt: „Es bleibt noch eine Frage: die nach Enite: Genauer: welcher Schuld Enites entsprechen die Qualen und Entbehrungen, die Demütigungen und Gefahren ihrer Reise? Die Antwort der Forschung zeugt von Verlegenheit“ (1973, S. 51). Wapnewski argumentiert weiter: „da Enite offenbar büßt, muß dieser Strafe doch eine Schuld vorausgehen.“ Weil jedoch der Dichter selbst, Hartmann von Aue, „mit keinem Wort [...] eine Schuld Enitens“ feststellt („bucht“, wie Wapnewski sagt), kommt er zu dem Schluß: [...] ihr Klagemotiv (war) in der Tat der Anlaß zu jener Bußreise - aber er war nur Symptom der letzten, nicht mit Enite gleichzusetzenden Ursache“. (Wapnewski, 1973, S. 53).
Da also die Forschung keine verbindliche Auskunft geben kann, der Dichter selbst aber nichts verraten will (er müßte eigentlich wissen, wer schuldig ist und es auch sagen!), ist jeder Hörer „genötigt“, in eigener Verantwortung nach einer Antwort auf berechtigte Fragen zu suchen. Ein Suchzwang in diesem Sinne bestand für die Zuhörer im Mittelalter nicht. Weil nämlich die Figur Enites im Romangeschehen deutlich biblische Züge trägt, konnte sich Hartmann darauf verlassen, daß Enite unter ihrer - konzeptionell bedingt - bewußt „transparent“ gehaltenen Hülle (durchlöcherte Kleidung) und den begleitenden Kommentaren als ideales Geschöpf, als eine andere Eva aus der Hand des Schöpfers wiedererkannt wurde. Für jeden Hörer lag damit der Schluß nahe: Wenn diese, der Enite von Gott geschenkte Schönheit, in der höfischen Welt solche Katastrophen auslöst, ist Er - wie bereits mehrfach dargelegt - als Schöpfer verantwortlich, nicht sein Geschöpf. Gott wird damit zu einem dubiosen Mitspieler im Romangeschehen gemacht. Das ist Verfälschung eines jeden Gottesbildes.
Kuhn behauptet zwar, Hartmann sei „zu religiös in den Werken seiner religiösen Krise“ (Kuhn, 1973, S. 70) gewesen. Angesichts der o.a. Analyse fällt es jedoch schwer, das zu akzeptieren. Es ist auch nicht wahr, wenn Kuhn sagt: „Enite entdeckt Erec in einem unfreiwilligen Seufzer die Schande dieser Existenz, die er gar nicht sah. Da unternimmt er sofort, mit ihr zusammen, freiwillig noch einmal den Weg, den im ersten Teil das Schicksal ihnen abgefordert hatte“ (Kuhn, 1973, S. 77) Im Text steht überhaupt nichts von „Freiwilligkeit“ Enites! Im Gegenteil: Erec trieb sie unter Mord- und Gewaltandrohung vor sich her in den Wald und in die gefährlichsten Abenteuer.
Zu den moralischen und religiösen Bedenken kommen noch die literarischen: Wenn Zuhörer ihre außerhalb der Dichtung beheimateten eigenen Glaubensvorstellungen erst aktivieren mußten, um eine literarische Figur in ihrer Rolle zu erkennen, um - dann auch noch - hinter diesem dubiosen „verligen-Motiv“ Gott selbst als „Bösewicht“ zu identifizieren, so fällt die Geschichte wegen der Widersprüchlichkeit des Grundmotivs aus ihrem konzeptionellen Rahmen. Wolfram hilft hier mit seiner höhnischen Satire kräftig, es deutlich sichtbar zu machen. Das zweifelhafte „verligen“-Motiv ist der „wunde Punkt“ des dichterischen Konzeptes, auf den seine ebenso lapidare wie sarkastische künstlerische Satire gerichtet ist. Als Grundmotiv der Dichtung Hartmanns wird es grundsätzlich in Frage gestellt: Erec ist nicht der superpotente Ehemann und Held, nicht der durch Magie von seiner Schuld befreite Sünder, nicht der „wunderaere“ (Erec 10045) Erlöser, der ein schuldig gewordenes Menschenpaar aus dem „Paradies“ erlösen muß, nicht derjenige, der von Gott um seiner eigenen Ehre willen zur Belohnung auch noch das ewige Leben erhält. Das zentrale Motiv des „verligens“ und alles, was daraus folgt, ist eineVerdrehung christlicher Lehre! Mit den Mitteln der Satire entlarvt Wolfram sie auf unnachahmliche Weise in wenigen Versen als Lüge und gibt das dichterische Konzept damit der Lächerlichkeit preis. Für die Metamorphose einer Liebesraserei in Berserkerwut hat Wolfram eine plausible Erklärung, die er in einer Serie von Bildern anbietet.
Die Literaturwissenschaft ist bisher mit der Figur des Erec relativ rücksichtsvoll umgegangen; nicht zuletzt deswegen, weil das sog. „verligen“ und die Reaktion Erecs nach der „verligen“-Szene mit Enite, trotz derber Handgreiflichkeit des Helden auch heute noch vom „Hauch des Metaphysischen“ umweht ist. Dem Dichter scheint es gelungen zu sein, das für Enite geltende Sprachverbot als Tabu („verligen“ ist ein Tabuwort) auch auf die heutigen Zuhörer und Interpreten auszudehnen. Sie fühlen sich bis ins 20. Jahrhundert daran gebunden.
Im Verhältnis zu Wapnewskis kritischem Fragen, warum denn Enite „dieses alles erleiden“ muß, gibt es in der Erecdiskussion auch Tendenzen, den Ehemann - obwohl Täter oder Mittäter bei den Bestrafungsaktionen - dennoch idealisierend zu interpretieren. Solche Überbewertungen finden sich schon bei Mohr (1958), Smid (1978) und anderen. Während Wapnewski (1973) seine Schwierigkeiten mit dem Problem der angeblichen Schuld und Bestrafung Enites deutlich artikuliert, hat die derzeitige Forschung, vertreten durch Tobler, die „verligen“-Szene und die anschließende Reaktion Erecs im Sinne Kuhns auf ihrem fiktiven religiösen Hintergrund thematisch schärfer konturiert und neutestamentlich gedeutet. Diese Deutung entspricht wahrscheinlich dem „Arrangement“ des Dichters. Insofern ist aus wissenschaftlicher Perspektive dagegen nichts einzuwenden, obgleich Perversionen der christlichen Lehre bei Hartmann von Aue damit nicht zur Kenntnis genommen werden.
Die Frage muß erlaubt sein: Was soll eine dichterische Fiktion von menschlicher Beziehung in Ehe und Gesellschaft bewirken, welche die christliche Lehre völlig verfälscht? Was soll eine Fiktion von Glauben, z.B. Enites „ unerschütterlicher Glauben“ an Erec als ihren Erlöser, zu dem sie nicht den geringsten Anlaß hat? Was soll eine Fiktion von christlicher Ehe unter der Befehlsgewalt eines außergewöhnlich despotischen Herrschers und Eheherrn bewirken? Was soll eine Fiktion von Erlösung im heilsgeschichtlichen Sinne außerhalb der Religion? Von der absurden dichterischen Idee ganz zu schweigen, daß Erec - nach Hartmanns Idee im Gewand Jesu Christi (Tobler) - im Romangeschehen eine vergleichbare religiös-metaphysische Rolle spielen soll, wie Jesus Christus in der Heilsgeschichte?
Es gilt festzuhalten, was Weber für die Interpreten des „Tristan“ und die Dichtung Gottfrieds von Straßburg sagte: „daß eine mittelalterliche Literaturwissenschaft ohne gründliche Einbeziehung der jeweiligen philosopisch-theologischen Situation heute schlechterdings nicht mehr denkbar ist“ (Weber, 1962, S. 70); und daß die Forschung, wenn sie sich mit Recht wissenschaftlich nennen will, auch die Pervertierungen, d.h. die Verfälschungen der christlichen Lehre als solche zur Kenntnis zu nehmen habe. Weil sich aber, so begründet Weber seine Stellungnahme „die Haltung des Dichters als die einer grundsätzlichen Skepsis nicht nur gegenüber den kirchlichen Institutionen, sondern auch der christlichen Lehre“ darstellt, die neben dem christlichen Gott „eine zweite metaphysische Macht: das Dämonische“ anerkennt, kann die Wissenschaft nicht mehr umhin, auch die „Pervertierung christlicher Grundbegriffe durch den ‘Tristan’-Dichter“ (Weber, 1962, S. 72) als solche zur Kenntnis zu nehmen und für möglich zu halten, wenn sie denn wissenschaftlich arbeiten und nicht „dogmatisch voreingenommen“ sein will, in dem Sinne, „daß nicht sein könne, was nicht sein darf“ (Weber, 1962, S. 72).
Wer aus einem freigeistigen Klima der Literaturwissenschaft des 19./20. Jahrhunderts religiöse Fälschungen nicht erkennt oder bewußt übersieht, vergibt von vornherein die Chance, über den Inhalt des Literaturstreites zwischen den Dichtern des 12. Jahrhunderts sowie deren Motive etwas zu erfahren. In dieser Auseinandersetzung ging es nicht zuletzt um Inhalte und Wahrheiten des christlichen Glaubens und die zulässige oder unzulässige Verwendung von Glaubensmotiven und -symbolen in der Dichtung, nicht nur um „Formales“. Es wurde auf der Ebene der Motive und Inhalte gestritten, von denen man bis heute relativ wenig weiß. Vertreter einer Literaturwissenschaft, denen es „gleich-gültig“ ist, ob Religion als „Inhalt“ in der Dichtung des Mittelalters eine Rolle spielt oder nicht, verbauen sich m.E. von vornherein den Zugang zu ihr.
Obwohl man der ernst zu nehmenden Empfehlung Wapnewskis folgen möchte, im Umgang mit der mittelalterlichen Dichtung „bescheiden“ zu sein, und auch dem Gedanken von Ganz nicht abgeneigt ist, in einem relativen Sinne „naiv“ mit ihr umzugehen, ist aus Gründen der „Genauigkeit“ dennoch dezidiert die Frage zu stellen, ob das Verhalten Erecs nach dem entscheidenden Gespräch mit Enite, über dessen Inhalt man ja überhaupt nichts erfährt, nicht doch „flegelhaft“ zu nennen sei. Wolfram charakterisiert es im Kontext seiner Erec-Satire so: „dise manger slahte underbint“ (2,23). Es wäre denkbar, daß man als Zuhörer die dichterischen Absichten, z.B. das religiös-metaphysische Grundkonzept nicht nur nicht wahrnimmt, sondern es strikt ablehnt, von den falschen Idealisierungen ganz zu schweigen.
Die Wissenschaft hat also bisher Erecs Flegelhaftigkeit großzügig „übersehen“. Nicht nur das; sie hat diese Figur sogar zu einer „Erlösergestalt“ gestylt und seine (Erecs) Worte und sein Verhalten literarisch überhöht, wie dies dem dichterischen Konzept Hartmanns entspricht. Tobler (1986, S. 433) interpretiert z.B. die „verligen“-Szene so: „Unmittelbar nachdem sie (Enite) ihr Wissen offenbart hat, [...] bricht Erec auf. Hartmann wandelt den Text gegenüber seiner Vorlage ab. [...] unser Text (gibt) durch das kurze, der ist genuoc getân (3052), das Zeichen zum Aufbruch. Sufficit [...] surgite eamus (Mk. 14,41f.), waren einst die Worte Jesu an seine Jünger, mit denen seine Passion eingeleitet wurde.“ (1983, S. 433 Kursivsetzung von der Autorin!). Weiter stellt Tobler in ihrer Arbeit fest, daß Hartmann „für das eigentliche Gemälde [...] seine Farben aus den biblischen Berichten und ihrer Verwendung in Predigt und mystischen Traktaten“ holt (1986, S. 428). Er, Hartmann, „scheut sich nicht, Enite mit einem Attribut zu schmücken, daß seit der Väterzeit Maria vorbehalten war. (Pulchra et luna)“ (1986, S. 432). Die Applikation der für das Christentum heiligsten biblischen Motive auf die Romanfigur Erec geht weiter bis zum Kalvarienberg: „bis sich dann in der Verwundung des Helden symbolisch eine neue Stufe (auf Erecs Leidensweg d.V.) offenbart“. Es heißt: „Erec wird in diesem Streit, der währte unz an die nonezit (4461), also bis zu der Zeit, wo der Christ betend der Sterbestunde Christi gedenkt (Mt.27,46 ff.), an der Seite verwundet (4417f.). Dieser Kampf, do im sin site/ also sere bluote (4423f.), zeichnet Erec mit dem Leidensmal Christi, in dem die Kirche den Quell der Erlösung sieht, lehrt sie doch, daß aus Christi Seitenwunde das Blut floß, das der Menschheit im eucharistischen Wein Heilung bringt“ (Tobler, 1983, S. 433).
Symbolisch-christlich wird von Tobler bereits der erste Kampf Erecs (um den Sperber) gedeutet: „Nach bestandenem Kampf in Tulmein beteiligt sich Erec nicht am Treiben der Menge. In ir schôz leit in / daz kint vrouwe Enîte / ze ruowe nâch dem strîte (Er. 1317ff.), so wie es einst die Himmelskönigin nach bestandenem Leiden mit dem Gekreuzigten tat“ (Tobler, 1983, S. 429). Daß hier auf die Beziehung von Einhorn und Jungfrau angespielt wird, bemerkt man schnell. Aber der Behauptung, daß „diese marianischen Züge“ in der Gestalt Enites „auch ein Zeichen der Verehrung der Gottesmutter“ seien und „vom Interpreten pietätvolle Beachtung erfahren“ (Tobler, 1983, S. 428) sollten, muß man entgegenhalten, daß sich der Dichter, wenn diese Deutungen zutreffen, zuerst „pietätlos“ und geschmacklos gegenüber zentralen christlichen Motiven verhalten hat. Sie sind in der Tat - wie das Eva-Motiv - in Zusammenhänge „verwurket“, wie Wolfram sagt, mit denen sie absolut nichts zu tun haben.
Mit Akribie enthüllt Tobler konzeptionelle Analogien und Sachverhalte in der Dichtung Hartmanns. Ihre Analyse zeigt, wie eng in der Tat die Beziehungen zwischen Dichtung und Religion bei Hartmann von Aue sind. Sie zeigt aber auch, wie in seiner Dichtung Schönheit und Schlechtigkeit, Heidnisches und Christliches, Heiliges und Unheiliges derart vermischt sind, daß man das Eine nicht mehr vom Anderen, Böses nicht mehr vom Guten unterscheiden kann. Insofern kann die zitierte Interpretation auch ein Beleg für die Verwirrung sein, die Hartmann mit seiner Dichtung anstiftete.
Was die Verwendung religiöser Motive im „Erec“ angeht, kommt Schulze (1983) zu ähnlichen Ergebnissen wie Tobler: Lilie und Dornen, die nach ihrer Ansicht als Symbole auf die Unberührtheit und Schönheit Enites hinweisen sollen, sind religiös zu verstehen. „Hartmann hat hier ein Mariensymbol, das auf ein Bild des Hohenliedes (sicut lilium iner spinans, Cant. 2,2) zurückgeht, adaptiert [...]“ (Schulze, 1983, S. 19).
Wenn man diese Interpretationen und Analysen akzeptiert, taucht ein Problem auf, das die Literaturwissenschaft kaum selbst lösen kann, die Frage nämlich, ob ein derartiges dichterisches Konzept des „Erec“ wegen seiner pervertierten religiösen Motive und heilsgeschichtlichen Perspektiven, nicht nur im religiösen, sondern nun auch literarischen Sinne fragwürdig ist. Weil Hartmann mit zweifelhaften dichterischen Fiktionen von Glauben, Schuld und Erlösung, vom Jenseits, mit Fiktionen von christlicher Ehe etc. arbeitet, darüber hinaus viele christliche Motive aus dem Alten und Neuen Testament für die eigene Konzeption kompiliert und mit heidnischen Motiven versetzt, fühlt man sich als Christ befremdet. Die Untersuchungen von Tobler (1986), Schulze (1983), und Smid (1978) lassen ahnen, woran das liegen könnte und warum die Kritik Wolframs so radikal ausfiel.
Nicht zuletzt sind es die Analogiebildungen zwischen der Romanfigur Erec und der christlichen Erlösergestalt Jesus selbst, die äußerst peinlich wirken. Dieser Terminus soll eher eine subjektive Befindlichkeit bechreiben als Aussage über die Form der Dichtung sein. Peinlich sind nicht die hier zitierten wissenschaftliche Analysen. Sie bestätigen nur den kritisierten Sachverhalt. Durch Verballhornung christlicher Motive und Glaubensvorstellungen überschreitet Hartmann von Aue - ob gewollt oder nicht - die Grenzen des religiös Zumutbaren.
Die Aversion gegen die Verwendung christlicher Motive und die Verdrehung der Inhalte christlicher Lehre konkretisierte sich in meiner Auseinandersetzung mit dem Erecroman zu der Frage, wie man sich wohl als Zeitgenosse Hartmanns dagegen habe wehren können. Da im Roman das sogenannte „verligen“ als dichterisches Motiv eo ipso im schmalen Grenzbereich von Ernsthaftigkeit und Lächerlichkeit angesiedelt ist, lag der Gedanke an eine Satire auf dieses Motiv, das ja der Antrieb der ganzen Geschichte ist, sehr nahe. Weil die eigene Erwartungshaltung im Hinblick auf eine mögliche satirische Reaktion Wolframs in der gleichzeitigen Auseinandersetzung mit dem „Erec“ begünstigt wurde, gelang es schließlich, die im Parzivalprolog versteckte Erec-Satire zu identifizieren. Sie gab sich durch ihre Form auch inhaltlich zu erkennen.
Diese - einem liberalen Textverständnis abholde - Auslegung des Textes wird sicherlich nicht allgemein Zustimmung finden. Andererseits darf man für die Zukunft auf Verständnis hoffen, denn: „In der mediävistischen Forschung ist seit längerem eine breite Strömung zu beobachten, die dahin tendiert, den Ausgang der mittelhochdeutschen Literatur aus nicht selbstverschuldeter Unmündigkeit, der sie befreiend gewirkt hat, für einen literarhistorischen Irrtum zu halten und zu widerrufen. Die vierhundertjährige geistliche Bevormundung der geistig Schaffenden in Deutschland war nach dieser Lehre gar keine oder wäre nicht als solche empfunden worden, im Gegenteil: die erstklassigen Autoren weltlichen Standes, die erst seit Heinrich von Veldeke und Hartmann von Aue zu Wort kamen, schreiben und publizieren konnten, sollen nichts Besseres zu tun gewußt haben, als ihre neuartigen Gedichte und Erzählungen mit geistlicher Allegorese zu durchtränken und auf raffinierte, weil verschlüsselte Weise dasselbe zu tun, was die geistliche Poeten - in der Mehrzahl blasser Durchschnitt und darunter - unverhüllt getrieben hatten: propaganda fidei“ (W. Schröder, 1979, S. 8).
Ein Literaturwissenschaftler muß kein gläubiger Mensch sein. Aber „Wolfram von Eschenbach war ein frommer Mann“, der sich zu seinem christlichen Glauben „nicht bloß äußerlich bekannte“ (W. Schröder, 1979, S. 8). Das sollte man schon aus methodischen Gründen zur Kenntnis nehmen. Konnte es für ihn – subjektiv gesehen - wirklich „etwas Besseres“ geben, als seine Glaubensüberzeugungen - in dichterischer Form vermittelt - anderen mitzuteilen oder sie gegen Angriffe zu verteidigen? „Im Eifer für die gute Sache“ konnte es dabei einem jungen Dichter wie Hartmann von Aue, der sich sicherlich als Protagonist des Christentums verstand, schon passieren, daß er - wie im Fall des „Erec“ - weit übers Ziel hinausschoß. Harte Korrekturen an seinem dichterischen Konzept durch Wolframs Satire waren die Folge. - Zum bereits zitierten aufklärerischen „literarhistorischen Irrtum“ macht W. Schröder noch eine weitere bemerkenswerte Aussage: „Die Kirche hat, soviel wir wissen, weder an Wolframs Grübeln noch an seinen Antworten als Dichter Anstoß genommen“ (W. Schröder, 1979, S. 8f.). Es bestand m.E. auch nicht die geringste Veranlassung dazu.
9.2 Die Erec-Satire im Parzivalprolog
Die hier vorgelegte lapidare und interpretierende Inhaltsangabe[30] des Erec kann nicht vollständig sein. Die Andeutungen reichen jedoch aus, um den in folgenden Bildern des Parzivalprologs versteckten beißenden Spott auf Hartmanns Dichtung zu verstehen. Wolfram eröffnet seine Attacke wie ein Turnier:
„dar an si nimmer des verzagent, beidiu si vliehent unde jagent, sie entwîchent unde kêrent, si lasternt unde êrent. swer mit disen schanzen allen kann, an dem hât witze wol getân“ (2,10-15).
Nicht nur die Frauengestalt der Isolde (Gottfrieds v. Straßburg) wurde angegriffen und dabei Enite geschont (3,15-25), sondern gegen Hartmanns Helden „Erec“ selbst in einigen Verse vorher schon eine heftige Attacke geritten „vliehent unde jagent, entwichent und kerent, lasternt unde erent“ (2,10-12). „Wer die Chancen eines solchen Kampfes nutzen kann“, fährt er sinngemäß fort, „ist mit Geistesgaben wohl ausgestattet“ (2,13-14)“. Hartmann bzw. seinem Helden Erec wird diese Klugheit - nicht expressis verbis - sondern mit gnadenlosem, „nonverbalem“ Spott durch die Reihung von mehreren entla rvenden dichterischen Bildern abgesprochen:
„der sich niht versitzet noch vergêt, unt sich anders wol verstêt. valsch geselleclicher muot ist zem helleviure guot, und ist hôher werdekeit ein hagel. sin triuwe hât sô kurzen zagel, daz si den dritten biz niht galt vuor si mit bremen in den walt. dise manger slahte underbint iedoch niht gar von manne sint“ (2,15-24).[31]
Wenn man aufgrund der beiden letzten Verse fragt, von welcher männlichen Ungezogenheit („dise manger slahte underbint“) hier die Rede ist, stößt man - durch „verbale Einkreisung“ mit Hilfe von „versitzen-vergehen-verstehen“ - auf das ungenannte Wort „verligen“. Ohne das zentrale Motiv des „Erec“ zu nennen - es ist ja ein Tabuwort - , gelingt es Wolfram, mit stilistischen Mitteln die Hörer darüber aufzuklären, daß er genau dieses „Unwort“ im Visier hat: Wolframs unausgesprochenes Wort („verligen“), das nach dem künstlerischen Prinzip der Reihung dennoch (als „Negativform“) „da“ ist, meint Erecs völlig unhöfisches Verhalten. Es ist identisch mit „diese manger slahte underbint“. Als „verligen“ ist es das Kennwort für den gleichnamigen Helden im „Erec“ Hartmanns von Aue. Interessant ist, wie Wolfram sich passender Mittel bedient, um das „verligen“-Tabu zu zerstören, vor allem aber, wie es stilistisch „gemacht“ wird[32]:
Im Ensemble der im Vers 2,15f. herbeizitierten Wörter für verschiedene selbstverständliche menschliche Körperhaltungen oder Tätigkeiten wie sitzen, gehen, stehen, fehlt „ausdrücklich“, d.h. in künstlerischer Absicht, das Wort „liegen“. Durch den „Umstand“ der in einer Reihe „aufgesagten“ Verben wird vom Hörer, bewußt oder unbewußt, das nichtgesagte Wort als „Lücke“ in dieser Reihung oder als „verbale Einkreisung“ des „Nichtgesagten“ (verligens) empfunden. Es entsteht der Zwang, die „Lücke“ assoziativ zu vervollständigen, d.h. gestaltlogisch zu ergänzen. Jeder, der diese Reihe hört, vor allem aber der literaturkundige Zuhörer des 12. Jahrhunderts, tut dies von sich aus „automatisch“, m.a.W. aus einer „selbstverständlichen“ psychischen Reaktion.
Durch die identische Vorsilbe „ver“ bei den ungleichen Wörtern sitzen, gehen, stehen, wird der Eindruck einer bewußt „fehlerhaft“ gemachten Reihe noch verstärkt, wodurch auf die „gewollte Lücke“, und das in ihr „Fehlende“ und „Fehlerhafte“ noch stärker hingewiesen wird. Die Hörerschaft „starrt“ unbewußt „nur“ noch auf das „Loch“ in der seltsamen Bilderreihe, weil dort das wichtigste, noch fehlende Wort erwartet wird: das „verligen“. Sie wird auf diese Weise in die Geschichte hineingezogen, ohne es zu bemerken.
Durch die Methode, gerade das wichtigste Wort nicht zu nennen, sondern es mit anderen Wörtern zu „umschreiben“ oder als ein „ nichtgesagtes Wort “ (nach dem künstlerischen Prinzip der Polarität von: „Sagen“ und „Nicht-Sagen“) als „Negativform eines Wortes“ in seiner vorgesehenen Position nur mit positiven Verben einzukreisen, ist Wolfram ohne großen Aufwand und ohne ein Wort über das Objekt seines Spottes und seine Absicht zu verlieren, mit seinen Zuhörern blitzschnell beim Hauptproblem Erecs angelangt. Das Tabu des „verligens“ wird umgehend „durch die mül gezücket“ (144,1), durch die Mühle seines Spottes gedreht, wie Wolfram an anderer Stelle bereits angedroht hatte. „lasternt“ (2,12) bricht er das Meidungsgebot, über Erecs Verhalten zu sprechen, dem sich Enite bedingungslos beugen mußte. Wie für sie galt es selbstverständlich auch für die Zuhörer Hartmanns.
Indem Wolfram mit einer Reihung von zweideutigen dichterischen Bildern dem „Helden“ die Maske bzw. den Helm und die ganze Pseudoritterlichkeit seines Verhaltens im Sinne des Wortes vom Leibe riß, stellte er ihn in unnachahmlicher Weise völlig bloß. Allerdings geschah es damals nicht so wie beim derzeitigen nordamerikanischen Präsidenten Clinton, dessen sexuelle Affairen sich mit Hilfe von Zeitungsliteratur breiig über das Land verteilen, sondern in literarischer Verhüllung (in künstlerischer Form der Satire), welche die Grenzen der Scham achtete. Deshalb ist sein „Beispiel“ auch „tumben liuten gar ze snel/sine mugens niht erdenken“. Es nimmt der Kritik dadurch jedoch nichts von ihrer Schärfe, sondern steigert sie sogar noch in ihrer Wirkung: Da Wolfram seine bitterböse Satire in Form eines komplexen Bilderrätsels vorträgt, sind die Hörer aufgefordert, sich durch ihre Mitarbeit (stiure) selbst an dieser Kritik zu beteiligen. Das verursacht zwar einige Mühe, vermittelt ihnen aber ein Gefühl von Beteiligtsein und „Entdeckerfreude“, freilich ganz auf „Kosten“ Hartmanns von Aue bzw. seines „Helden“.
Die als „Negativform“ existierende Satire Wolframs auf das dichterische Bild des „verligens“ paßt haargenau zu dem Tabu, mit dem es von Hartmann von Aue selbst belegt wurde. Wolfram zerbricht das Tabuwort „verligen“, um seinen geheimgehaltenen Inhalt als Lüge zu enttarnen. Nicht nur das! Mit den eigenartigen Wortbildungen „versitzen, vergehen und verstehen“ fängt er das gesuchte Tabuwort „verligen“ ein und spießt es in der Satire auf:
„versitzen“ ist eine spöttische Variante zu „verligen“. Gleichzeitig ist es Kritik daran, wie Erec seine Frau „besitzt“, nämlich verkehrt, d.h. „versitzt“. Das zweite Wort dieser Reihung; „vergen“, bedeutet „verlaufen“ oder „verirren“; es heißt im 12. Jahrhundert aber auch schon „sich vergehen“ im schwerwiegenden Sinne von „Verbrechen“. Das dritte Wort der Reihung „versten“ hat mit „aufrechter Haltung“ im übertragenen Sinne, mit „Aufrichtigkeit“, mit „staete“, auch mit „Verstand“ etwas zu tun. Insofern kann es als Hinweis auf den bei Hartmann angezweifelten dichterischen Sachverstand und seine Moral verstanden werden. Auch bei diesen einfachen Verben wird ihre Mehrfachbedeutung stilistisch eingesetzt, wie bei den in der Erec-Satire benutzten Substantiven „zagel“, „biz“ und „bremen“ als Äquivokationen.
In der Forschung ist die seltsame Wortreihung „versitzt, verget, verstet“ (2,15f.) schon früh aufgefallen. Bumke bemerkt dazu: „Häufig sind Wortwitze, die fast immer dieselbe Struktur haben: ein Wort oder Wortteil wird wörtlich genommen und erhält dadurch eine überraschende, vom gewöhnlichen Sprachgebrauch abweichende Bedeutung. So wird ‘verstehen’ mit ‘versitzen’ und ‘vergehen’ zusammengestellt“ (1997, S. 137). Auf den Hintergrund des oben Gesagten bezogen, erscheint diese sonderbare Reihung nicht mehr nur als Witz, sondern als eine besondere künstlerische Form, durch die das Tabu-Wort „verligen“ zwar herbeizitiert, aber selbst nicht ausgesprochen wird. Es ist Leitwort für das Verhalten Erecs, das in den unmittelbar anschließenden Versen 2,17-22 mit abgrundtiefem Spott überzogen und der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Diese Satire im Parzivalprolog kann nur auf dem Hintergrund des „Erec“ identifiziert und gedeutet werden.
An dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß einem literaturkundigen Publikum des 12. Jahrhunderts die formelhafte Verwendung von „gehen sitzen-stehen“ im Zusammenhang mit erotischen Verwicklungen schon aus dem „Tristan“ bekannt gewesen sein muß. Gottfried von Straßburg beschreibt voller Sympathie, wie Tristan und Isolde am Hofe in unmittelbarer Nähe des Königs Marke skrupellos ihr ehebrecherisches Verhältnis im „Jagdrevier der Liebe“ genießen („da was amie unde amis / alle zit unde alle wis / in der minnen bejage / si begunden dicke in dem tage“ 12973-76, Spiewok, 1991). Die entscheidende Stelle im „Tristan“ 12984ff. („wâren si beidiu gênde / sitzende unde stênde“) übersetzt Kühn (1994, S. 390) so:
„Das trieben sie so Tag und Nacht und kamen doch nicht in Gefahr. Im Gehen, Sitzen und im Stehen waren beide im Verhalten und in ihren Äußerungen offenherzig, frank und frei“ (Tr. 12984-12989).
Die im Prologtext nachfolgenden Metaphern aus dem Pferdemilieu bestätigen jedoch, daß die bereits bekannte formelhafte Reihung auf Erecs Verhalten zielt. Der Seitenhieb in Richtung „Tristan und Isolde“ ist nicht zu übersehen.
9.3 Das „verligen“ Erecs oder der „valsch geselleclîche muot“ (2,17)
Der Doppelvers „valsch geselleclicher muot / ist zem helleviure guot“ ist im Parzivalprolog unmittelbar zwischen dem indirekten Hinweis auf das „verligen“ („versitzt-verget-verstet“) und der anschließenden Satire auf Erecs Verhalten angeordnet. Diese Umrahmung spricht dafür, daß „valsch geselleclicher muot“ sowohl mit der Liebesraserei Erecs als auch mit seinem anschließenden Wüten („bremen“, Brummen = Wut) in Beziehung steht. Ein derartiges Liebesverhältnis hat keinen Bestand, wie man am Beispiel Erecs sehen kann: Unmittelbar nachdem sich Enite über ihr „falsches geselliges Beisammenseins“ geäußert hatte, schlägt seine Liebe in Haß um. Der entsprechende Text im „Erec“ Hartmanns lautet:
„als er vernam diu maere waz diu rede waere, er sprach: ‘der ist genuoc getan’“ (Tr. 3050 ff).
Es klingt, als ob jemand wütend reagierte, etwa mit „basta“ oder „mir reicht’s“! Erec untermalt seine lapidare Reaktion mit Kriegsgeschrei („er begunde kroiieren“, Er. 3082). Wolfram nennt ein solches berserkerhaftes Verhalten im Anschluß an seine Satire: „Diese manger slahte underbint“ (2,23). Man könnte etwa so übersetzen: Dieses flegelhaftes Verhalten.
Der „valsch geselleclîche muot“, womit aus naheliegenden und „verligenden“ Gründen der ständige und „unanständige“[33] Aufenthalt Erecs bei der Geliebten im Bett gemeint ist, der angeblich zum Erliegen des gesellschaftlichen Lebens führt, wird von Wolfram kurz theologisch und moralisch bewertet mit den Worten: „valsch geselleclicher muot / ist zem helleviure guot / und ist hoher werdekeit ein hagel“ (2,18). Er ist deshalb ein „hagel“, weil er im Widerspruch zur außerordentlich hohen Wertschätzung der Geschlechtlichkeit des Menschen („hohe werdekeit“) steht, die im Rahmen des Heilsplanes Gottes, ursprünglich auch als Weitergabe des Gnadenlebens (göttlichen Lebens) durch menschliche Zeugung gedacht war. Dieser ursprüngliche Adel des Menschengeschlechtes wird durch Erecs Verhalten deformiert.
Im Versgefüge des Parzivalpologs wird der hohe „Adel“ satirisch zu „hagel“. Er wird im Hagelschlag des „verligens“ am Boden zerstört. Dieses „verligen“ in Verbindung mit Erecs bösartigem Verhalten in der Dichtung Hartmanns und der „valsch gesellecliche muot“ in Wolframs Parzivalprolog scheinen identisch zu sein. Das „verligen“ durchzieht als Leitmotiv des „Erec“ die Dichtung Hartmanns bis zu den letzten Versen („do er sich durch si verlac“, Er. 101123).
Angesichts dieses zweifelhaften Motivs läßt Wolfram von Eschenbach seiner Spottlust freien Lauf. Erbarmungslos diagnostiziert er am „verligen“-Motiv die Lüge als Potenzschwäche des Helden Erec und damit auch seine Unaufrichtigkeit im übertragenen Sinne als den wirklichen Grund für sein unerklärliches und bösartiges Verhalten. Ironisch und zur Veranschaulichung wendet er sich der medizinisch-anatomischen Seite des Problems zu. Vermutlich hätte eine potenzsteigernde Pille, die derzeit in aller Munde ist, dem Helden wieder „auf die Sprünge“ helfen können. Der aktuelle Bezug kann die Erklärung des tradierten literarischen Problems erleichtern.
Nachdem Wolfram festgestellt hat, daß der „valsch gesellecliche muot“ für das Höllenfeuer gut und mit der Menschenwürde unvereinbar ist, fährt er mit einer anthropologisch-medizinischen Diagnose fort: „sin triuwe hat so kurzen zagel“ (2, 20). Auffallend ist die Verbindung von „triuwe“ und „zagel“ mit der Betonung auf „ so kurzen“ zagel! „sin triuwe“ bezieht sich auf den „muot“ (valsch geselleclichen), der nur personal gedacht werden kann, selbst wenn er negativ beschrieben ist. Also wird mit „sin triuwe“ auch Erec bzw. sein „valsch geselleclicher muot“ angesprochen. Die enge und absolut ungewöhnliche Nähe von „triuwe“ und „zagel“ in einem poetischen Vers signalisiert einen sexuellen Hintergrund. Diese Annahme wird durch die anschließenden Verse bestätigt.
Mit dem ostentativen Ausdruck „so kurzen zagel“ wird eine „erek-tile“ Disfunktion des Helden indiziert. Die Erec-Satire unterstellt, diese intime Schwäche sei der wahre Grund für Erecs unerklärliches Verhalten und nicht die Schönheit Enites oder das Erlöschen des gesellschaftlichen Lebens. Erec hatte sich verausgabt, war vielleicht sogar wegen seines „verligens“ impotent geworden. Damit nur ja niemand in der Gesellschaft etwas von diesem Mißgeschick erfuhr, durfte Enite unter Androhung der Todesstrafe kein Wort mehr sagen. Deshalb verließen Erec und Enite überstürzt den Hof und die Gesellschaft.
Wenn Wolfram in ein und demselben Vers von „triuwe“ und „zagel“ spricht, hat er nicht an den „zagel“ eines Pferdes gedacht, das ihn braucht, um lästige Fliegen („bremen“) damit zu vertreiben. In einer Parodie auf die superpotente Sexualität Erecs, die Hartmann ganz bewußt herausstellt, werden Wichtigtuerei und Verlogenheit des gestelzten, angeblich gesellschaftlichen Problems des „verligens“ bloßgestellt und bildhaft aufgespießt: Erec ist in Wirklichkeit ein „Schlappschwanz“, eine Metapher für Versagen, die man gelegentlich noch heute im Volksmund hören kann. Für einen so attackierten Ritter bzw. Dichter ist dies eine unglaubliche, wenn nicht gar die denkbar gröbste Form der Beleidigung.
Durch den Gebrauch des Stilmittels der Äquivokation, wie bei „zagel“ („zagel stm., schwanz, schweif; [...] männliches Glied;“ Lexer, 1992) d.h. durch die Benutzung eines Wortes mit zweifacher Bedeutung, wird offengelassen, was der Dichter wirklich meint, und der Hörer verstehen soll. Diese Doppeldeutigkeit ist dichterische Absicht. Das geht aus der Stimmigkeit des hier vorgestellten ersten mit den nun folgenden Bildern, dem „driten biz“ und dem „driten biz, der nicht galt“ hervor. Ihre hintergründige Bedeutung leuchtet nur blitzlichtartig auf. Der Hörer erkennt sie nur, wenn er nicht zu „den tumben liuten“ zählt; denn die Erec-Satire besteht wie das Elsterngleichnis aus „flüchtigen Bildern“. In dieser Reihe satirischer Bilder soll also die mindere Reichweite von Erecs Sexualität im wirklichen und übertragenen Sinne in bezug auf „triuwe“ und höfisches Verhalten besonders drastisch als Versagen veranschaulicht werden.
Expressis verbis ist allerdings von den in der Satire verborgenen Vorwürfen nichts greifbar. Erkennbar sind sie nur für den, der seine „stiure“ entrichtet hat; nicht zu überhören auch für den, „der anders wol verstet“ (1,16). Man kann davon ausgehen, daß Gottfried von Straßburg, ebenso wie seine Zeitgenossen, es „anders wohl verstanden“ hatten als nur oberflächlich. Daß Wolfram keine Probleme hatte, seine Zuhörer mit pikanten Details aus dem Bereich der Sexualität zu konfrontieren, ist bekannt, so z.B. in der Badeszene mit Parzival, als es darum ging, dem Publikum die mittlerweile eingetretene Mannbarkeit des Helden anzuzeigen (167, 26-28).
9.4 Der „dritte biz“ (2, 22) - eine erotische Metapher
Der Vers „daz si den driten biz niht galt“ ist durch Enjambement mit dem vorhergehenden „sin triuwe hat so kurzen zagel“ und dem folgenden „vuor si mit bremen in den walt“ verbunden. Dieses stilistische Mittel ist ein Hinweis darauf, daß der zugrundeliegende Gedanke außerordentlich wichtig ist und mit beiden Teilversen eine Einheit bildet. Er lautet:
„sîn triuwe hât sô kurzen zagel daz si den driten biz niht galt vuor si mit bremen in den walt“.
Der mittlere Vers gehört als Begründung sowohl zum vorhergehenden als auch zum nachfolgenden Vers. Zwei im Grunde unabhängige Aussagen sind auf diese Weise ineinander geschoben und zu einer Einheit verwoben. Sinngemäß ist also weiterhin die Rede vom „valsch geselleclichen muot“ und dem „verligen“. Vordergründig kann man den Text lesen und übersetzen wie Spiewok: „Die Zuverlässigkeit solcher Gesinnung hat einen so kurzen Schwanz, daß sie schon den dritten Stich nicht mehr abwehren kann, wenn im Walde die Bremsen über sie herfallen.“ (Spiewok, 1981, 9). Diese Übersetzung ist nicht falsch.[34] Sie ist nicht zuletzt deshalb zulässig, weil Wolfram sie als Verschleierung (Hülle) für sein sprachliches Bild benutzen möchte. Man kann zwar die erste Lesart nicht als unsinnig bezeichnen, muß aber zugeben, daß sie nicht befriedigt; sie bleibt rätselhaft. Unter dem „Schleier“ des mittleren Verses ist wiederum ein eigenes dichterisches Bild verborgen, das zur Parodie der vorhergehenden Zeile paßt.
Wenn der Dichter im o.a. Vers mit dem Wort „biz“ tatsächlich den Stich der Bremsen meinte, hätte er eher das zutreffende Wort „stich“ („stich stm. stich, (auch das speerstechen); punkt; augenblick [..]“Lexer, 1992) nehmen müssen. Das mhd. Wort „biz“ ist aber der Biß eines größeren Tieres („biz stn, die gebissene wunde; das gebiß des pferdes“, Lexer, 1992) Die mögliche Bedeutung von „Stich“ ist im Lexikon bei „biz“nicht angegeben. Der Schwerpunkt bei diesem Wort liegt ohnehin auf „beißen“ und nicht auf „stechen“ und hat eher mit Pferden, wie im Lexikon angegeben, als mit „Bremsen“ zu tun.
Der „biz“ ist also im Kontext des Verses nicht etwa der Stich einer Bremse (Pferdefliege), die übrigens einen Saugrüssel hat und deshalb gar nicht stechen oder beißen kann, sondern nach Lexikonauskunft u.a. „eine, durch eine Lanze - im übertragenen Sinne - verursachte „Bißwunde“, oder auch der „Biß des Pferdes“. Sowohl mit dem „biz“ als „Lanzenstich“ (gêr, der Wurfspieß wird zu gër oder gir und „girde“, d.h. Begierde, Lexer, 1992) als auch mit dem „Biß des Pferdes“ sind immer auch unterschwellige erotische Bedeutungen verbunden gewesen:
Die Streitrosse der Ritter waren wegen der größeren Masse und ihres Temperaments ausschließlich männliche Pferde, d.h. Hengste. (vgl. Dietmar Peschel-Rentsch, 1998, S. 14). Der Biß eines männlichen Pferdes hat nun eine metaphorische Bedeutung und stellt die Beziehung zu Hartmanns Helden Erec als dem „Pferdemann“ her. In eine erotisch-sexuelle Richtung, wenn auch weniger stark, kann schon das einfache Bedürfnis des Pferdes nach Nahrung oder Wasser weisen. Ackermann-Arlt bringt dafür ein Beispiel: „Der Durst des Pferdes entspricht dem grenzenlosen Minneverlangen Lancelots, es sind zwei einander entsprechende Kräfte“. In der erklärenden Fußnote zu diesem Satz heißt es: „Nochmals sei die Bedeutung des Pferdes in der Bibel als Symbol des irdischen Menschenglücks und der fleischlichen Lust in Erinnerung gerufen“ (Ackermann-Arlt, 1990, S. 176).
Der Umgang mit Pferden war im 12. Jahrhundert für einen Ritter und Ritterdichter selbstverständlich, auch im übertragenen Sinne des Wortes. Aus heutiger Sicht wird gern unterstellt, daß es dabei zu emotinalen oder persönlichen Beziehungen zwischen Mensch und Tier gekommen sein könne. Das war nur höchst selten der Fall. Ackermann-Arlt (1990, S. 260) kennt nur ein einziges literarisches Beispiel aus dem „Willehalm“ (58,21), als Willehalm seinem erschöpften Pferd Puzzât nach der Schlacht „seine geheimsten Sorgen mitteilt“ und es eigenhändig liebevoll versorgt. Fütterung und Pflege der Tiere wurde in der Regel nur von Pferdeknechten erledigt.
Dem Menschen des 20. Jahrhunderts fehlen diese Erfahrungen. Sie sind jedoch für das „Verstehen“ bestimmter Sach- und Sprachzusammenhänge aus dem höfischen Leben, das auch im weitesten Sinne „Pferdeleben bzw. Pferde-Erleben“ war, notwendig. Das macht sich nicht zuletzt beim Studium der Ritterliteratur als Mangel bemerkbar: Wer sich mit Pferden auskennt, weiß zum Beispiel, daß ein Hengst, wenn er eine Stute bespringt, mit einem Biß in ihre Mähne, von ihr Besitz ergreift und sie festhält: ein Bild urwüchsiger Kraft, aber auch der Gewaltanwendung. Der „dritte biz“, den Wolfram von Eschenbach hier braucht, spielt so auf das artgerechte Verhalten eines männlichen Pferdes bei der Begattung einer Stute an. Aufgrund mehrjähriger praktischer Erfahrungen im tagtäglichen Umgang mit Pferden auf einem Bauernhof des Münsterlandes sowie eingehender Nachfragen bei dem Leiter des hiesigen Gestütes Niederbolheim, einer Zweigstelle des bekannten Warendorfer Gestütes, Herrn Horst Ense, wurde mir bestätigt, daß die Hengste zunächst durch mehrere „Bisse“ in die Mähne der Stute - ob es genau drei Bisse sind, ist hier nicht die Frage - deren Bereitschaft („und wem si dâ nach sî bereit“, 2,29) für die Begattung erkunden wollen - und müssen. Dieses ritualisierte Verfahren, eine Art Liebesvorspiel - der Fachmann spricht von „nabbern“ - ist deshalb erforderlich, weil die Ablehnung der Stute beim Besteigen für den Hengst gefährlich werden könnte. Wenn sie unwillig ist, schlägt sie mit ihren Hufen nach hinten aus. Die „drei Bisse“ sind also ein feststehendes „Verständigungsritual“ bei Pferden. Es bedeutet bei Zulassung durch die Stute, daß sie mit ihm zur Paarung bereit ist. Der „dritte Biß“ ist gleichzeitig die Bereitschaftserklärung bzw. Zusage des Hengstes.
Das Bild des „versitzens“ als „vergehen“ (2,15) wird von Wolfram - mit der Absicht, Hartmanns Dichtung aufs gröbste zu verspotten - auf den Romanhelden Erec selbst appliziert. Der „Pferdemann“ Erec[35] verhält sich wie ein Hengst, d.h. wie ein „ros“. Er ist ja ein „riter“, dessen „alter ego“ (Petschel-Rentsch, 1998, S. 14) das männliche Pferd ist. Eine noch direktere Bestätigung für die animalische Deutung von „biz“ kann auch das Wort „bize“ mit einem langen, betonten „i“ sein: „bize swm. Zuchteber ‘beissiges Tier’“ (Lexer 1992). Der Zuchteber ist also ebenfalls ein „bize“, ein „beißiges Tier“, das sich auf diese Weise seine Partnerin gefügig macht.
9.5 Der „dritte biz“, ein Zeichen der Bereitschaft, das „nicht galt“
Wenn man Hartmann von Aue glaubt, muß Erec ein Ausbund an sexueller Potenz gewesen sein. Sein ganzes Sinnen und Trachten war dem Text zufolge ausschließlich auf das „ verligen“ gerichtet. Insgeheim wurde ihm deswegen in der höfischen Gesellschaft, abgesehen von den angeblich bösen Folgen des „verligens" sicherlich höchste Aufmerksamkeit und großes Wohlwollen entgegengebracht. Nach dem Essen „mit sinem wîbe er dô vlôch / ze bette von den liuten“ (Er. 2949). Erecs Ansehen basierte nicht zuletzt auf dieser speziellen „Tüchtigkeit“ des „verligens“. Hartmann kann und will seine Sympathie für den Helden nicht verbergen. In Wolframs Augen ist das Erziehung zu einem „valsch geselleclichen muot“.
Ironischerweise darf man also vermuten, daß der Held „vor Kraft kaum laufen“, also eigentlich immer nur reiten konnte. Jedenfalls war er, wie das maere es nahelegt, wohl auch im Geiste nie ganz von seinem Pferd abgestiegen, selbst wenn er mit Enite im Bett lag. Dieses positive Bild eines superpotenten Helden konnte Wolfram nur mit literarischen Mitteln, d.h. mit seinem Spott, zerstören. Was alle „ganz toll“ finden, läßt sich nur schwer kritisieren, selbst wenn es wirklich nur „toll“ („Tollwut“ = beißwütiges Verhalten!) ist.
Schulze weist mit Recht darauf hin, daß die der Eheschließung Enites „folgende erotisch-personale Annäherung [...] eine wünschenswerte - vielleicht selbst mehr oder weniger erlebte - glückliche Entwicklung einer in der Wirklichkeit immerhin denkbaren, aber nicht selbstverständlichen Erfahrung“ sein könnte. Sie war jedenfalls für das Mittelalter „nicht ehetypisch“ und wird sicher „Sympathie erregt haben“ (Schulze, 1983, S. 26 f.).
Angesichts dieses von Hartmann und seinen Zuhörern als sympathisch, heroisch und ideal empfundenen Ritterbildes auf dem Hintergrund eines religiös verbrämtem Ehrenkodex’ der Ritterwelt gab es nur eine einzige Möglichkeit, Erecs unhöfisches Verhalten zu kritisieren: ihn als Pseudohelden durch eine radikale Satire (auf das „verligen“) vom „hohen Roß“ zu holen. Daß sie zugleich eine der denkbar gröbsten Beleidigungen für einen Ritter und Ritterdichter sein musste, war nicht zu vermeiden: dem Helden nämlich zu unterstellen, er sei gar nicht der Super-Sex-Held der Rittergesellschaft, sondern ein Versager. Dies sei der wahre Grund für den radikalen Abbruch der ehelichen Beziehungen und nicht das „verligen“ durch Enites Schönheit.
In den letzten Versen des Erec-Romans kommt Hartmann nochmals auf das „verligen“ zu sprechen. Er unterstreicht damit seinen Anspruch, dieses Motiv sei im literarischen Sinn ernst zu nehmen: „der künec selbe huoter / ir willen swa er mohte / und doch als im tohte / niht sam er ê phlac / dô er sich durch si verlac / wan er nâch êren lebete“ / und sô daz got im gebete [...]“ (10119-25). („Der König selber behütete ihren Willen, wo er konnte, aber doch so, wie es ihn gutdünkte, nicht so wie früher, als er sich durch sie verlag (!), denn er lebte wie ein Ehrenmann, so daß Gott ihm (das ewige Leben) schenkte.“ Wolframs radikale Satire zeigt, daß er nicht bereit ist, diesen Anspruch gelten zu lassen.
Merkwürdigerweise wird in allen Übersetzungen „verligen“ stets mit „verliegen“ übersetzt. Was es bedeutet, bleibt damit tabu: Einen Sachverhalt, der mit dem Wort „verliegen“ bezeichnet wird, gibt es in der deutschen Sprache nicht! Es handelt sich um ein Wort Hartmanns von Aue, das die Forschung kaum beeindruckt hat; jedenfalls schweigt sie sich dazu gründlich aus. Wolfram scheint das „verligen“ jedoch aufs Äußerste gereizt zu haben. Er definiert es hilfsweise als „valsch geselleclicher muot“, eine Umschreibung, die der Forschung ebenso große Schwierigkeiten macht wie das Ausgangswort selbst.
Hartmann hatte seinen Helden Erec durch die „verligen-Problematik“ in der höfischen Gesellschaft zu einem „Super-Star“ gemacht. Wenn Wolfram nun zu vermuten wagte, dieser Ritterkönig sei in Wirklichkeit zum Liebesvollzug unfähig, war das eine der schlimmsten Verdächtigungen, die es gab, die aber, wie andere Beschimpfungen bei Ritterkämpfen auf Leben und Tod, üblich zu sein schienen[36]. Genau dieser „Lanzenstich“ seiner Satire trifft den Helden Erec im literarischen Bild des „dritten Bisses“, bei dem ja etwas nicht funktioniert („daz si den dritten biz niht galt “ 2, 21). Es wurde zwar, wie man am Pferdeverhalten erkennen kann, in „drei Bissen“ bildhaft etwas angekündigt und versprochen, das dann aber nicht eingehalten werden konnte, nicht mehr „galt“: Es funktionierte nicht! War das Pferd, das den „dritten biz“ gewagt hatte, vielleicht gar kein „ros“, sondern nur ein Wallach, ein minderwertiges, verschnittenes Pferd?
Wolfram verspottet Erec in der Absicht zu sagen: nicht Enites Schönheit ist Schuld am „verligen“[37], er selbst sei dafür verantwortlich: Er sei impotent. Er „könne nicht“; zumindest nicht von morgens (Erec 2937) bis abends („also vertreip er den tac“, Erec 2935), tage- und wochenlang, wie der Schöpfer dieser Figur hatte wissen lassen.
Der „dritte biz“, das tertium comparationis, zielt damit auf Erecs Liebesverhältnis zu Enite und seine absonderliche Form der „triuwe“. Das zweideutige „verligen“, das Kern- und Kennwort Erecs, war von Hartmann im Roman wie eine Signalflagge gehißt worden. Was im „Erec“ als Vorzeichen und Versprechen zeichenhaft gesetzt ist, kann jedoch die „triuwe“ des Helden gar nicht erfüllen: nicht „entgelten“, sagt Wolfram. Die Folge ist: Weil die „triuwe“ ihren „dritten biz“ als rituelles Versprechen (beim Pferdebild und im übertragen Sinn bei Erec) nicht einhalten konnte, „vuor si“ nach Wolframs Auskunft „wütend“, d.h. „mit bremen in den walt“ (2,22).
„Mit ‘Pferdemensch’ pflegte Karl Bertau zuweilen den terminus technicus riter oder ritter für die Spezies ‘Ritter’ zu paraphrasieren [...]. Nur mit seinem Pferd ist der Ritter eine Einheit; ein Ritter ist etwas anderes als ein Mensch, der auf einem Pferd sitzt“ (Peschel-Rentsch, 1998, 12)[38]. Sein „Selbstverständnis“ ist ein anderes als das eines Menschen, der sich auf eigenen Füßen in der Welt bewegt. Der normale Mensch „versteht“ sich, d.h. geht umher, wechselt schrittweise zum Zwecke der besseren Erkenntnis den Standort, um eine Sache aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen. In diesem Sinne darf man das „Verstehen“ des aufrecht gehenden und stehenden Menschen wörtlich nehmen. Ein Ritter dagegen „versteht“ sich, was die Wahrnehmung betrifft, in einem wesentlichen Teil seiner Existenz noch „auf allen Vieren“, d.h. auf den Füßen seines Pferdes. Die typische - und in bestimmten Situationen regressive - Art seines Wahrnehmens und „Verstehens“ ist das Reiten.
„Die sonderbaren Wesen, die von ihrem alter ego, dem Pferd nicht zu trennen sind, sind männlich, Pferdemänner“ und: „Natürlich ist der Pferdeteil des Ritters, das Roß, auch männlich“ (Peschel-Rentsch, 1998, 14). Das kann sich ebenso „infantil“ wie „biestig“, unentwickelt und scheußlich (beastly, engl. Scheußlich) zugleich auswirken: als „valsch geselleclicher muot“ (2,17) oder eben als „verligen“.
Die untere Hälfte, der wichtige „besitzende“ Teil seiner personalen Einheit, ist bei Erec seine Pferdehälfte. Mit ihr identifiziert er sich. Wie man in der sogenannten „Beschreibung des Pferdes“ sehen kann, wird Erec in seiner Biographie in einem speziellen „Erlösungsprozeß“ von den Schwestern des Zwergenkönigs Guivreis zusammen mit Enite, die hier als Dreier-Gruppe die Funktion der drei Schicksalsnornen aus der germanischen Mythologie übernehmen, an dieser, seiner Pferdehälfte, saniert[39] bzw. erlöst. Sie schneidern ihm, wie man in der Pferdebeschreibung (aus dem Pferde-Stamm-Buch Wotans) sehen kann, dem „Pferdemann“ Erec, ein neues „Outfit“: eine Verhüllung mit magischer Wirkung.
Ob Hartmann die Gestalt seines Helden nicht vielleicht selbstironisch als „Pferdemensch“ literarisch ausstattete und verstanden wissen wollte, kann man nicht beurteilen. Wie seine Geschichte lehrt („fabula docet“: 10122-24), ist das jedoch nicht zu vermuten. Jedenfalls wird die Gestalt Erecs von Wolfram satirisch bewertet und als Maßstab für höfisches Sexualverhalten radikal demontiert. Die Erec-Hengst-Satire ist ein „Blattschuß“ ins mythisch verbrämte und pseudochristliche dichterische Konzept Hartmanns von Aue.
9.6 „vuor si mit bremen in den walt“ (2,22) - „Bremsen“ oder „Brummen“
Nun erfolgt also Erecs Aufbruch. Was die „bremen“ betrifft, so ist im Vers 2,22 („vuor si mit bremen in den walt“) mit Sicherheit nicht mehr von „Bremsen“ (Fliegen) die Rede, mit der etwa seine „triuwe“ in den Wald fährt. Für das Pronomen „si“ dieses Verses ist nämlich „triuwe“ das Bezugswort. Hier ist wiederum, wie bei vielen anderen Beispielen, eine andere rätselhafte Bedeutung von „bremen“ mit im Spiel. Sie bezieht sich auf Erecs verkehrte „triuwe“, seine Wut und Enttäuschung über sein eigenes Versagen: „bremen“ heißt alternativ nämlich „Brummen“ oder „brummig sein“ („bremen, stv. I, 3 brummen“, Lexer, 1992).
Wie man leicht bemerkt, handelt es sich bei „bremen“, ebenso wie bei den Rätselwörtern „versitzen“, „vergehen“, „verstehen“, „zagel“, „biz“ u.a., um je ein Wort mit zwei Bedeutungen. Durch das Stilmittel der Äquivokation wird hier das „bremen“, als lautstarkes Wüten über sein sexuelles Versagen gedeutet und mit den vorhergehenden dichterischen Bildern zu einem Komplex vereinigt.
Sind diese Äquivokationen nicht vielleicht jene stilistischen Verbindungselemente, nach denen Hempel vergeblich (s.o.) suchte? Erec zog also gemäß der Erzählung Hartmanns, mit dieser in Haß verwandelten „triuwe“, mit der zwangsweise schweigenden Enite „brummend“ („kroiierend“!) in den Wald, wo Räuber und Riesen als die andere Art von „bremen“ („Stechfliegen“) auf Beute warteten.
Für Hartmann und seinen Helden Erec ist die Satire Wolframs von Eschenbach eine große Demütigung. Sie rief Gottfried von Straßburg auf den Plan. Man darf deshalb annehmen, daß seine radikale Kritik an Hartmanns „Erec“, bei der auch Gottfried nicht geschont wurde, der Grund für dessen Polemik im „Tristan“ war.
Wenn man die Äquivokationen als zweideutige dichterische Rätselbilder akzeptiert und in einen Zusammenhang bringt, gibt sich der Text sogar schwarz auf weiß als Erec-Satire zu erkennen. Deshalb ist die vorliegende Deutung keineswegs aus der Luft gegriffen, sie orientiert sich zweifellos am Text. Zur komplexen Form der Satire gehört auch der vordergründige begriffliche Sinn des Textes als die zuerst wahrnehmbare Hülle des wirklich Gemeinten. Beleg für die o.a. Deutung ist die Stimmigkeit der dichterischen Bilder untereinander, zum vorliegenden Text und zur zeitgeschichtlichen und literarischen Situation, z.B. der literarisch-religiösen Auseinandersetzung zwischen Wolfram von Eschenbach und seinen beiden Dichterkollegen. Mit Hilfe des Stilmittels der Äquivokation werden mehrere zweideutige dichterische Bilder auf dem Hintergrund eines vordergründigen Textes miteinander zu einem rätselhaften und kritischen Gesamtbild des „Erec“ verbunden:
1. „ zagel“: Pferdeschwanz - Penis;
2. „ biz“: Pferdebiß - Geschlechtsakt;
3. „ drite biz: Artgerechtes Pferdeverhalten - Bereitschaftserklärung;
4. „driter biz“, der „ niht galt“: Bereitschaftserklärung, die widerrufen wurde;
5. „ bremen“: Bremsen (Stechfliege) - Brummen (Wutanfall).
Das „verligen“-Motiv des Erecromans wird auf diese Weise gnadenlos lächerlich gemacht, seiner magischen Wirkung (Tabuwirkung) beraubt und gleichzeitig vernichtend kritisiert. Die Analyse des Textes als Satire ist keine neue Übersetzung, sondern seine Deutung, die in der Lösung eines Rätsels besteht, das im Text enthalten ist. Was die Verwendung dieser stilistischen Mittel betrifft, so müssen in einer Übersetzung analoge Bedingungen erfüllt werden, was sehr schwer ist.
Diese Reihung der äquivoken Wörter bzw. Bilder wird eingeleitet und ergänzt durch das zentrale und wichtige „Negativbild“ des „Verligens“, das im Vers 2,15-16 durch die Reihung von versitzen-verliegen und verstehen indirekt provoziert wurde. Auch diese Verben werden durchgehend zweideutig, mit rätselhaftem Sinn, verwendet. Diese Art des Umgangs mit der Doppelbedeutung ausgewählter Wörter bzw. Würfelwörter scheint ein besonderes Stilmittel Wolframscher Prägung zu sein. Es bewirkt, daß nicht immer nur das gelten muß, was vordergründig gesagt, sondern, wie im Fall des „verligens“, dasjenige, was bewußt verschwiegen wird, eine große Bedeutung hat.
So spielt Wolfram, wie Gottfried von Straßburg es ihm vorwirft, mit Wörtern wie mit Bickeln; so z.B., wenn er das Bild des „verligens“ durch eine analoge Reihung von drei Bezugswörtern (sitzen-gehen stehen) herbeizitiert und das wirklich gemeinte als Lücke negativ markiert. Es bietet sich an, dieses Spiel mit Wörtern im Parzivalprolog mit dem Bickelspiel in Beziehung zu setzen: Die Negativform „verligen“ mit der Negativseite des Würfels „gatje“, die anderen Metaphern zu den drei Positivformen „bickel“, „butje“, „stönneke“. Eine ähnliche stilistische Wirkung haben die von Wolfram des öfteren verwendeten doppelten Verneinungen, wie in 3,6 und 3,15: Etwas wird doppelt verneint und dadurch zur positiven Aussage gesteigert: „ich enhân daz niht vür lîhtiu dinc“ (3,15) heißt also „ich halte es für geradezu verantwortungslos“.
Die Würfelmetapher Gottfrieds läßt sich ebenso auf das Bild des Eingangs, auf das Elsterngleichnis, auf die drei Namen Parzivals, die eine Person beschreiben, sogar auf das Romankonzept des „Parzival“ insgesamt anwenden. Insofern waren die Wiederauffindung und Deutung von Funktion und Form des „Bikkels“, als der zum „bickelwort“ Gottfrieds passende Gegenstand, nicht nur nützlich, sondern hilfreich.
10. Anmerkungen zum Konzept des Parzivalprologs
10.1 Kann eine Dichtung „unverantwortlich“ und eine Interpretation „unwissenschaftlich“ sein?
Für verantwortungslos hält Wolfram von Eschenbach den Versuch, den mythischen Hintergrund eines uralten germanischen Selbstverständnisses auf Kosten der christlichen Lehre durch Vermischung mit dem Heidentum neu zu beleben: „ich enhân daz niht vür lîhtiu dinc /swer in den cranken messinc / verwurket edeln rubîn“ (3,15 f.). Der „edle Rubin“ ist Sinnbild für Enite, Eva und das Christentum.
Bei der Interpretation mittelalterlicher Dichtung wird der Gesichtspunkt der Rechtmäßigkeit christlicher Lehre, wie an mehreren Beispielen gut zu belegen ist, gern vernachlässigt. Literaturwissenschaft scheint sich für Religion im Kontext von Dichtung nicht zuständig und verantwortlich zu fühlen, - und sie ist es auch nicht. Sie kann deshalb auch nicht in eigener Kompetenz entscheiden, ob ein Dichter und sein Werk „religiös“ oder christlich sind - oder nicht. Hier muß sie sich auf die Bibel bzw. die Lehre der Kirche verlassen. Wichtig ist vor allem, in welcher Form sie zum „Inhalt“ in der Kunst (Dichtung) gemacht wird. So ist m.E. die relative Unvermitteltheit christlicher Motive im „Erec“ das Kriterium für die Unglaubwürdigkeit und Unchristlichkeit des dichterischen Konzeptes. Man muß Weber danken, daß er sich im Blick auf die „gegenwärtige ‘Tristan’-Forschung“ unter Bezug auf „ die Klärung von Einzelfragen und die Lösung von Teilproblemen“ in der Mittelalterforschung zur Wissenschaftlichkeit von neueren Arbeiten so geäußert hat:„ Nur dann müßte man wohl ihre Position als zutiefst unwissenschaftlich, weil dogmatisch-voreingenommen bezeichnen, wenn sie von dem (freilich nicht ausgesprochenen! sic.!) Standpunkt ausgehen, daß nicht sein könne, was nicht sein dürfe, nämlich beispielsweise die Pervertierung christlicher Grundbegriffe durch den Tristan-Dichter“ (Weber, 1962, S. 72 kursiv gesetzt d.V.). Eine Pervertierung der christlichen Lehre läßt sich eindeutig auch für die Dichtung Hartmanns von Aue, besonders für den „Erec“ ausmachen.
Man kann, wissenschaftlich korrekt, wie Lachmann es mit dem „Tristan“ Gottfrieds von Straßburg tat, „einerseits die Hochschätzung und das Lob von Gottfrieds Kunst, der ästhetischen Seite seines Werkes, andererseits die Abwertung im Gehaltlichen aufgrund der vermeintlichen Unsittlichkeit, die Verwerfung der ethischen Seite“ konstatieren (Weber, 1962, S. 46). Ähnlich lautet ein Befund von Georg Gottfried Gervinus, der z.B. von „Gottfrieds ‘unvergleichlicher Dichtergabe’ spricht, dann aber sagt: „Was von nun an im Tristan folgt, ist nicht geeignet, etwas anderes als unseren Abscheu zu wecken“ (Weber, 1962, S. 46). Einem solchen Wertungsschema liegt jedoch eine inadäquate, additive Vorstellung von Einheit der Kunst zugrunde, wie man sie nicht einmal aus methodischen Gründen (als Inhalt plus Form) zulassen darf. Weber bemerkt mit Recht: „Wie eine solche Auffassung das Wesen von Gottfrieds Dichtung verfehlt, ist längst erkannt.“ Mit dem Hinweis darauf und der Bemerkung, daß das „Tristan-Problem zutiefst kein ethisches, sondern ein metaphysisches ist“, wird allerdings über die Dichtung als Kunstform noch nichts gesagt. Daß an der Kunst etwas „wesentlich“ sein soll, läßt sich nicht wahrnehmen und belegen, sondern nur behaupten. Nur was sinnfällig und wirkmächtig erscheint, ist als Zeichen künstlerisch „bedeutsam“. Folgerichtig schließt Weber: „Sodann dürfte es für die gegenwärtige Forschungslage charakteristisch sein, daß sich die Stimmen mehren, die eine verstärkte Betrachtung des Tristan als Kunstwerk fordern“ (Weber, 1962, S. 73). Was Weber hier exemplarisch für die Dichtung Gottfrieds von Straßburg fordert, gilt ebenso für die Dichtung seines Zeitgenossen Hartmann von Aue , insbesondere aber auch für Wolfram von Eschenbach, wenn nicht für die mittelalterliche Dichtung überhaupt.
Um zu erkennen, daß der „Erec“ im Grunde eine Verhöhnung der christlichen Lehre und des Glaubens und nicht deren Verherrlichung ist, muß man kein praktizierender Christ oder Theologe sein. Von einer „Christlichkeit“ seiner Konzeption, wie sie von Hartmann selbst beansprucht und von Vertretern der Germanistik immer noch behauptet wird, ist m.E. nichts zu erkennen. Aus einer überwiegend inhaltlichen Wahrnehmung des Hartmanntextes ergab sich jedenfalls die Möglichkeit zu einer kritischen Analyse des Hauptmotivs im Erecroman. Die Gegenmotive des Parzivalprologs entlarven in der Erec-Satire deren konzeptionelle Widersprüchlichkeit.
10.2 Wolfram von Eschenbach als „Apologet“ des Christentums
Die dichterischen Bilder in ihrer Aneinanderreihung lassen in den o.a. Beispielen der Erec-Satire erkennen, daß es sich auf der literarischen Ebene des 12. Jahrhunderts primär um eine inhaltliche, moralische und religiöse Auseinandersetzung zwischen den bekannten Dichtern Gottfried von Straßburg, Hartmann von Aue und Wolfram von Eschenbach handelte. Die dubiose Moral, die sich hinter der Frauengestalt „Isolde“ im „Tristan“ verbirgt, scheint Wolfram nicht ganz so gefährlich gewesen zu sein, wie die Perversion der christlichen Lehre im Gewande der Dichtung Hartmanns. Ihr widerspricht er mit der ganzen Kraft seiner dichterischen Bilder, denen man - literarisch, d.h. durch Form vermittelt - eine apologetische Funktion nicht absprechen kann. Das Elsterngleichnis , die Erec-Satire und Enitekritik sind solche Vermittlungen. Der Kampf gegen die falschen Propheten im eigenen Lager mußte deshalb in dieser Form ausgetragen werden, weil auch deren „Häresien“ in dichterisch wirkungsvoller Form erschienen waren. Für die höfische Gesellschaft bzw. die Christenheit waren sie im moralischen und religiösen Sinne äußerst gefährlich. Deshalb werden sie von Wolfram gnadenlos und mit allen ihm zur Verfügung stehenden dichterischen Mitteln - und nicht mit religiösen oder theologischen Argumenten - bekämpft.
In diesem Literaturstreit ging es Wolfram nicht darum, einen Geltungsanspruch im Kreise seiner Dichterkollegen anzumelden, wie dies von Gottfried unterstellt wurde, sondern darum, den Wahrheitsanspruch des christlichen bzw. biblischen Glaubens gegenüber der Dichtung Hartmanns mit ihren Verfälschungen zu verteidigen. Ihre verheerende moralische Wirkung konnte nur mit beißendem Spott neutralisiert werden. Dem gegen Wolfram gerichteten Literaturexkurs im „Tristan“, der am Hofe sicherlich wahrgenommen und diskutiert wurde, entspricht auf der Gegenseite gewiß das dröhnende Gelächter über die Verspottung Erecs im Parzivalprolog. Ein Echo dieses religiösen und weltanschaulichen Streites kann man achthundert Jahre später noch vernehmen, wenn man den in Bilderrätseln versteckten abgrundtiefen Spott erkennt.
Mit dem Hinweis darauf, daß Wolfram es als seine Aufgabe ansah, den Einfluß germanisch/heidnischer Mythen in der ersten Artusdichtung deutscher Sprache auf die höfische Gesellschaft zu neutralisieren, ist auch der religions- und geistesgeschichtliche Standort Wolframs als „Apologet “ des christlichen Glaubens klar erkennbar geworden. Trotz seines Einsatzes für die Wahrheit der christlichen Lehre kann man Wolframs Werk nicht als religiöse Dichtung bezeichnen. Er führte seinen Kampf ausschließlich mit literarischen Mitteln. Hartmanns Dichtung dagegen stellt sich durch unvermittelte Verwendung religiöser Motive als ein Beispiel für höfisches Neuheidentum des 12. Jahrhunderts dar. Aus der „Summe“, die Hartmann in den letzten Versen seines „Erec“ zieht, erkennt man, daß er sich selbst als den Schöpfer eines neuen „Ehren-Kodex“ der Ritterschaft mit religiösem Anspruch versteht: Weil Erec sich als „Ehrenmann“ erwiesen hatte („denn er lebte nach dem Gebot der Ehre und so, daß Gott mit väterlicher Huld nach der weltlichen Krone ihm und seiner Frau die Krone des ewigen Lebens schenkte“ 10124 ff.), wurde ihm angeblich von Gott die „höchste Ehre“ zuteil, das ewige Leben. Das hat m.W. mit Christentum wenig zu tun!
Stoffgeschichtlich geht es bei ihm nicht mehr nur um keltisch-heidnische Motive der Artusdichtung, sondern um christliche Motive, die bis zur Unkenntlichkeit verdreht, um mit Wolfram zu sprechen: „verwurket“ sind. Für die Verkündung seiner eher heidnischen Lehre beansprucht Hartmann den Status einer Offenbarungs-Literatur. Darin liegt die große Gefahr. Er degradiert die „Bibel“ damit zur bloßen Ausstattung für seine profanen, wenn auch dichterischen Zwecke. Wer sie einerseits parodiert und dennoch ihre formale Geltung beansprucht, „offenbarte“ Wahrheit zu sein, ist Häretiker. Hartmann beutet - bewußt oder unbewußt - zumindest die Hl. Schrift in diesem Sinne für das Ansehen und die Geltung seiner Dichtung aus.
Wolfram setzt Hartmanns literarische Parodie von Glaubensmotiven des Alten und Neuen Testamentes durch das Mittel der Travestie (durch die formale Umkehr des Hartmannschen Geltungsanspruch in Lächerlichkeit) außer Gefecht. Dabei tauchen bei ihm selbst auch christliche Motive in bestimmter Verkleidung (als fiktive Entsprechungen) auf. Der Gral ist in diesem Sinne das zweideutige Motiv schlechthin. Es kann mißverstanden werden, weil seine dichterische Form nicht als Ergebnis einer künstlerischen Metamorphose wahrgenommen wird. Wenn Hartmann also im Rahmen seiner aventiure die Schöpfungsgeschichte immer wieder zitiert und parodiert, nicht zuletzt im Hinblick auf die Annahme, daß der Sündenfall des ersten Menschenpaares eine erste, noch verbotene bzw. eigenmächtig vollzogene Liebesvereinigung gewesen sein könnte, so entlarvt Wolfram den formalen Anspruch Hartmanns, durch solche flachen Analogiebildungen auch als Dichtung „wahr“ zu sein, dadurch, daß er sie travestiert und damit ihren formalen Geltungsanspruch lächerlich macht.
Die Frage Bumkes (1997, S. 136), „welchen Erkenntnisgewinn die Zuhörer aus dieser verwirrenden Bildersprache ziehen konnten“, ist damit im Sinne Wolframs annähernd beantwortet. Der Parzivalprolog ist ein Vorgefecht bzw. eine Verstehensvorübung für den Parzivalroman selbst als Einheit von Prolog und Roman. In ihm geht es um die entscheidende Auseinandersetzung in der als Biographie konzipierten Dichtung eines trinitarischen Menschenbildes: „Par-zi-val“, ein Leben zwischen Glauben und Unglauben (zwischen Christentum und Islam).- Was auf der Weltbühne des Gesamtromans geschieht, wird schon im Vorspiel, d.h. im Prolog, in der Auseinandersetzung mit den falschen Propheten im eigenen Haus exemplarisch vorgeführt.
10.3 Zuordnung des eigenen Interpretationsversuches und Zusammenfassung
Identifizierung und Interpretation der Erec-Satire und Enitekritik im Parzivalprolog setzen neben der Kenntnis der zeitgenösischen Literatur als Bedingung auch die Kenntnis der christlichen Lehre voraus. Wer die Aussagen Hartmanns nicht als Perversionen christlicher Lehre erkennt, wird z.B. im Parivalprolog nicht nach einer Entgegnung suchen und auch die wichtigen dichterischen Bilder nicht als Kritiken erkennen.
Die Voraussetzung für die Entdeckung dieser Kritiken war die Klärung des Bickelwortvorwurfs aus dem Literaturstreit zwischen Gottfried und Wolfram bzw. Hartmann von Aue. Sie gelang mit Hilfe der wiederentdeckten „Bickel“, jener Gegenstände, die durch ihre Form und Funktion bedingt zur Metapher Gottfrieds wurden, mit der er Wolframs Sprache kritisierte, aber auch die Polarität als wesentliches Strukturmerkmal der dichterischen Bilder Wolframs erkennbar werden ließen.
Daß sich die großen Dichtungen des 12. Jahrhunderts mit dem „Thema Nr. 1“ aller Zeiten, nämlich der menschlichen Sexualität, befassen, hat einen besonderen Grund, der für den Prolog und noch mehr für den Parzivalroman selbst von Bedeutung ist: Die menschliche Sexualität gehörte, wie in fast allen großen Religionen, so auch im Christentum, zu einem ursprünglich religiös sanktionierten Bereich. Heute erinnert sich kaum noch jemand daran. Der höfischen Gesellschaft war dies bekannt, denn sie hatte aufgrund der „Väterlehre“, die zu ihrem Bildungsprogramm gehörte, ein sehr differenziertes Verhältnis zu menschlicher Sexualität: „Zu einem ganz klaren Verständnis der Begriffe sei nochmals darauf hingewiesen, daß Adam, der erste Mensch und Gnadenmensch, die heiligmachende Gnade nicht als ein persönliches Geschenk von Gott erhalten hatte, sondern als ein Erbgut, das er zugleich mit dem natürlichen Leben in der geschlechtlichen Zeugung weiter vererben sollte. Seine Kinder sollten als Kinder Gottes geboren werden.“ (Sylvester Birngruber, 1955, 146). - Die Liebesvereinigung von Mann und Frau im Urstand der Gnade wäre demnach, d.h. nach Lehre der Kirche, als ein Gnadenakt von Gott vorgesehen gewesen, insofern darin auch göttliches Leben weitergegeben werden sollte und zwar in der Fülle paradiesischer Erkenntnis, die - nach Lehre der Kirche - im „Paradies“ noch gegeben war.
Möglicherweise war diese Machtvollkommenheit das Urmotiv des Menschen für seine Hybris, die ihn auf die Worte des Verführers hören ließ: „Ihr werdet sein wie Gott“. Jedenfalls wurde das Thema Sexualität im 12. Jahrhundert weitgehend auch unter einem solchen heilsgeschichtlichen Aspekt relativ unbefangen diskutiert. Diese Aussagen können etwas von der ursprünglichen Würde und dem Anspruchsniveau der menschlichen Sexualität erahnen lassen.
Eine Originalstimme aus dem 12. Jahrhunderts unterstreicht die Bedeutung des Themas: „Was ist geeigneter“ sagt der heilige Anselmus von Canterbury, „zum Beweise der Größe der göttlichen Güte und der Fülle der Gnade, die er Adam gewährte, als der Umstand, daß, wie Adam das Sein seiner Nachkommen in seiner Gewalt hatte, daß sie das, was er von Natur aus war, durch ihn sein sollten, es so auch von der Freiheit seines Willens abhing, sie so aus sich hervorgehen zu lassen, wie er selbst war, reich an Gerechtigkeit und Glückseligkeit. Das also war ihm verliehen. Weil er nun, auf den Gipfel einer so großen Gnade gestellt, die Güter, welche er empfangen, um sie für sich und seine Nachkommen zu bewahren, freiwillig preisgab: deshalb verloren die Kinder, was ihr Vater, während er es bewahrend ihnen hätte geben können, nicht bewahrend ihnen raubte.“ (Anselm von Canterbury, 1033-1109, Kirchenlehrer und großer Theologe des 11. Jahrhunderts (zitiert nach Scheeben, 1958, S. 254).
Hier wird die Sexualität des Menschen in einem Horizont betrachtet, der im christlichen Bewußtsein des 20. Jahrhunderts restlos verloren gegangen ist, im Gegensatz zum 12. Jahrhundert. Wie oben angedeutet, gehörte die Väterlehre, in der solches Wissen vermittelt wurde, zum Standardwissen von Klerikern und gebildeten Laien der höfischen Gesellschaft. Aus dieser Perspektive muß man auch die radikale Absage und Empörung Wolframs über die zeitgenössische Dichtung Hartmanns von Aue und Gottfrieds von Straßburg verstehen. Ohne das religiöse Hintergrundwissen aus der Väterlehre konnte man als Laie des 12. Jahrhunderts weder den „Erec“ noch den Parzivalroman als künstlerische Ganzheit überhaupt wahrnehmen und begreifen. Diese Bedingungen gelten immer noch, auch für das Publikum unseres Jahrhunderts. Man ist sich dessen nur nicht bewußt.
Das Verständnis von Liebe und Sexualität auf geschichtlichem und heilsgeschichtlichem Hintergrund spielt nicht nur im Prolog, sondern für den gesamten „Parzival“ die entscheidende Rolle. Ein trinitarisch konzipiertes, fiktives Menschenbild ist das eigentliche Thema des Romans.
Literaturverzeichnis
I. Quellen
Augustinus: „Bekenntnisse“, übersetzt von Joseph Bernhart, Nachwort und Anmerk. von Hans Urs von Balthasar, Frankfurt 1955.
Augustinus: „Die Gottesbürgerschaft“, De Civitate, hrsg. von Hans Urs von Balthasar, Frankfurt 1960.
Die Bibel, Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes, vollständige deutsche Ausgabe, Herder Bücherei, Freiburg 1965.
Gottfried von Straßburg: „Tristan und Isolde“, Originaltext (nach F. Ranke) mit einer Versübersetzung und Einleitung von Wolfgang Spiewok, in: Wodan, Recherches en litterature medievale, ed. par Danielle Buschinger et Wolfgang Spiewok Vol. 9. 1991.
Hartmann von Aue: „Erec“, Mittelhochdeutscher Text und Übertragung von Thomas Cramer, Fischer Taschenbuch Verlag 6017, Originalausgabe 1972, Frankfurt am Main.
Kant, Immanuel: „Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik“, hrsg. von Karl Vorländer in 5. Aufl. 1913, unveränderter Nachdruck in: Philosophische Bibliothek Bd. 40, Berlin 1965.
Koran, vollständige Ausgabe, Mit einem Vorwort von Thomas Schweer, 6. Auflage, Heyne Sachbuch, München 1992.
Thomas von Aquin: „Summe gegen die Heiden“, hrsg. und übersetzt von Karl Albert und Paulus Engelhardt unter Mitarbeit von Leo Dümpelmann, 1. Bd. in: Texte zur Forschung Bd. 15, Darmstadt 1974.
Wolfram von Eschenbach: „Parzival“, übersetzt von Friedrich Knorr und Reinhard Fink, Jena 1940.
Wolfram von Eschenbach: „Parzival“, Studienausgabe, hrsg. von Karl Lachmann, Berlin 1965 (nach der Ausgabe ‘Wolfram von Eschenbach’. 6. Ausgabe von Karl Lachmann, Berlin und Leipzig 1926.
Wolfram von Eschenbach: „Parzival“, Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch, Bd.1 und 2, übersetzt von Wolfgang Spiewok Stuttgart 1981.
Wolfram von Eschenbach: „Parzival Titurel Tagelieder“, Cgm 19 der Bayerischen Staatsbibliothek München, einmalige Auflage von 850 Exemplaren, Transkription der Texte in einem Kommentarband von Gerhard Aust, Otfried Ehrismann und Heinz Engels, mit einem Beitrag zur Geschichte der Handschrift von Fridolin Dreßler, Faksimileband, Anfertigung der Ektachrome: Hirmer Verlag München. Reproduktion: Graphische Kunstanstalten E. Sautter, Druck: Buchdruckerei Holzer, Buchbinderei: Richard Mayer, Verlag Müller und Schindler, Stuttgart 1970.
Wolfram von Eschenbach: „Willehalm“, Nach der Handschrift 857 der Stiftsbibliothek St. Gallen, hrsg. von Joachim Heinzle, Tübingen 1994.
Wolframs von Eschenbach Parzival und Titurel. Hg. und erklärt von Ernst Martin, Bd. II: Kommentar (Germanistische Handbibliothek 9,2), Halle 1903.
Die Literaturangaben aus dem Parzivalroman erfolgen mit je einer arabischen Ziffer für das Kapitel und den Vers. Beim Erecroman wird die Abkürzung „Er.“ der Nummer des Verses vorangestellt. Analog wird der „Tristan“ als „Tr.“ und der „Willehalm“ als „Wh“ abgekürzt und mit der zugehörigen Versnummer zitiert.
Die Quellenangaben erfolgen nach dem sogenannten „Havard-System“: Verfasser, Erscheinungsjahr und Seitenzahl in runden Klammern im laufenden Text. Sie werden durch einen „Vollbeleg“ im Literaturverzeichnis ergänzt: Nachname und Vorname der Autorin bzw. des Autors und Titel des Werkes. Das Erscheinungsjahr (in Klammern) wird dem Namen des Autors bzw. der Autorin direkt zugeordnet, damit „Kurzbelege“ aus dem Text schneller zuzuordnen sind.
II. Literatur
Ackermann-Arlt, Beate (1990): „Das Pferd und seine epische Funktion im mittelhochdeutschen ‘Prosa-Lancelot’“, Berlin - New York, zugl. Phil. Diss. Münster 1986, in: Arbeiten zur Frühmittelalterforschung, Schriftenreihe des Institutes für Frühmittelalterforschung der Universität Münster Bd.19, hrsg. von Karl Hauck.
Archäologischer Park Xanten / Regionalmuseum Xanten, Hrsg (1994): So spielten die Alten Römer, Römische Spiele im Archäologischen Park Xanten, Texte von Anita Rieche, Zeichnungen und Layout von Jörn Kraft, 3. veränderte Auflage 1994.
Beckmann, Max (1965): Sichtbares und Unsichtbares, hrsg. von Peter Beckmann und Peter Selze, Stuttgart.
Birngruber, Sylvester (1955): Laiendogmatik, Graz.
Bohnen, Klaus (1976): Wolframs Parzivalprolog. Perspektiven und Aspekte der Forschung 1835-1975, Kopenhagen.
Brall, Helmut (1983): „ Diz vliegende bispel. Zur Programmatik und kommunikativen Funktion des Parzivalprologes“, Euphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte 77, S. 1-39.
Brunner, Horst (1993): „Hartmann von Aue: Erec und Iwein“, Interpretationen Mittelhochdeutscher Romane und Heldenepen, Reclam Taschenbuch 8914, Stuttgart, S. 97-126.
Buck, Günther (1969): Lernen und Erfahrung, 2. Aufl. Stuttgart.
Bumke, Joachim (1970): Die Wolfram von Eschenbach Forschung seit 1945, Bericht und Bibliographie, München.
Bumke, Joachim (1986): Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, 2 Bd. München.
Bumke, Joachim (1991): „Parzival und Feirefiz - Priester Johannes - Loherangrin, Der offene Schluß des Parzival von Wolfram von Eschenbach“, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 65, S. 236-264, Stuttgart.
Bumke, Joachim (1997): Wolfram von Eschenbach, 7. völlig neu bearbeitete Auflage, Stuttgart.
Burdach, Konrad (1938): Der Gral, Forschungen über seinen Ursprung und seinen Zusammenhang mit der Longinuslegende. Mit einem Vorwort zum Neudruck von Johannes Rathofer, Darmstadt 1974. Erstdruck Stuttgart1938 (Kohlhammer).
Casper, Bernhard (1990): „Der Sprache Tun, Beobachtungen zu den letzten Büchern der Confessiones Augustins“, in: Das Subjekt der Dichtung (Festschrift für Gerhard Kaiser), hg. von Gerhard Buhr - Friedrich A. Kittler - Horst Turk, Würzburg, S. 31-41.
Curschmann, Michael (1990): „Der Berner ‘Parzival’ und seine Bilder“, in: Wolfram-Studien XII, Probleme der Parzival-Philologie, Marburger Kolloqium 1990, Berlin, S. 153-171.
Curtius, Ernst Robert (1954): Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, 2. Aufl. 1954, 1. Aufl. Bern 1948.
Czerwinski, Peter (1989): Der Glanz der Abstraktion, Frühe Formen der Reflexivität im Mittelalter, Exempel einer Geschichte der Wahrnehmung, Frankfurt - New York.
Elders, Johanna (1938): „Das Knöchelspiel am Niederrhein, Volkskundliches und Etymologisches“, in: Album Philologum, Festschrift für Theo Baader, Nymwegen, S. 185-192.
Ertzdorff, Xenia von (1996): 1. „Das Herz in der lateinisch-theologischen und frühen volkssprachlichen religiösen Literatur“, 2. „Die Dame im Herzen und das Herz bei der Dame, zur Verwendung des Begriffs ‘Herz’ in der höfischen Liebeslyrik des 12. Und 13. Jahrhunderts“, beide Beiträge in: Spiel der Interpretation, Göppinger Arbeiten zur Germanistik 597, Göppingen, S. 21-110.
Fisher, Rodney (1975): „Erecs Schuld und Enitens Unschuld bei Hartmann“, Euphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte 69, S. 160-174, Heidelberg.
Gadamer, Hans-Georg (1990): „Hermeneutik I Wahrheit und Methode“, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen.
Ganz, Peter (1967): „Polemisiert Gottfried gegen Wolfram?“ (Zu Tristan Z. 4638f.). Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 88, S. 69-85, Tübingen.
Ganz, Peter (1977): „Der Begriff des Höfischen bei den Germanisten“, Wolfram-Studien 4, Veröffentlichungen der Wolfram-von-Eschenbach-Gesellschaft, Berlin, S. 16-32.
Ganz, Peter (1979): „Vom Nichtverstehen mittelhochdeutscher Literatur“, Wolfram-Studien V, hg. von Werner Schröder, Veröffentlichungen der Wolfram-von-Eschenbach-Gesellschaft, Berlin, S. 136-153.
Gardet, Louis (1961): Der Islam, Heidelberg; Titel der französischen Ausgabe: Connaitre L’ Islam, Paris 1958.
Geil, Gerhild (1973): Gottfried von Straßburg und Wolfram von Eschenbach als literarische Antipoden, Köln.
Genzmer, Felix (1989): Der Heliand und die Bruchstücke der Genesis, Anmerkungen und Nachwort von Bernhard Sowinski, Stuttgart, Reclam.
Green, Denis Howard (1978): „Oral poetry and written composition, (An aspekt of the feud between Gottfried and Wolfram)“, in: Approaches to Wolfram von Eschenbach, Mikrokosmos, Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung 5, S. 163-181.
Haage, Bernhard (1998): „Enite im Carotensischen Kosmos, Zu Hartmann von Aue, Erec, 7275- 7766“, in: Ir sult sprechen willekomen, Grenzenlose Mediävistik (Festschrift für Helmut Birkhahn zum 60. Geburtstag), hg. von Christa Tuczay, Bern - Berlin - New York - Paris - Wien, S. 40-48.
Hagemann, Ludwig (1985): „Die erste lateinische Koranübersetzung - Mittel zur Verständigung zwischen Christen und Muslimen im Mittelalter?“, in: Miscellanea Mediaevalia, Veröffentlichungen des Thomas-Institutes der Universität zu Köln, S. 45-58.
Harms, Wolfgang (1988): „Text und Bild, Bild und Text“, DFG- Symposion 1988, in: Germanistische Symposien, Berichtsbände, im Auftrag der Germanistischen Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft und in Verbindung mit der ‘Deutschen Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte’ XI, Stuttgart 1990.
Haug, Walter (1971): „Die Symbolstruktur des höfischen Epos und ihre Auflösung bei Wolfram von Eschenbach“, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 45, S. 668-705, Stuttgart.
Haug, Walter (1972): „Parzivals Zwivel und Willehalms Zorn, Zu Wolframs Wende vom höfischen Roman zur Chanson de geste“, Wolfram-Studien III, Schweinfurter Kolloqium 1972, hg. von Werner Schröder, in: Veröffentlichungen der Wolfram von Eschenbach Gesellschaft, Berlin, S. 217-231.
Haug, Walter (1992): Literaturtheorie im deutschen Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Eine Einführung, 2. überarbeitete und erweiterte Aufl. Darmstadt, S. 155-178.
Hausner, Renate (1974): „ bickelworte“ [sic!] (Zu Gottfrieds Tristan V. 4641), in: Euphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte 68, S. 219-220, Heidelberg.
Heinevetter, Franz (1912): Würfel- und Buchstabenorakel in Griechenland und Kleinasien, Diss. Breslau.
Heinzle, Joachim, Hrsg. (1994): Wolfram von Eschenbach „Willehalm“, Nach der Handschrift 857 der Stiftsbibliothek St. Gallen, Tübingen.
Heinzle, Joachim (1990): „Die Entdeckung der Fiktionalität“. Zu Walter Haugs ‘Literaturtheorie im deutschen Mittelalter’, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 112, (Paul und Braune: Beiträge) S. 55-80, Tübingen.
Hempel, Heinrich (1951): „Der zwîvel bei Wolfram und anderweit“, in: Erbe der Vergangenheit, Germanistische Beiträge (Festgabe für Karl Helm zum 80. Geburtstage), Tübingen, S. 157-187.
Hempel, Heinrich (1951/52): „Der Eingang von Wolframs Parzival“, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 83, S. 162-179, Wiesbaden, Berlin.
Hoffman, Werner (1963): „Worterklärungen“ in: Gottfried Weber, Wolfram von Eschenbach Parzival, Stuttgart.
Jolles, Andre (1930): Einfache Formen. Legende, Sage, Mythe, Rätsel,Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz; Halle.
Kläden, C. (1843): Ueber den Eingang zu Eschenbachs Parzival, Germania 5 (1843), Leipzig, S. 222-246.
Knecht, Peter (1993): „Wolfram von Eschenbach, Parzival, aus dem Mittelhochdeutschen von Peter Knecht. Mit einem Brief des Übersetzers an den Lektor“, in: Die andere Bibliothek 100, Nördlingen.
Kühn, Dieter (1991): Der Parzival des Wolfram von Eschenbach, Insel Taschenbuch Nr. 1328, 1. Aufl. Frankfurt.
Kühn, Dieter (1994): Tristan und Isolde des Gottfried von Straßburg, Insel Taschenbuch Nr.1621, Frankfurt.
Kuhn, Hugo (1973): „Erec“, Wege der Forschung CCCLIX, in: Festschrift für Kluckhohn und Schneider Darmstadt 1948, S. 122-150.
Lachmann, Karl (Hrsg. 1891): Wolfram von Eschenbach, 5. Aufl., Berlin.
Lahrkamp, Helmut (1997): Dreißigjähriger Krieg - Westfälischer Frieden, Münster.
Lauffer, Otto (1934): Land und Leute in Niederdeutschland, Berlin und Leipzig.
Lehnhoff, W. (1922): „Fangsteinspiele“, in: Westfälisches Spielbuch, Dortmund, S. 87-96.
Lindemann, Dorothea; Volkmann, Berndt; Wegera, Klaus-Peter (1995): „bickelwort und wildiu maere“ (Festschrift für Eberhard Nellmann zum 65. Geburtstag), Göppinger Arbeiten zur Germanistik, hrsg. von Ulrich Müller, Franz Hundsnurscher und Cornelius Sommer, Göppingen.
Lindsay, Wallace M. Hrsg (1911): Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum sive originum, 2. Bd. Oxford 1911.
Martin, Ernst, Hrsg. (1976): Wolframs von Eschenbach Parzival und Titurel, hg. und erklärt von Ernst Martin, Bd. II: Kommentar, 1. Aufl., Halle 1903, Neuaufl., Darmstadt.
Meier, Christel (1990): „Malerei des Unsichtbaren, Über den Zusammenhang von Erkenntnistheorie und Bildstruktur im Mittelalter“, in: Text und Bild, Bild und Text, DFG Symposion, Berichtsband 1988, Stuttgart, S. 35-65.
Menhardt, Hermann (1955/56): „Wolframs `Selbstverteidigung´ und die Einleitung zum Parzival“, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 86, S. 237-240, Wiesbaden.
Mettke, Heinz, (1983): Mittelhochdeutsche Grammatik, 5. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Leipzig.
Mohr, Wolfgang (1958): „Parzival und Gawan“, Euphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte 52, S. 1-22, Heidelberg.
Mohr, Wolfgang (1977): Wolfram von Eschenbach, Parzival, übersetzt von Wolfgang Mohr, in: Göppinger Arbeiten zur Germanistik 200, hg. von Ulrich Müller, Franz Hundsnurscher, Cornelius Sommer, Göppingen.
Mohr, Wolfgang (1979): „Zwei Kleinigkeiten zu Wolfram“, Göppinger Arbeiten zur Germanistik 275, S. 228, Göppingen.
Muschg, Adolf (1993): Der Rote Ritter, Frankfurt.
Nellmann, Eberhard (1971): „Die Komposition des Parzival, Versuch einer neuen Gliederung“, Wirkendes Wort 21, S. 389-402, Düsseldorf.
Nellmann, Eberhard (1988): Wolfram und Kyot als vindaere wilder maere. Überlegungen zu ‘Tristan’ 4619-88 und ‘Parzival’ 453,1-17, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 117, S. 31-67, Wiebaden.
Nellmann, Eberhard (1994): „Dichtung ein Würfelspiel“, Zu `Parzival' 2,13 und `Tristan' 4639, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 123, S. 458-466, Wiesbaden.
Peschel-Rentsch, Dietmar (1998): Pferdemänner, Sieben Essays über Sozialisation und ihre Wirkungen in mittelalterlicher Literatur, Erlangen und Jena.
Peters, Ursula (1975): „Artusroman und Fürstenhof, Darstellung und Kritik neuerer sozialgeschichtlicher Untersuchungen zu Hartmanns Erec“, Euphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte 69, S. 175-196, Heidelberg.
Pongs, Hermann (1969): Das Bild in der Dichtung, III. Bd.: Der symbolische Kosmos in der Dichtung, Marburg.
Pretzel, Ulrich (1954): „Die Übersetzungen von Wolframs Parzival“, Der Deutschunterricht 6, S. 41-64, Velber (u. Klettverlag Stuttgart).
Rahner, Karl (1957): „Schriften zur Theologie“ Bd. III, 2. Auflage, Einsiedeln - Zürich - Köln.
Rathofer, Johannes (1962): Der Heliand, Theologischer Sinn als tektonische Form, Vorbereitung und Grundlegung der Interpretation, Köln-Graz.
Rathofer, Johannes (Hrsg.) (1974): Der Gral, Forschungen über seinen Ursprung und seinen Zusammenhang mit der Longinuslegende, von Konrad Burdach, (Erstdruck Stuttgart, 1938), Neudruck Darmstadt.
Richter, W. (1887): Die Spiele der Griechen und Römer (Kulturbilder aus dem klassischen Altertume II), Leipzig, S. 71-86.
Rohlfs, Gerhard (1963): Antikes Knöchelspiel im einstigen Großgriechenland, eine vergleichende historisch-liguistische Studie, Tübingen.
Rupp, Heinz (1954): „Forschungsbericht zur staufischen Dichtung II“, Der Deutschunterricht 6, H. 1, S. 108-113, Velber (u. Klettverlag Stuttgart).
Rupp, Heinz (1961): „Wolframs Parzival-Prolog“, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 82. Sonderband (Elisabeth Karg-Gasterstädt zum 75. Geburtstag gewidmet), Halle, S. 29-45.
San Marte (A. Schulz) (1862): Die Gegensätze des heiligen Grales und von Ritters Orden, Halle.
San-Marte (1836): Parzival, Rittergedicht, von Wolfram von Eschenbach. Aus dem Mittelhochdeutschen zum ersten Male übersetzt von San Marte, Magdeburg.
Scheeben, Matthias Joseph (1958): „Die Mysterien des Christentums“, 3. Aufl., Freiburg (Herder).
Schirok, Bernd (1990): „swer mit disen schanzen allen kann, an dem hat witze wol getan“, Kölner Germanistische Studien 30, Architectura poetica (Festschrift für Johannes Rathofer), Köln, S. 119-145.
Schmid, Elisabeth (1978): „Semantische Illusionen, Zu einigen Namen bei Wolfram von Eschenbach“, Germanisch Romanische Monatsschrift, Neue Folge 28, S. 291-309, Heidelberg.
Schneider, Hermann (1947): „Parzival-Studien“. (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl. Jg. 1944/1946, Nr. 4, München, S. 6-31.
Schröder, Walter Johannes (1951/52): „Der Prolog von Wolframs Parzival“, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 83, S. 130-143, Wiesbaden.
Schröder, Walter Johannes (1952): „Der dichterische Plan des Parzivalromans“, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 74, S. 160-453, Halle, Tübingen.
Schröder, Walter J. (1958): „Vindaere wilder maere, Zum Literaturstreit zwischen Gottfried und Wolfram“, Beitr. zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 80, S. 269-287, Halle, Tübingen.
Schröder, Walter J. (1959): „Horizontale und vertikale Struktur in Chretien und Wolfram“, Wirkendes Wort 9, S. 321-326, Düsseldorf.
Schröder, Walter J. (1975): „Der Toleranzgedanke und der Begriff der ‘Gotteskindschaft’ in Wolframs ‘Willehalm’“ in: Festschrift für Karl Bischoff zum 70. Geburtstag, hg. von Günter Bellmann, Günter Eifler, Wolfgang Kleiber, Köln - Wien, S. 401-415.
Schröder, Werner (1974): „Positionen der Wolfram-Forschung auf dem Schweinfurter Colloquium 1972“, Euphorion, Zeitschrift für Literaturgechichte 68, S. 81-87, Heidelberg.
Schröder, Werner (1979): „Der tragische Roman von Willehalm und Gyburg: zur Gattungsbestimmung des Spätwerks Wolframs von Eschenbach“, Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 5, Wiesbaden, S. 3-20.
Schröder, Werner (1980): „Wolfram von Eschenbach als Dissertationsthema“, Wolfram-Studien VI, Veröffentlichungen der Wolfram von Eschenbach Gesellschaft, Berlin, S. 181-200.
Schröder, Werner (1989): „ kunst und sin bei Wolfram von Eschenbach“, in: Werner Schröder: Wolfram von Eschenbach, Spuren, Werke, Wirkungen, Kleinere Schriften 1956-1987 Bd. I, Stuttgart, S.119-243.
Schröder, Werner (1989): Religiöse und andere Oxymora in Wolframs ‘Willehalm’, in: Werner Schröder, Wolfram von Eschenbach, Spuren, Werke, Wirkungen, Kleinere Schriften 1956-1987 Bd. I, Stuttgart, S. 312-325.
Schulze, Ursula (1967): „Literarkritische Äußerungen im Tristan Gottfrieds von Straßburg“, Beiträge zur deutschen Sprache und Literatur 88, S. 285-310, Tübingen.
Schulze, Ursula (1983): „ AMIS UNDE MAN“, Die zentrale Problematik in Hartmanns „Erec“, Beiträge zur deutschen Sprache und Literatur 105, S. 14-47, Tübingen.
Schwietering, Julius (1957): Die deutsche Dichtung des Mittelalters (Handbuch der Literaturwissenschaft) 2. unveränderte Aufl. Darmstadt, Erstdruck Potzdam 1931.
Semrau, Franz (1910): Würfel- und Orakelspiele im alten Frankreich, Halle a. d. Saale, (Teil einer Diss. Königsberg).
Simrock, Dr. Karl (1849): Parzival und Titurell, Rittergedichte von Wolfram von Eschenbach, übersetzt und erläutert von Dr. K. Simrock, Stuttgart und Tübingen, 2. Aufl. (1. Aufl. 1842).
Smits, Katryn (1981): „Enite als christliche Ehefrau“, in: Interpretation und Edition deutscher Texte des Mittelalters (Festschrift für John Asher zum 60. Geburtstag), S. 13-92, Berlin.
Spiewok, Wolfgang, (1981): Wolfram von Eschenbach: „Parzival“, W. Spiewok, Herausgeber u. Übersetzer, Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch, Bd.1 und 2, mit Anmerkungen und Nachwort, Stuttgart.
Simon, Irmgard (1990): „Knöchel- und Steinchenspiele in Westfalen, Beschreibungen und Wörter“, in: Franco-Saxonia, Münsterische Studien zur niederländischen und niederdeutchen Philologie (Festschrift für Jan Goosens zum 60. Geburtstag), Redaktion: Robert Damme u.a. Neumünster, S. 119-159.
Stapel, Wilhelm, (1950): „Parzival von Wolfram von Eschenbach“ in Prosa übertragen von Wilhelm Stapel, München.
Spitz, Hans-Jörg (1995): „ bickelwort: Würfel- und Speerworte, Zu einer poetologischen Waffenmetapher im Literaturexkurs Gottfrieds von Straßburg“, Lingua Theodisca, Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft (Jan Goossen zum 65. Geburtstag), hg. von Jose Cajot u.a., Niederlande-Studien 16, Bd. II, S. 1019-1032, Münster - Hamburg.
Tax, Petrus (1963): „Studien zum Symbolischen in Hartmanns ‘Erec’, Enites Pferd“, Zeitschrift für deutsche Philologie 82, S. 29-44, Halle, Stuttgart, Berlin.
Tax, Petrus (1965): „Felix culpa und lapsit exillis: Wolframs Parzival und die Liturgie“, Modern Language Notes 80, S. 454-469, Baltimore.
Tax, Petrus (1973): „Gahmuret zwischen Äneas und Parzival. Zur Struktur der Vorgeschichte von Wolframs ‘Parzival’“, Zeitschrift für deutsche Philologie 92, (Hans Eggers und August Langen zum 65. Geburtstav), S. 24- 37, Halle, Stuttgart, Berlin.
Tax, Petrus (197): „Trevrizent, Die Verhüllungstechnik des Erzählers“, in: Studien zur deutschen Literatur und Sprache des Mittelalters (Festschrift für Hugo Moser zum 65. Geburtstag), S. 119-134.
Tobler, Eva (1986): „Ancilla Domini. Marianische Aspekte in Hartmanns Erec“, in: Euphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte 80, S. 427-438.
Tonomura, Naohiko (1971): „Die Anfangsverse des Parzivalprologs“, Wirkendes Wort 21, S. 154-158, Düsseldorf.
Ulzen, Uta (1979): „Wolfram von Eschenbach ‘Parzival’“. Abbildungen und Transkriptionen zur gesamten handschriftlichen Überlieferung des Prologs“, in: „Litterae“, Göppinger Beiträge zur Textgeschichte 34, Göppingen 1974.
Wapnewski, Peter (1955): Wolframs Parzival, Studien zur Religiosität und Form, Heidelberg.
Wapnewski, Peter (1973): „Hartmann von Aue“, in: Hartmann von Aue, hg. von Hugo Kuhn und Christstoph Cormeau. Wege der Forschung Bd. CCCLIX, 2. Aufl. 1973.
Weber, Gottfried (1962): Gottfried von Straßburg, Stuttgart.
Wehrli, Max (1954): „Wolfram von Eschenbach. Erzählstil und Sinn seines Parzival“. Der Deutschunterricht 6. H. 1, S. 17-40, Velber (u. Klettverlag Stuttgart).
Weinhold, Karl (1897): Die deutschen Frauen in dem Mittelalter, Wien.
Willson, Bernard (1955): „Sin and Redemption in Hartmann’s Erec“. The Germanic Review 33, S. 5-14, Cambridge.
Willson, Bernard (1957): „Wolfram’s ‘Self-Defence’“, Modern Language Review LII, S. 572-575, Washington.
Willson, Bernard (1960): „‘Mystische Dialektik’ in Wolframs Parzival“, Zeitschrift für deutsche Pilologie 79, S. 139-150, Halle, Stuttgart, Berlin.
Worstbrock, Franz Josef (1985): „Dilatatio materiae, Zur Poetik des ‘Erec’ Hartmanns von Aue“ (für Karl-Heinz Borck), in: Frühmittelalterliche Studien, Jahrbuch des Institutes für Frühmittelalterforschung der Universität Münster, Berlin, S. 1-30.
Wynn, Marianne (1982): „Medieval Literature in Rezeption: Richard Wagner and Wolfram`s Parzival“, London German Studies, S. 94-114, London.
Wynn, Marianne (1962): „Parzival and Gawan - Hero and Counterpart, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 84, S. 142-172, Halle a. d. Saale, Tübingen.
Zingerle, Ignatz V. (1873): Das deutsche Kinderspiel im Mittelalter, 2. Aufl. Innsbruck 1873.
III. Nachschlagewerke
Bibel von A bis Z, Wortkonkordanz zum revidierten Luthertext“, hg: Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft, Berlin 1969.
„Deutsches Wörterbuch“ von Jakob Grimm und Wilhelm Grimm, Neudruck Leipzig 196o.
Dtv-Lexikon, Deutscher Taschenbuch Verlag, dtv-Lexikon, Mannheim - München 1995.
Handbuch der Literaturwissenschaft, Die deutsche Dichtung des Mittelalters von Julius Schwietering, 1. Aufl. Potzdam 1940, 2. unveränderte Aufl. Darmstadt 1957.
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hg. von Bächthold-Staubli, Berlin-Leipzig 1934/35.
Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum, recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. M. Lindsay 1957 (first edition 1911), Oxford 1957.
Lexikon des Mittelalters, Herausgeber und Berater Norbert Angermann u.a., Bd. VII, München 1995.
Lexikon für Theologie und Kirche, begründet von Dr. Michael Buchberger, 2. Aufl. hg. von Josef Höfer und Karl Rahner, Herder Freiburg 1963.
Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Dr. Matthias Lexer, zugleich als Supplement und alphabetischer Index zum Mittelhochdeutschen Wörterbuch von Bennecke-Müller Zahrnke, Leipzig 1872, 1. Bd.
Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch von Matthias Lexer , 2. Nachdruck der 3. Aufl. von 1885, mit einem Vorwort von Erwin Koller, Werner Wegstein und Norbert Richard Wolf und einem biographischen Abriß von Horst Brunner, Stuttgart 1992.
Mittelniederdeutsches Wörterbuch von Dr. Karl Schiller und Dr. August Lübben, 1. Bd. Bremen 1875.
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Germanicarum, Nova Series, Bd. XVI: Thomas Ebendorfer, Chronica pontificum Romanorum, Berlin - Zürich 1967, hg. von Harald Zimmermann, Neudruck 1994.
Neuhochdeutscher Index zum mittelhochdeutschen Wortschatz, Hrsg.: Erwin Koller; Werner Wegstein; Norbert Richard Wolf, Stuttgart 1990.
Niedersächsisches Wörterbuch, Herausgegeben vom Institut für Historische Landesforschung der Universität Göttingen, Bearbeiter: Gisbert Keseling, Wolfgang Kramer, Ulrich Scheuermann, 2. Bd., Neumünster 1985.
Rheinisches Wörterbuch, bearb. und herausgeg. von Josef Müller, Bonn 1928 1. Bd. (Regeln des Bickelspieles S. 676).
Schwäbisches Wörterbuch, bearbeitet von Hermann Fischer, Tübingen 1904.
Schweizerisches Idiotikon, Wörterbuch der schweizerischen Sprache, hg. mit Unterstützung des Bundes und der Kantone, 4. Bd bearb. von A. Bachmann u.a. Frauenfeld 1896-1901.
Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal, zesde, geheel opnieuw bewerkte Uitgave, Leiden 1924.
Wordenboek der Nederlandsche Taal, bewerkt door A. Kluyter en A. Lodewyckk, Batavia - Gent - Kapstad 1903, Tweede Deel.
Wörterbuch der Ostfriesischen Sprache, etymologisch bearbeitet von J. ten Doornkaat Koolman, Norden 1879.
Sachregister
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhang
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1] So, wie man z.B. bestimmte Dinge oder Menschen nicht leiden bzw. ausstehen kann.
[2] Weil die Form sehr schwer zu beschreiben ist, verweise ich auf die Abbildungen im Text Seite 47-49.
[3] Als literarische Quelle ist eine mündliche Überlieferung und die Erinnerung an ein kulturkundlich interessantes Bickelspiel noch nicht sehr ergiebig. Andererseits ist die Beweiskraft des Erinnerten in diesem Fall ungewohnt dinglich, um nicht zu sagen „knochenhart“, so daß man Hemmungen hat, einem Literaturtheoretiker zuzumuten, die Beweislage „tatsächlich“ zu überprüfen, mit anderen Worten sich auf ein Spiel mit diesen Würfeln einzulassen. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie ist dieser Vorschlag sicherlich gewöhnungsbedürftig.
[4] Die Nachkommen aus dem Hause Anjou waren „Prinzen von Geblüt“; d.h. sozusagen von Natur aus Königskinder. Es war ihre „art“ - um in der Sprache Wolframs zu reden – Königskinder zu sein; wie auch viele Prinzen aus dem Hause Anjou in der wirklichen Geschichte in fremden Königshäusern durch Heirat zur Königswürde gelangten. „Geoffroi V. (1129-51) führte zuerst den Beinamen Plantagenet, heiratete 1127 Mathilde, die Witwe Kaiser Heinrichs des V. und Tochter Heinrichs des I. von England, und eroberte seinem Sohn aus dieser Ehe, Heinrich, 1141-44 die Normandie. Heinrich (1154 engl. König) gewann durch seine Ehe mit Eleonore von Aquitanien 1152 dieses Hzgt.“ (dtv. Lexikon, Stichwort „Anjou“). Eleonore wurde dadurch zur Stammutter des auserwählten Geschlechtes der Anjou. Das sozusagen ‘auserwählte Geschlecht’ ging mit der Zerstörung des angewinischen Reiches 1204-1214, also noch zu Lebzeiten Wolframs, unter. Dieses historische Faktum wird m.E. in Wolframs Werk als dichterische Zeitenwende reflektiert und zwar als Unterschied zwischen Vorgeschichte (Gahmuret- und Feirefizgeschichte) und der Geschichte, die mit dem Eintreten des Helden in den geschichtlichen Raum (des Romangeschehens) erfolgt. Parzival tritt mit einer Art „Sündenfall“, der Ermordung seines „Bruders“ Ither in den „Zeitraum“ der dichterischen Geschichte und Zeit. Damit beginnt in der Dichtung die Geschichte von Sündenfall und Erlösung „erneut“ und zwar auf eine „andere Weise“, d.h. in literarischer Form noch einmal: sie wird „wiederholt“, m.a.W. „wiedergeholt“. Die „Wiederholung“ von etwas, das bereits vergangen war, ist nur möglich, weil die Zeitstruktur der Gegenwart - wie oben dargelegt - als relative „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ im subjektiven Zeiterleben als Gegenwart immer schon, sozusagen vorgeformt, präsent ist. Dieses Zeiterleben ist unser „Ur-Teil“ oder Erbteil. Man könnte es u.U. als die „inhaltliche“ Füllung dessen betrachten, was die Geistesgeschichte im positiven Sinne ihr „Vorurteil“ nennt. Das „Auserwähltsein“ von „Geblüt“ her, die „art“, wie Wolfram sagt, hat mit der „vorgeschichtlichen Inkarnation“, d.h. der Erschaffung des Menschen im Paradiese durch Gott Vater nach dem Bilde der Dreieinigkeit zu tun. Augustinus spricht - nicht zuletzt aufgrund dieses Schöpfungsberichtes - davon, daß die „anima naturaliter christiana est“; m.a.W. die menschliche Natur - nämlich seine „art“ auch ungetauft schon „christlich“ ist. Mit dieser Abgrenzung ist der Status der „heiden“ im „Parzival“ gekennzeichnet. - Heiden im heutigen Sinne waren für Wolfram nur die Sarazenen, d.h. Anhänger des Islam. Alle Menschen waren aber aufgrund ihrer leiblichen Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht, als „Abbild des dreifaltigen Gottes“ schon erlösungsfähig und -berechtigt, wie z.B. der „heide“ Feirefiz. Übrigens sind alle Stammväter des jüdischen Volkes, die Gyburc später in ihrer sog. „Toleranzrede“ aufzählt „heiden“, wie auch alle neugeborenen Kinder. Neben den falschen Göttern Apollo und Tervigant ist „der trügehafte Mahmet [der] uns den touf iht under tret“ der eigentliche „Antichrist“, wie Wolfram im Willehalm (117,21-22) sagt.
[5] Die Bildunterschrift lautet: „Ein unbekannter Stecher hat 1633 [...] eine grauenvolle Szene für die Nachwelt festgehalten:’Den 29. Januari 1633 seindt bey Hesingen, ein stundt von Basel, 48 bauren wegen einer Auffruhr an drey bäumen gehenckt worden’“.
[6] Das mhd. Wort „vël (-elles stn. haut, fell; pergamint; dünne eisdecke“, Lexer, 1992) hatte m.E. nicht den heutigen, einseitig banalen Beigeschmack.- In seiner abfälligen Bedeutung ist „vel“ als Teil des „zwîvels“ sicherlich auch eine Verspottung des zwîvels in Hartmanns „Gregorius“. Andererseits war „vel“ als Pergament ein besonders wertvolles Material. Auf ihm konnte man seine Gedanken und Worte nicht nur festhalten, sondern in Form eines Buches sogar über die Zeit retten. Nur ein reicher Mann konnte sich hundert und mehr Felle leisten, um nur ein einziges herstellen zu lassen. Mit dem verwandten Wort „phell“ (stm. „feines, kostbares seidenzeug, gewand, decke u. dergl.“) verbindet sich die Vorstellung von noch anderen Kostbarkeiten. Wolfram bezieht seine Vorstellungen im Zusammenhang mit „vel“ nicht nur für Dinge. In Vers 747, 26f. wird selbst der Bruder Parzivals „als ein geschriben permint / swarz unde blanc her unde dâ“, vorgestellt. „Permint“ ist ein „vel“, und Feirefiz hat ein elsternfarbiges, was immer das bedeuten mag.
[7] Bei Nachforschungen in volkskundlichen Archiven oder Befragungen im Sprachgebiet des Niederrhein, würde man bei älteren Bürgern, weil dort noch sehr viel niederdeutsch gesprochen wird, mit einiger Wahrscheinlichkeit noch auf Spuren des von mir dargestellten Sachverhaltes stoßen. Das Bickelspiel, wie es mir überliefert wurde, stammt aus Millingen, wo meine Großmutter geboren und aufgewachsen ist. Der Ort liegt - von Kleve und Xanten mit 15 Kilometern gleich weit entfernt - im ehemaligen Herzogtum Kleve, das zeitweise zu Niederlothringen gehörte. Hier lebte im 12. Jahrhundert Heinrich von Veldeke im Dienste Margaretes von Kleve. Sie heiratete den Bruder des Landgrafen Hermann von Thüringen und nahm Heinrich von Veldeke als Hofdichter mit nach Thüringen. Ob sich Wolfram und Heinrich von Veldeke persönlich kennengelernt haben, läßt sich nicht belegen. Jedenfalls fühlte sich Wolfram dem Dichter sehr verbunden. Im „Parzival“ wird sein Name zwei mal lobend erwähnt. Wolfram hatte also mit Sicherheit volkskundliche Kenntnisse aus dem niederdeutschen Sprachraum, ebenso wie Gottfried von Straßburg. Oberlothringen und Niederlothringen bildeten ja das Kerngebiet des burgundischen Reiches, in dem nach dem Niedergang des angevinischen Reiches (1214) die höfische Kultur und Minne eine eigene Blüte erlebte.
Was hier über „bickel“ gesagt wurde, läßt sich dadurch verifizieren, daß man sich „Knöchel“ aus den Fußgelenken eines Schweines beschafft. Auf der Form und Funktionsanalyse der Bickel und des Bickelspieles ist die Deutung dessen, was Gottfried im „bickelwort“ gemeint haben könnte, aufgebaut. Bickel, von denen Gottfried sich für seine Kritik anregen ließ, hatten also eine völlig andere Form und Funktion, als die uns heute bekannten Würfel. Nicht zuletzt aus diesem Grunde konnte die Kritik Gottfrieds von Straßburg an Wolframs Stil bisher nicht verstanden werden.
[8] Bericht vom 14.5.1996 im Kölner Stadtanzeiger über eine Gedenkveranstaltung zum 75. Geburtstag von Josef Beuys. Oben angeführte Zitate stammen aus einem Aufsatz von Friedhelm Mennekes, Theologische Anmerkungen zum Christus-Impuls bei Josef Beuys, in Friedhelm Mennekes, Josef Beuys: Christus Denken-Thinking Christ, Kath. Bildungswerk , Köln 1996
[9] „Deutsches Wörterbuch“ von Jakob Grimm und Wilhelm Grimm, Leipzig 196o; Stichwort Zweifel: „Zweifel, adj. bis zum frühen 16, Jahrh. belegt, dann von zweifelhaft völlig verdrängt; das adj. zweifel ist wahrscheinlich älter als das subst. und bezeichnet die eigenschaft, ‘einen gespaltenen, zweigeteilten sinn habend’, vergl. [...] den gebrauch im Heliand wo das subst. fehlt und die grundbedeutung von ai-duaya ‘zwei arten habend’, (s. Wackernagel)" bedeutet ahd. zwifal (dubius zwifal ahd.) mhd. zwîvel [...] sowie mit Weiterbildung im as. twifli (atribut zu hugi) und ahd. twifali, zwifili 1) ungewiz unentschieden, strittig Heliand 285-288: „Nu ik theses thinges gitruon; uuerde mi aftar thinun uuordun, al so is uuilleo si, herron mines, nis mi hugi tuifli. ne uuord ne uuisa.“ „Nun vertraue ich seiner Macht mir geschehe nach deinen Worten, wie es der Wille meines Herrn ist. mein Herz zweifelt nicht, weder in Worten noch in Werken." Genzmer, Felix: Der Heliand und die Bruchstücke der Genesis, Anmerkungen und Nachwort von Bernhard Sowinski Stuttgart 1989 Reclam
[10] Unter dem Titel „Produktive Mißverständnisse. Wolfram als Übersetzer Chretiens“ (1996, S. 134-139) beschäftigt sich Nellman eingehend mit der o.a. Textstelle. Er findet eine richtige, aber etwas unvermittelte Erklärung dafür, daß sich der „Krüppel“ mit seiner edelsteinverzierten „Krücke“ (bei Chretien ebenfalls vor Schastel marveile sitzend) im Zuge der Übersetzung bei Wolfram in einen „krâmer“ und einen wertvollen „krâm“ vor Schastel marveile verwandelt: „Ich gehe davon aus, daß Wolfram die teure Prothese des sonderbaren Stelzenmannes - eschcae - als kostbares Tischgestell auffaßte und daß er so zu seiner Vorstellung von krâm und krâmer gelangte“ (1996, S. 139). Weil Nellmann die literarischen Hilfestellungen Wolframs im Text nicht bemerkte, hält er ein „produktives Mißverständnis“ Wolframs für den eigentlichen Grund seines neuen Konzeptes, das an dieser Textstelle erkennbar wird. Daß das neue Konzept Wolframs nur auf einen Übersetzungsfehler der Vorlage Chretiens zurückzuführen ist, wage ich jedoch zu bezweifeln. Der andere Gedanke Nellmanns, daß der untere Teil der Krücken, nämlich die Stollen, zu Tischbeinen bzw. einem Tisch in Beziehung steht, eröffnet m.E. noch eine andere Perspektive und zwar im Hinblick auf die Deutung des Gralsgeschehen. - Es wäre interessant, anhand des Tischmotivs („zu Tisch sitzen“ bzw. „Mahl halten“) und seiner Metamorphose in verschiedenen Dichtungen, der Frage nachzugehen, was z.B. der Abendmahlsbericht der Bibel, die Sure 5 des Korans „Der Tisch“ (Vers 113-116!) und die Gralszene als „Tischlein-Deck-Dich“ inhaltlich und formal als Verhältnis von Offenbarungsbericht-Parodie-Travestie miteinander zu tun haben.
[11] Lexer, 1992, zwîvel stm (md. auch zwibel) zweifel als ungewißheit, besorglichkeit, mißtrauen, unsicherheit, hin- und herschwanken, wankelmut.“ Unter dem Stichwort „zwibel“ steht der Hinweis auf „zwîvel“.als identisch mit „zwibel“.
[12] In dieser Arbeit sind die Ergebnisse von drei früheren Dissertationen, die sich mit dem Thema „Herz“ befassen, rezipiert und kritisiert: 1. M. Schittenhelm: Zur stilistischen Verwendung des Wortes ‘cuer’ im Altfranzösischen. Tübingen 1907; 2. Erika-Maria Fickel: Die Bedeutung von ‘sele’, ‘lip’ und ‘herze’ in der frühmittelhochdeutschen Dichtung und den Texten der mittelhochdeutschen Klassik. Tübingen 1949; 3. Fr. Heimplätzer: Die Metaphorik des Herzens im Minnesang des 12. Und 13. Jahrhunderts, Heidelberg 1953.
Neben der Kritik bemerkt X. von Ertzdorff zu diesen Dissertationen in derselbe Fußnote: „Ich verdanke ihnen den Überblick über die Belege und Anregung für die Deutung“.
[13] dtv: Joachim von Fiore, 1130-1202, kath. Theologe ursprünglich Zisterzienser-Abt; gründete um 1190 den strengeren Floriazenser-Orden.
[14] Bumke interpretiert die Aussage über den Sündenfall (465,1-5) so: „Wenn Trevrizent dem Neffen den Charakter und das Ausmaß seiner Schuld begreiflich machen will, spricht er vom Sündenfall: die Verwandtschaft mit Adam sei ein ‘Sündenwagen’, der die ganze Menschheit in die Sünde fahre“ (Bumke, 1997, S. 104). Aus dem Kontext bietet sich eher die äquivoke Bedeutung von „wagen“ an: eine Sünde zu „riskieren“, ohne dafür so bestraft zu werden wie die Engel. Der Mensch hat die relative Freiheit „nein“ zu sagen, „sô daz wir sünde müezen tragen“ (465,6). Er hat aber auch die Möglichkeit zur „riuwe“ (465,2).
[15] Der Rhythmus ist z.B. ein künstlerisches „Maß“ für Chaos im positiven Sinne, wenn man ihn definiert als „bewegte Ordnung und geordnete Bewegung“, eine weithin bekannte Formulierung.
[16] Lexer, 1992, „nach. na 1. Adv. nahe beinahe, genau; räumlich und zeitlich, 2. präp. mit dat. räumlich das streben, die richtung [...] modal das vorbild, die art und weise bezeichnend“. Lexer 1992, „nahe, na adv. nahe, in der, in die, aus der nähe räuml.; n. in eng eingeschlossen, fest und tief; in innerlich tief berührender, namentlich verletzender, schädlicher wiese.“ Lexer, 1992, „gebur, -bure stswm. mitbewohner, mitbürger nachbar dorfgenosse, bauer; Lexer, 1992bur, stm. vogelkäfig“ Lexer, 1992, „ge“: vor subst. adj. adv. und verben mit dem begriffe des zusammenfassens, abschließens“. Die Silbe „ge“ wird also in collektierender Funktion gebraucht, wie „gebende stn. coll. zu bant“. „geaeder stn. coll. zu ader“; „ge-beine stn. coll. zu bein“. Analog gilt: ge-bûr in collektierender Funktion zu bûr, „Vogelbauer“, Käfig.
[17] Ulzen, Uta (1979): „Wolfram von Eschenbach ‘Parzival’. Abbildungen und Transkriptionen zur gesamten handschriftlichen Überlieferung des Prologs“, in: Litterae, Göppinger Beiträge zur Textgeschichte 34, hrsg. von Ulrich Müller, Franz Hundsnurscher und Cornelius Sommer, Göppingen 1974. Es handelt sich um eine verdienstvolle Arbeit. Kritisch darf vielleicht angemerkt werden: In der beigefügen Transkription der 16 alten Handschriftentexte wird das letzte Wort des ersten Prologverses, „gebur“, durchgehend mit dem vorhergehenden Wort „nach“ (nah oder noch“) zu einem einzigen und neuen Wort zusammengefaßt, „nâchgebûr“, „nochgebur“ oder „nachgebawr“. Von den 16 Textzeugen, die vorgelegt wurden, erscheint in neun Fällen dieses in der Transkription in cumulo zusammengefaßte Wort jedoch eindeutig in zwei Einzelwörtern getrennt als „nach“ und „gebur“. Dadurch wird nahegelegt, daß die beiden letzten Wörter des Verses zusammengefaßt immer nur „Nachbar“ oder „benachbart“ heißen sollen. Das ist m.E. eine falsch verstandene Übersetzungshilfe; denn getrennt geschrieben und gesprochen ist der Sinn des Textes u.U. ein anderer.
[18] Jolles, 1930, Einfache Formen, Legende/Sage/Mythe/Rätsel/Spruch/Kasus/Memorabile/ Märchen/Witz, Halle 1930 S.132 f. Das „Ilorätsel“ lautet in seiner gewöhnlichen Fassung: Auf Ilo geh ich, auf Ilo steh ich, auf Ilo bin ich hübsch und fein, rat`t, meine herren, was soll das sein. Unter Bezug auf seine Quelle (Wossidlo S.191) gibt Jolles eine Erklärung für dieses Ilo-Rätsel im niederdeutschen Dialekt: „En mäten hett`n kind ümbröcht hatt; nu is dat jo früher so wäst, dat lüd`, de to`n dod`verurteilt wäst sund, de richters hebben `n rätsel upgäben künnt, wenn de dat nich lööst hebben, sünd se erlööst wäst. Ilomm hett dat mäten ehr hund heeten, von den`n sien fell hett se sik`n poor schoh maakt. As nu de dach rankümmt, treckt se de schoh an un geit na de richters un bädt ehr dat rätsel vör. Dat hebben se nich raden künnt; dor is se fri kamen.
[19] Wenn Spiewok (1981, Bd. II S. 59) die Verse 465,5-6 übersetzt: „Unsere Abstammung von Adam brachte uns Leid, [...] weil wir von Adam die Last der Sünde geerbt haben und sie tragen müssen“, so wird darin das Moment der Freiheit des Menschen, das im „sünden wagen“ reflektiert wird, nicht berücksichtigt. Nachreformatorisch klingt auch der Kommentar Bumkes zu dieser Textstelle:„die Verwandtschaft mit Adam sei ein ‘Sündenwagen’, der die ganze Menschheit in die Sünde fahre“ (97 S. 104). Vorreformatorisch könnte man 465,3-6 sinngemäß auch so deuten: Seit Gott Mensch geworden ist und seine Verwandtschaft mit uns nicht mehr leugnet („sît er uns sippe lougent niht“) ist es unser Schicksal, „Sünden“ (d.h. uns „abzusondern“!) überhaupt erst zu riskieren („unt daz die sippe ist sünden wagen“!) und ihre Folgen (sünde= Gottferne!) zu ertragen („sô daz wir sünde müezen tragen“ 465,6). Wolfram spielt hier wiederum mit dem Stilmittel der Äquivokation, d.h. der Mehrdeutigkeit gleichlautender Wörter: „wagen“ heißt zwar auch „Wagen“ (im Sinne von Vehikel); es heißt aber doch wohl auch ein „Wagnis“ eingehen, etwas riskieren: Im zweideutigen Sinne von „topeln“ sein „Glück aufs Spiel setzen“, sein „Glück versuchen“.
[20] Lexer, 1992 Stichwörter "anschouwe" und "wal" 1. an-schouwe stf. das anschauen; anblick, das aussehen. 2. wal, wale stf. wahl, auswahl, freie selbstbestimmung, verfügung
[21] Hierzu muß man noch anmerken, daß außerdem in Faksimile G und Gr (S. 5 und 8) die Textlücken bei „agelster“ in der Transkriptionsliste (S. 38) mit Endsilben auf „n“, ergänzt wurden (durch Punkte als Ergänzung gekennzeichnet). Von der Handschrift q (S. 17) fehlt in der Liste das Endungs-t. Dort ist nämlich „agelstert“ bezeugt, was im o.a. Zusammenhang mit der Handschrift G besonders interessant ist! Der Handschrift m (S. 22) wird in der Transkriptionsliste irrtümlicherweise dem Wort „agelster“ ein „n“ angehängt, das in der Handschrift nicht vorhanden ist.
[22] Die naheliegende Vorstellung von „Kneifzange“ als Trennwerkzeug, um einen Draht „durchzukneifen“ oder um Nägel herauszuziehen, damit eine Verbindung gelöst wird, ist das Gegenteil von dem, was hier gemeint ist. Das mhd. Verbum „zangen“ swv. heißt ziehen, fassen, zerren. Die „Hobelbankzange“, mit der man von zwei Seiten her etwas zusammenzieht bzw. einspannt, gibt den Sinn richtiger wieder.
[23] Im Lexikon des Mittelalters wird unter dem Stichwort ‘Spiele’ auf den grundlegenden Zusammenhang von Würfelspiel und Würfelorakel hingewiesen: „Während der Wintersonnenwende (25. Dez. bis 6. Jan.) wurde nicht nur der Geburt Christi gedacht, sondern auch das Würfelspiel gepflegt, dessen ursprüngliche Wahrsagefunktion jedoch in Vergessenheit geraten war“ (1995, Bd. 7, Spalte 2106). - Hier ist auch noch die Inaugural-Dissertation von Franz Heinevetter, Würfel- und Buchstabenorakel in Griechenland und Kleinasien (1912), zu erwähnen. Im Zusammenhang mit Würfelorakeln, die mit fünf Würfeln gespielt wurden, spricht er von 56 Wurfbildern. Diese Zahl korrespondiert mit der in Stein gehauenen Anzahl von Orakelinschriften, die sich in Griechenland und Kleinasien auf den Säulenresten von sieben Würfelorakeln fanden. Die Aussage, „wenn man alle Wurfmöglichkeiten ausrechnet, so erhält man mit fünf Astragalen 56 verschiedenen Würfe“ (Heinevetter, 1912, S. 30), ist nicht ganz nachvollziehbar, wie die eigenen Versuche zeigten. Diese Zahl steht zwar in einem realistischen Verhältnis zu 35 Wurfbildern mit vier Würfeln, die von Rohlfs angegeben werden. Es gibt aber theoretisch keine Methode, aus 4x4x4x4x(4-1) Würfen, d.h. aus mehreren hundert Würfen, exakt die immer wiederkehrenden 56 Wurfbilder „rechnerisch“ zu ermitteln. - Auch die Behauptung Heinevetters - entgegen den Aussagen anderer Autoren, z.B. von Blümner (S. 32) und Schönau (S. 56), die er in der eigenen Arbeit zitiert - daß „das für die Deutung des Wurfes entscheidende Moment [..] der Zahlwert desWurfes“ sei, ist nicht überzeugend. „Schömann (Griech. Altertümer II, 4. Aufl. S. 302) glaubte, daß die ‘Charaktere’ [..] der Würfel das Entscheidende bei der Deutung des Wurfes sei (zitiert nach Heinevetter, 1912, S. 56).“ Diese Ansicht war auch Grundlage der Überlegungen in der vorliegenden Arbeit.
[24] Lexer, 1992 gelph = „gwelphe; gelf, gelfe stswm. Welfe, d.h. welfisch oder aus welfischem Besitz.
[25] „hengst meint im Neuhochdeutschen das geschlechtsbestimmende Nomen ‘Hengst’, das feurige, unkastrierte Pferd, (dem) widerspricht die Wortbedeutung im Mittelhochdeutschen [..] konträr; hengist meint den Wallach, das nach mittelalterlichem Denken minderwertige Pferd.“ In der Fußnote auf derselben Seite heißt es: „Wallache waren nur selten im Gebrauch und lassen sich bei den höfischen Dichtern kaum nachweisen“ (Ackermann-Arlt, 1990, S. 88).
[26] Schon in der ersten Pferdebeschreibung, die dem Umfang nach derjenigen Chretiens entspricht, muß Hartmann sich bei der „Lobpreisung“ selbst zügeln: „wan solde ich ez iu allez sagen / sô würde der rede ze vil / den lop ich iu nu enden will“ (Er. 1449f). In der zweiten endet die „wild-gewordene Pferdegeschichte“ in Walhalla.
[27] Der leicht ironische Ton einer solchen „Inhaltsangabe“ aus der fiktiven Perspektive Wolframs reflektiert die eigene, subjektive Empfindung gegenüber der inhaltlichen Seite nach dem eingehendem Studium des Erecromans. Diese Form mag im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie nicht angebracht sein, wie emotionale Äußerungen im wissenschaftlichen Kontext überhaupt unzulässig sind. Andererseits kann eine gefühlsmäßige Äußerung, die man sozusagen versuchs- bzw. vergleichsweise dem Dichter unterstellt, manchmal durchaus sinnvoll sein, weil man mit Sicherheit davon ausgehen darf, daß es nicht literaturtheoretische Überlegungen, sondern ähnliche, sehr subjektive Empfindungen waren, die einen gläubigen Christen des 12. Jahrhunderts zu einer bitterbösen Kritik voller Emotionen veranlaßt haben könnten. Es wäre wohl eine perfekte Selbsttäuschung der modernen Literaturwissenschaft, einem Künstler wie Wolfram zu unterstellen, er habe die Arbeit seines Dichterkollegen nur formal beurteilt oder sie etwa so wahrgenommen, wie ein Literaturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Julius Schwietering spricht mit Bezug auf Gottfrieds „Tristan“ allen Ernstes davon, „Gott (sei) zu einem Werkzeug der Minne geworden, er dient den Liebenden und bewährt seine hövescheit, indem er ihnen lügen und trügen hilft, um den Schein ihrer Ehre zu retten“ (Schwietering, 1940, S.190f). Eine solche, das christliche Gottesbild denunzierende, aufklärerische „Toleranzschwelle“, wo „in oppositioneller Bejahung des Diesseits heidnischer Göttername an die Stelle Gottes tritt“ (Schwietering, 1940, S. 192) wäre für Wolfram eine vom Inhalt der Dichtung völlig abgelöste absurde Idee. Wolframs Kritik am „Erec“ richtet sich ganz auf die inhaltliche Seite dieser Dichtung: Auf den Verrat am Christentum, die Apostasie und die Neubelebung des germanischen Mythos. Die emotionale Reaktion auf diesen Inhalt findet in der satirischen Form der Hartmannkritik im Parzivalprolog einen angemessenen Ausdruck, als Satire auf das „verligen-Problem“ des „Erec“.
[28] Beim sog. „Gottesurteil“ gegen Isolde („Tristan“) betrügt sich dieser „hövesche got“ durch sein Eingreifen zugunsten eines ehebrecherischen Paares selbst: Eine irre Vorstellung!
[29] Ein Rubin aus dem Schatz der Welfen, welfischer Rubin.
[30] Die subjektiv geprägte und aus einer fiktiven Perspektive konzipierte „Inhaltsangabe“ des „Erec“ ist als Überleitung zur Wolfram-Kritik am „verlige“-Motiv des „Erec“ gedacht. Man hätte sie wissenschaftlich korrekter formulieren können, wie Horst Brunner (1993, S. 100f.) sie als „stofflichen“ Vorspann seiner Erec-Interpretation anbietet. Durch ihre zum Teil ironisch verfremdete Form ergibt sich jedoch die Möglichkeit, auf kürzestem Wege das notwendige Vorverständnis zur Dechiffrierung des Parzivaltextes zu erreichen, der die Form eines mehrteiligen Rätsels hat. Darüber hinaus kann eine sog. Inhaltsangabe (weil Inhalt nicht von Form getrennt werden kann) die notwendigen und sich geradezu aufdrängenden Hintergrundinformationen im „Erec“ nicht gleichzeitig mitliefern, auf die Wolfram reagiert. In seiner Satire wird Erec z.B. als Hengst identifiziert. Die doppelt vorhandene „Pferdebeschreibung“ (die erste: 1414-1455 und die zweite: 7265- 7788 bzw. - 7795), deren zweite ganz aus dem üblichen Erzählrahmen fällt und dem Geschehen eine völlig andere Dimension gibt, mag für Wolfram der Grund dafür gewesen sein, den Schleier des Mythischen, der das Verhalten Erecs umgibt, in der satirischen Anspielung auf sein „Hengstverhalten“ zu zerreißen. - In einer üblichen Inhaltsangabe erfährt man auch nichts davon, daß der „liebe Gott“ nach Ansicht Hartmanns, gar nicht so „lieb“ ist, weil er nämlich Enites unheilvolle Schönheit geschaffen hat. Enite wird ihrerseits gerade wegen dieser Schönheit sozusagen liturgisch vor 140 Rittern (1607) als eine „zweite Eva“ gefeiert. Vor der engelgleichen Schönheit erschrecken die tüchtigsten Helden der Welt (1737). Die Widersprüche sind nicht zu übersehen. - Eingeblendet wurde bei Brunner auch nicht die ikonographisch eindeutige „Einhorngeschichte“ (1315-1319), die auf eine zweite Eva zielt. Daß der „himelskaiser“ (133) unübersehbar aktiv am Romangeschehen beteiligt ist, wird nicht erwähnt: 399 - 356 - 490 - 535 - 540 - 545 - 567 - 601 - 640 - 657 - 664 - 956 - 978 - 1141 - 1217 - 1355 - 1461 - 1467 - 2437 - 2495 etc. Gott ist als Mitspieler und „eigentlich Schuldiger“ voll in das Geschehen integriert! - Erec erstrahlt trotz bösartigster Reaktionen im Glanz der Heiligkeit, jedenfalls ist er mit den entsprechenden ritterlichen Insignien ausgestattet, die ihn als solchen erkennen lassen: mit einen Engel als Helmzimier (2336-2338), „zwo genade vuocten im daz: saelde und groze werdekeit, die hate got an in geleit.“ (2437-2439). Bis „am Schluß eine Art fabula docet hinzugefügt“ (Brunner, 1993, S.111) wird, daß Erec sich zwar nur „um ihretwillen verlegen hatte“ (Er. 10123) und Gott ihm, weil er nach dem Gebot seiner eigenen Ehre (!) lebte (10124f), die weltliche und die ewige Krone gegeben habe, („der künec selbe huoter / ir willen swa er mohte / und doch als im tohte / niht sam er ê phlac / dô er sich durch si verlac / wan er nâch êren lebete / und sô daz got im gebete (10119 ff.). Gäbe es nicht das Gebot der Ehre, nämlich den von Hartmann geschaffenen Ehrenkodex, hätte sich am fiktiven Hofe vermutlich nichts geändert! Alles ist Ehrensache, sowohl das höfische wie das ewige Leben! Das glaubt Hartmann und davon möchte er seine Zuhörer überzeugen. - Das ist seine dichterische Fiktion von Erlösung auf Kosten des christlichen Glaubens. Horst Brunner kommentiert die Eindringlichkeit, mit der Hartmann seine Ansichten vertritt so: „Mit seiner bisweilen ein wenig dick aufgetragenen Lehrhaftigkeit wäre Hartmanns Text schwer genießbar, unterbräche der Autor der Didaxe nicht immer wieder [...] durch erzählerischen Schabernack“ (Brunner, 1993, S.112). Die Auferstehungsparodie, besonders (6590-6598 und 6669-6684), den anschließenden „Kuraufenthalt in Walhalla“ (7120-7204), den „Kurbericht“ über Erecs Heilung (bzw. „Heiligsprechung“) an der „Pferdehälfte“ seines Wesens („zweite Pferdebeschreibung“!), seine „Erhöhung“ zu Pferde, verbunden mit der Erlösung“ bzw. Versöhnung Enites (die von diesem Augenblick an wieder völlig sprachlos ist!), könnte man auch für harmlosen Schabernack halten, wenn er nicht ernst gemeint wäre! Wolfram meint dazu: „ich enhan daz niht vür lichtiu dinc“, m.a.W. für „verantwortungslos“! Die Erec-Satire ist seine Gegenreaktion! - Daß Hartmann ein „glänzender Rhetoriker“ und der „erste Klassiker der deutschen Literatur“ (Brunner, 1993, S.106) ist, wird mit einer solchen Kritik nicht bestritten. Die für einen wissenschaftlichen Text unübliche Art einer Inhaltsangabe des Erec aus der fiktiven Perspektive Wolframs ist dadurch gerechtfertigt, daß sie auch seiner Stimmungslage entsprochen haben mag und deshalb zum schnelleren Verständnis der Erec-Parodie sowie der Interpretation der betreffenden Textstelle sinnvoll ist. Wolfram selbst beschreitet im Parzivalprolog den denkbar kürzesten Weg der „Kritik“. Dies ist seine Satire. Er kommentiert: „solt ich nu wip unde man / ze rehte prüeven als ich kann / dâ vüere ein langes maere mite / nu höeret dirre âventiure site“. Die „umständliche“ Beschreibung des Verhältnisses von Mann und Frau (hier Erec und Enite) ist das Schicksal des Interpreten.
[31] „Wer der Falschheit verbunden ist, der taugt für das Höllenfeuer; und durch ihn verdirbt alle Vortrefflichkeit. Seine Beharrlichkeit hat einen so kurzen Schwanz, daß sie nicht einmal jeden dritten Stich abzuwehren vermag, wenn sie, von den Bremsen verfolgt in den Wald rennt“ (Haug, 1992 S. 166). Ein konventionelles Übersetzungsbeispiel, das - ohne Bildhintergrund - ebenfalls richtig ist!
[32] Man könnte auf eine ähnliche Stelle im „Tristan“ („wâren si beidiu gênde / sitzende unde stênde“ Tr. 12984ff.) verweisen und daraus folgern, daß dem Publikum die Bedeutung der seriellen Abfolge von „sitzen-gehen-verstehen“ bekannt sei. Wolfram verwendet diese Formel jedoch, um das Tabuwort „verligen“ zu zitieren, ohne es „in den Mund“ zu nehmen“.
[33] Nicht primär im Sinne von Unmoral zu verstehen, sondern als Verletzung königlicher „Standespflichten“.
[34] Eine andere Übersetzung dieser Textstelle: „Freundschaft, die sich nicht bewährt [...] verkürzt den Kuhschwanz ihrer Treue: nach dem dritten Biß schlägt sie die Bremsen nicht mehr weg im Wald“ (Kühn, 1991, S. 430). In einer solchen Übersetzung wird durch die Festlegung auf „Kuhschwanz“ und „Bremsen“ das für die Sinnfindung wichtige stilistische Mittel der Äquivokation ausgeklammert.
[35] Wie Iwein der Löwen-Mann, ist Erec der Pferde-Mann!
[36] ‘wie herre, alter hengst’, sprach er (Dodinet) ‘wolt ir wiedder myn herren Gawan vehten ?’ (Ackermann-Arlt, 1990, S. 90). Einen alten hengst bestraft man am besten mit Verhöhnung, statt mit ihm zu kämpfen.
[37] Erec 133 / 339 / 356 / 490 / 535 / 540 / 545 / 567 / 601 / 657 / 956, um nur einige Stellen zu nennen.
[38] Es handelt sich beim Thema „Pferdemänner“ um eine höchst interessante „Kleine Studie zum Selbstbewußtsein eines Ritters“. So wie im späteren „Iwein“ Hartmanns von Aue der Held der „Ritter mit dem Löwen“ ist, wird hier Erec in seinen besonderen Eigenschaften mit einem Pferd identifiziert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptinhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine germanistische Abhandlung, die sich ausführlich mit dem Parzivalroman von Wolfram von Eschenbach auseinandersetzt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Prolog des Romans und der Interpretation seiner Bilder, insbesondere im Kontext des Literaturstreits zwischen Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg. Die Arbeit analysiert die Sprache, Motive und Struktur des Prologs, um ein tieferes Verständnis des Gesamtwerks zu ermöglichen.
Was sind die Hauptthemen, die in Bezug auf den Prolog untersucht werden?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die dichterischen Bilder des Prologs, insbesondere den Begriff des "zwîvel" (Zweifel/Zwiefalt), das Elsterngleichnis und den "nâchgebûr" (Nachbar), sowie ihre Beziehungen zueinander. Es wird auch das Verhältnis von Wort und Bild, die Bedeutung des "bickelwort" (Würfelwort) in Gottfrieds Kritik und Wolframs Einsatz von Ironie und Zweideutigkeit beleuchtet.
Welche Rolle spielt der Literaturstreit zwischen Wolfram und Gottfried in dieser Analyse?
Der Literaturstreit dient als Rahmen für die Analyse der dichterischen Bilder Wolframs. Gottfrieds Kritik am "bickelwort" wird als Ausgangspunkt genommen, um die spezifischen Eigenschaften von Wolframs Sprache und Stil zu untersuchen. Die Analyse versucht, anhand dieses Streits die "Andersheit" und Kunst Wolframs zu ergründen.
Was ist die Bedeutung des "bickelwort" (Würfelwort) in diesem Kontext?
Das "bickelwort", ein Begriff aus Gottfrieds Kritik an Wolfram, wird als Schlüsselmetapher analysiert, um die spezifischen Eigenheiten von Wolframs dichterischer Sprache zu verstehen. Es steht für Gottfrieds Kritik an Wolframs vermeintlicher Unklarheit und Zweideutigkeit im Ausdruck. Die Studie versucht, über die Form und Funktion des "bickels" selbst (einer Art Würfel) die Bedeutung dieses Vorwurfs zu entschlüsseln.
Welche These wird in Bezug auf Wolframs dichterische Bilder aufgestellt?
Die These lautet, dass Wolframs dichterische Bilder oft abstrakt sind und gleichzeitig etwas verhüllen und enthüllen. Sie erfordern eine künstlerische Wahrnehmung und eine aktive Beteiligung des Hörers/Lesers, um ihren tieferen Sinn zu erschließen. Die Analyse argumentiert, dass diese Bilder oft auf ein trinitarisches Menschenbild hindeuten und eine tiefere Ebene menschlicher Existenz berühren.
Was wird in Bezug auf die Analyse des Wortes "zwîvel" (Zweifel) betont?
Die Analyse betont, dass der Begriff "zwîvel" nicht nur im Sinne von religiösem Zweifel oder Unsicherheit zu verstehen ist, sondern auch eine tiefergehende existentielle Bedeutung hat. Er wird als ein Zustand der "Zwiefalt" interpretiert, der im Herzen des Menschen wohnt und sowohl positive als auch negative Aspekte beinhalten kann. Die Studie unterstreicht die Vieldeutigkeit des Wortes im mittelhochdeutschen Kontext und versucht, seine spezifische Bedeutung im Parzivalprolog herauszuarbeiten.
Was ist die Bedeutung des Elsterngleichnisses im Prolog?
Das Elsterngleichnis dient als bildhafte Veranschaulichung der menschlichen Verfassung, die durch den "zwîvel" geprägt ist. Die Elster, mit ihrer schwarz-weißen Färbung, wird als Symbol für die Teilhabe an "Allem und Nichts" interpretiert. Ihre Handlung, die Auswahl und das "Tun" mit den Farben, nimmt programmatisch das Romangeschehen als Ganzes vorweg und unterstreicht Wolframs Konzept eines trinitarischen Menschenbildes.
Was ist das Ziel der Interpretation der "Frauenlehre" und der "Erec-Satire" im Prolog?
Ziel ist es, die mögliche Hintergrundstruktur des Parzivalromanes anhand zentraler dichterischer Bilder zu identifizieren. Die Studie argumentiert, dass die "Enite-Kritik" und die "Erec-Satire" verborgene Angriffe auf Hartmann von Aue enthalten und somit wichtige Einblicke in Wolframs künstlerische und ideologische Positionen geben. Durch die Analyse dieser Passagen soll der "irritierende Perspektivenwechsel" im Roman besser verstanden werden.
Welche methodischen Überlegungen werden angestellt?
Die Studie reflektiert über die unterschiedlichen methodischen Ansätze von Geisteswissenschaft und Kunst und betont die Bedeutung von subjektiver Erfahrung und "Alltagshermeneutik" bei der Interpretation dichterischer Texte. Es wird die Notwendigkeit betont, sowohl philologische Argumente als auch künstlerische Sensibilität in die Analyse einzubeziehen.
Was sind die Schlussfolgerungen dieser Untersuchung?
Die Schlussfolgerung ist, dass der Parzivalprolog eine komplexe Einheit von Text und Bild darstellt, die durch eine Vielzahl von Stilmitteln und Anspielungen geprägt ist. Die Analyse der dichterischen Bilder, insbesondere des "zwîvel", des Elsterngleichnisses und des "bickelwort", ermöglicht ein tieferes Verständnis der thematischen und ideologischen Schwerpunkte des Parzivalromans sowie des Verhältnisses zwischen Wolfram von Eschenbach und seinen Dichterkollegen.
- Quote paper
- Dr. Heinrich Hüning (Author), 1999, Würfelwörter und Rätselbilder im Parzivalprolog Wolframs von Eschenbach, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184771