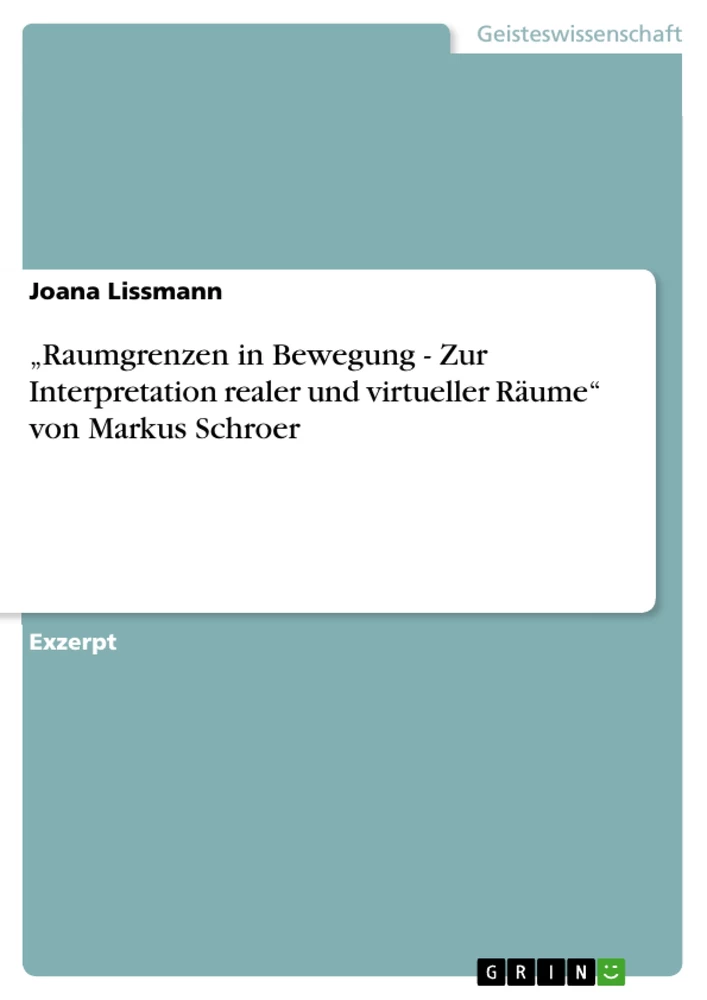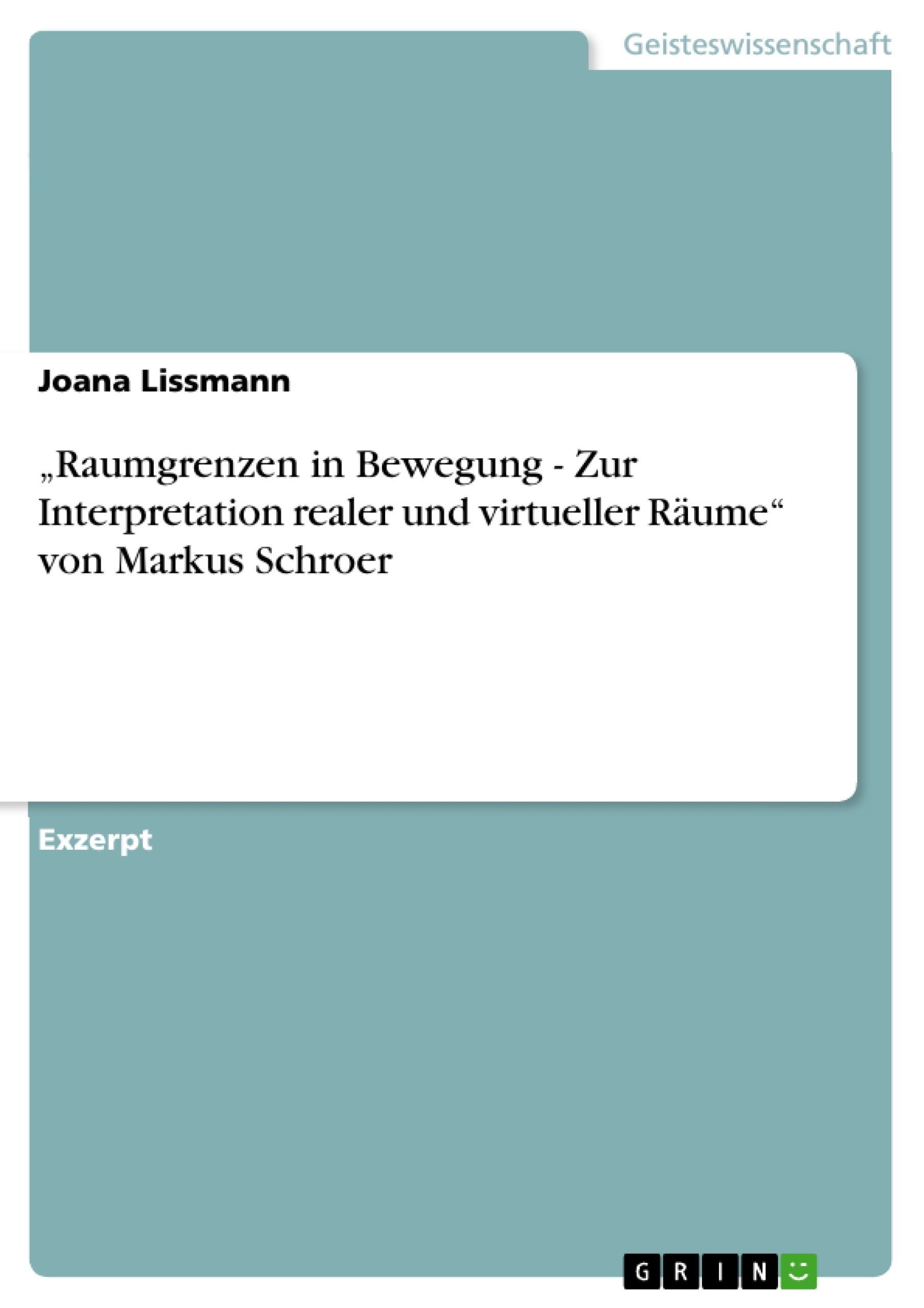Schroer schreibt im Zuge der Globalisierung dem Internet eine Schlüsselrolle zu, da es die Möglichkeit eröffnet unabhängig von „geographischen, politischen und kulturellen Grenzen an jedem beliebigen Ort zu jeden Zeitpunkt“ (Schroer 2003, S.217) Informationen zu vermitteln und zu empfangen. Dadurch werden die Grenzen des Geschlechts, Alters und der eigenen Identität überwunden.
Inhaltsverzeichnis
- Exzerpte über „,Raumgrenzen in Bewegung- Zur Interpretation realer und virtueller Räume" von Markus Schroer
- Die Entgrenzung der Gesellschaft durch das Cyberspace
- Metaphern für das Cyberspace
- „Datenautobahn“
- „Global Village“
- „Digitale Stadt“
- Weitere Metaphern
- Grenzen im Cyberspace
- Riten im Cyberspace
- Ernüchterung im Netz
- Hybride Räume
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Auswirkungen des Internets auf die räumliche Wahrnehmung und die Grenzen zwischen realem und virtuellem Raum. Er untersucht die Metaphern, die zur Beschreibung des Cyberspace verwendet werden, und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Verschmelzung von realem und virtuellem Raum ergeben.
- Die Entgrenzung der Gesellschaft durch das Cyberspace
- Metaphern für das Cyberspace
- Grenzen im Cyberspace
- Riten im Cyberspace
- Die Auswirkungen des Cyberspace auf die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit der Analyse der Rolle des Internets im Kontext der Globalisierung. Schroer argumentiert, dass das Internet die Grenzen von Raum, Zeit und Identität aufhebt und eine neue Form der Vernetzung ermöglicht. Er stellt jedoch auch die Frage, ob der Cyberspace tatsächlich eine Entgrenzung der Gesellschaft bewirkt oder ob er nicht vielmehr zu einer neuen Grenze zwischen dem Realen und Virtuellen führt.
Im weiteren Verlauf des Textes werden verschiedene Metaphern für das Cyberspace untersucht, darunter die „Datenautobahn“, das „Global Village“ und die „Digitale Stadt“. Schroer kritisiert diese Metaphern als unzureichend, da sie den relationalen Charakter des Cyberspace nicht erfassen. Er argumentiert, dass der Cyberspace nicht als ein Raum im traditionellen Sinne verstanden werden kann, sondern als ein Netzwerk von Beziehungen und Interaktionen.
Schroer beleuchtet auch die Grenzen, die im Cyberspace entstehen. Er zeigt, dass der Cyberspace nicht grenzenlos ist, sondern durch Passwörter, Eintrittsgebühren und Filtersoftwares reguliert wird. Er bezieht sich auf die Studie von Arnold van Gennep, die die Riten des Übergangs in eine neue Welt beschreibt, und wendet diese auf den Cyberspace an. Er stellt fest, dass der Eintritt in den Cyberspace durch den Mangel an Zeit zu einem Wegfall von Schwellenriten führt.
Schließlich diskutiert Schroer die Ernüchterung, die im Netz entstanden ist. Die Hoffnung, im Cyberspace einen neuen Raum zu finden, „den Anderen“, hat sich nicht bestätigt. Gesellschaftsgruppen, die im realen Raum benachteiligt sind, bleiben es auch im Cyberspace. Schroer argumentiert, dass der Cyberspace nicht nur das Reale widerspiegelt, sondern auch das Reale beeinflusst. Er führt den Vergleich zwischen Meer/Land und Real/Virtuell an und beschreibt die Entstehung von hybriden Räumen, die sich immer weniger voneinander unterscheiden lassen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Cyberspace, die Grenzen zwischen realem und virtuellem Raum, Metaphern für das Cyberspace, die Entgrenzung der Gesellschaft, Riten im Cyberspace, die Ernüchterung im Netz und hybride Räume. Der Text beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Verschmelzung von realem und virtuellem Raum ergeben, und untersucht die Auswirkungen des Cyberspace auf die Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Entgrenzung der Gesellschaft" durch das Internet?
Es bezeichnet die Aufhebung geografischer, zeitlicher und kultureller Barrieren, die es ermöglicht, Informationen unabhängig vom Standort in Echtzeit auszutauschen.
Welche Metaphern werden für den Cyberspace verwendet?
Gängige Metaphern sind die "Datenautobahn", das "Global Village" oder die "Digitale Stadt", wobei Markus Schroer diese kritisch auf ihre Unzulänglichkeit prüft.
Gibt es echte Grenzen im Cyberspace?
Ja, trotz der scheinbaren Grenzenlosigkeit wird der Raum durch Passwörter, Filtersoftwares und Eintrittsbarrieren reguliert und kontrolliert.
Was sind hybride Räume?
Hybride Räume entstehen durch die Verschmelzung von realem und virtuellem Raum, sodass beide Ebenen sich gegenseitig beeinflussen und kaum noch trennbar sind.
Warum kam es zur "Ernüchterung im Netz"?
Die Hoffnung auf eine vollkommen freie, gerechtere Welt im Cyberspace erfüllte sich nicht, da soziale Ungleichheiten des realen Raums oft in die virtuelle Welt übertragen wurden.
- Quote paper
- Joana Lissmann (Author), 2009, „Raumgrenzen in Bewegung - Zur Interpretation realer und virtueller Räume“ von Markus Schroer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184817