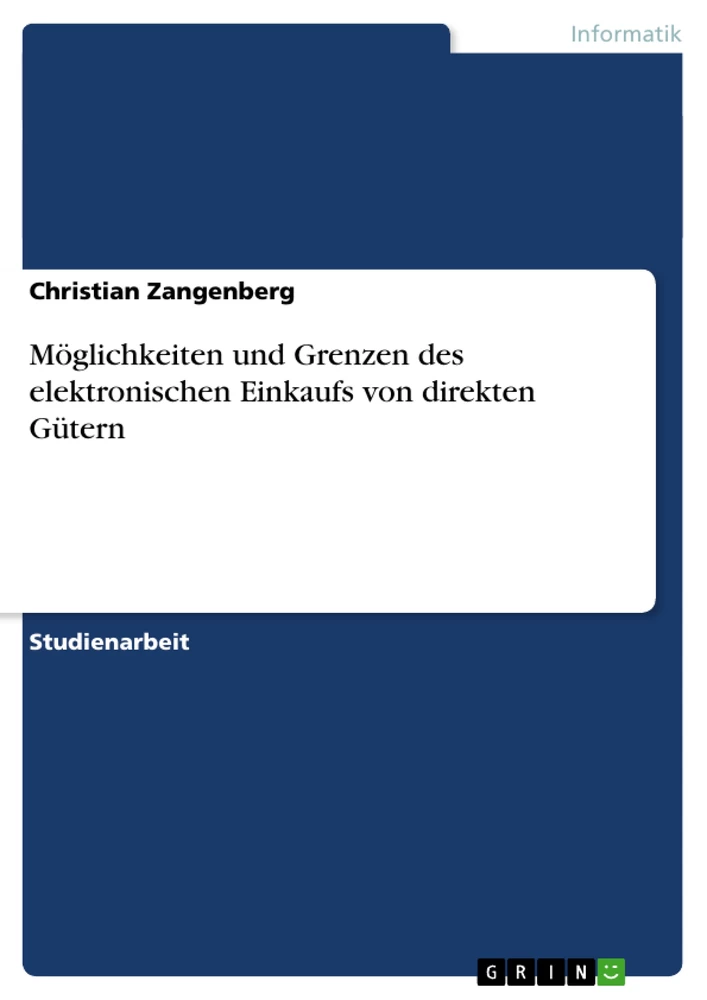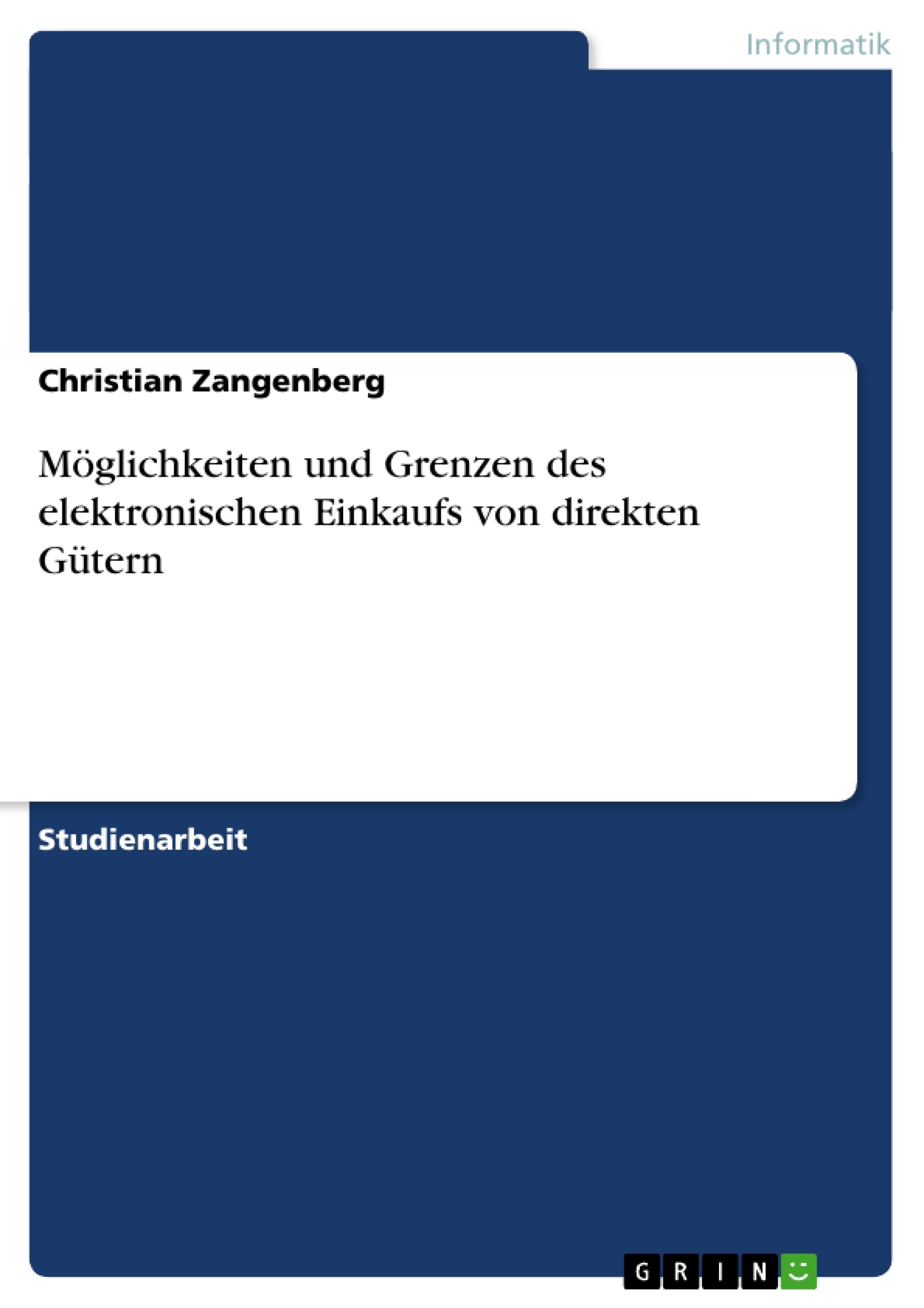Das Electronic Business, besser bekannt als E-Business, verändert in zunehmenden Maße die heutigen Unternehmensstrukturen. Es gibt kaum noch einen Bereich der ohne das Internet auskommt. Insbesondere bei den Abläufen von Geschäftsprozesse wird dieser Wandel immer deutlicher. Deutschland ist dabei gerade erst im Anfangsstadium. Vergleiche mit den Vereinigten Staaten haben gezeigt, das die IT-Branche 1 hierzulande ungefähr drei bis vier Jahre mit der Entwicklung und Nutzung neuer Technologien im Rückstand ist. Diesen Wettbewerbsnachteil aufzuholen wird immer mehr zum Bestreben vieler Unternehmen. 2
War bis vor kurzem noch die reine Informationsbeschaffung Mittelpunkt der Internetnutzung, verlagert sich der Schwerpunkt jetzt immer mehr auf die Reorganisation des gesamten Geschäftsprozesses mit Hilfe von E-Business Lösungen.
Insbesondere die Beschaffungsprozesse bieten eine gute Basis für diese Umstrukturierung. Kein anderer Bereich bietet bessere Möglichkeiten, das ständig wachsende Kommunikationsnetz zu einer Reduktion von Kosten zu nutzen. Bereits heute planen laut einer Studie der KPMG-Consulting 85% aller befragten deutschen Unternehmen in 3 Jahren E-Business Anwendungen im Bereich der Beschaffung einzusetzen. 3 Das sog. E-Procurement ist dabei der Lösungsansatz. Prozesse werden durch dieses Konzept beschleunigt und Ihre Komplexität wesentlich vereinfacht. Kostenreduktionen in einer Größenordnung von 35 bis 65% sollen somit erreicht werden. 4
Allerdings ist der Weg dorthin nicht ganz einfach. Nicht jedes Gut, das für den reibungslosen Ablauf eines Unternehmens benötigt wird, lässt sich einfach über das Internet bestellen. Um den Einsatz des E-Procurement möglichst effektiv zu gestalten sind umfassende Maßnahmen nötig. Dies reicht von der Reorganisation [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Arten von Gütern
- 2.2 E-Procurement – Definition und Bestandteile
- 3 Internetbasierte Beschaffung von Direkten Gütern
- 3.1 Direct Purchasing
- 3.2 Ausschreibungen vs. Auktionen
- 3.3 Elektronische Marktplätze
- 4 Bewertung der Systeme in Bezug auf Direkte Güter
- 4.1 Anforderungen an den Geschäftsprozess
- 4.2 Kosten/Nutzen Analyse
- 5 Zusammenfassung
- 6 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen des elektronischen Einkaufs von direkten Gütern. Sie analysiert die Eignung des E-Procurement für die Beschaffung von direkten Gütern und beleuchtet die Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen dieser Technologie.
- Unterscheidung von direkten und indirekten Gütern im Beschaffungsprozess
- Definition und Bestandteile von E-Procurement
- Einsatz von E-Procurement für den Einkauf von direkten Gütern
- Bewertung der verschiedenen E-Procurement Systeme in Bezug auf Kosten und Nutzen
- Zusammenfassung der Ergebnisse und mögliche Entwicklungstendenzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema E-Business und seine wachsende Bedeutung für Unternehmen ein. Sie hebt die Bedeutung von E-Procurement für die Reorganisation von Geschäftsprozessen hervor, insbesondere in Bezug auf die Beschaffung.
- Kapitel 2 Grundlagen: Dieses Kapitel definiert die verschiedenen Arten von Gütern, die in Unternehmen beschafft werden, mit Schwerpunkt auf die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Gütern. Es erklärt außerdem den Begriff E-Procurement und seine Rolle im Kontext von E-Business.
- Kapitel 3 Internetbasierte Beschaffung von Direkten Gütern: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Ansätze für den Einkauf von direkten Gütern über das Internet, einschließlich Direct Purchasing, Ausschreibungen und Auktionen sowie elektronischen Marktplätzen.
- Kapitel 4 Bewertung der Systeme in Bezug auf Direkte Güter: Dieses Kapitel bewertet die verschiedenen E-Procurement-Systeme in Bezug auf ihre Anwendbarkeit für den Einkauf von direkten Gütern. Es berücksichtigt die Anforderungen an den Geschäftsprozess und analysiert die Kosten und den Nutzen der verschiedenen Systeme.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen E-Procurement, Beschaffung von direkten Gütern, E-Business, Kosten/Nutzen Analyse, elektronische Marktplätze, Direct Purchasing und Ausschreibungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „direkte Güter“ im Einkauf?
Direkte Güter gehen unmittelbar in das Endprodukt des Unternehmens ein (z.B. Rohstoffe, Bauteile), im Gegensatz zu indirekten Gütern wie Büromaterial.
Was ist E-Procurement?
Der elektronische Einkauf von Gütern und Dienstleistungen über das Internet zur Beschleunigung und Vereinfachung von Beschaffungsprozessen.
Welche Vorteile bietet E-Procurement für direkte Güter?
Es ermöglicht Kostenreduktionen von 35 % bis 65 %, beschleunigt die Kommunikation mit Lieferanten und vereinfacht komplexe Bestellvorgänge.
Was ist der Unterschied zwischen Ausschreibungen und Auktionen?
Ausschreibungen dienen der Einholung von Angeboten; Auktionen (oft Reverse Auctions) führen zu einem direkten Preiswettbewerb unter Lieferanten in Echtzeit.
Welche Rolle spielen elektronische Marktplätze?
Sie bündeln Angebot und Nachfrage auf einer Plattform und erleichtern Unternehmen den Zugang zu einer größeren Lieferantenbasis.
Warum hinkt Deutschland bei E-Business-Lösungen hinterher?
Vergleiche zeigen einen Rückstand von drei bis vier Jahren gegenüber den USA bei der Entwicklung und Nutzung neuer IT-Technologien in Geschäftsprozessen.
- Quote paper
- Christian Zangenberg (Author), 2001, Möglichkeiten und Grenzen des elektronischen Einkaufs von direkten Gütern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18484