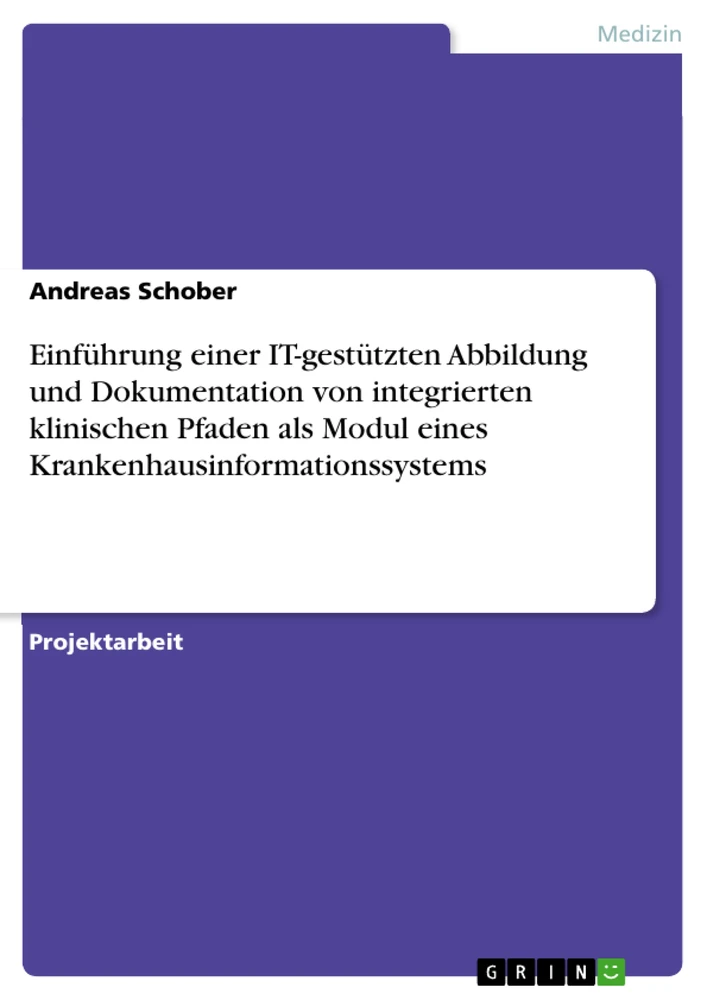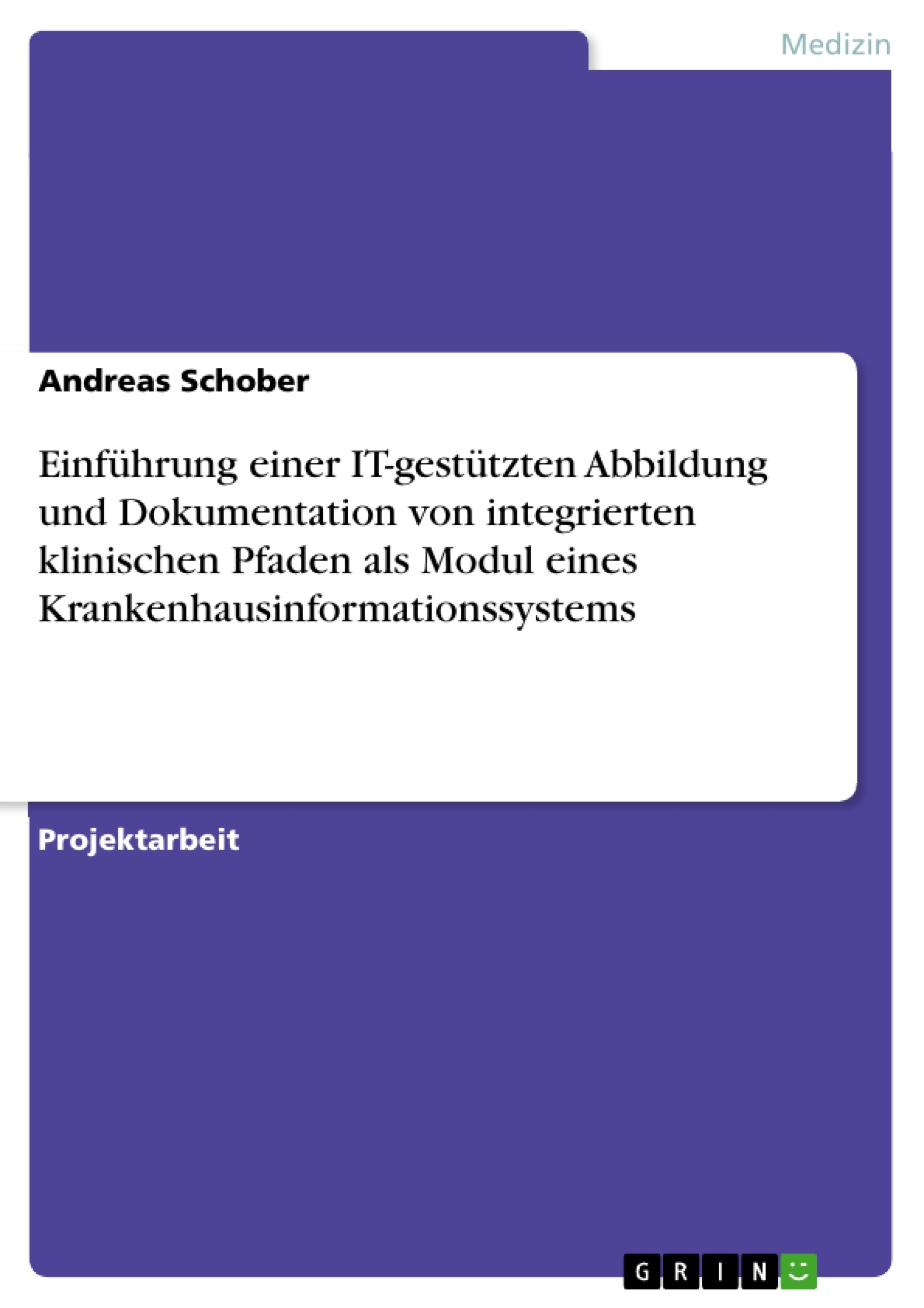In der Projektarbeit werden die Bestandteile des Projektmanagements, der Verlauf und eine ausführliche Reflexion des Projekts der IT-gestützten Abbildung und Dokumentation von klinischen Pfaden beschrieben.
Folgend werden die Projektplanung und die Zusammenfassung präsentiert. Zusätzlich soll diese Arbeit aufzeigen, welche Chancen und Risiken in einer interprofessionellen Projektgruppe liegen.
Die elektronische Datenverarbeitung und die damit verbundene Verwendung von PC Arbeitsplätzen stellen die klinischen Mitarbeiter heute vor große Herausforderungen. Zu Beginn war der klinische Einsatz der IT auf die Arztbriefschreibung und das Verschlüsseln von Diagnosen und Prozeduren beschränkt.
In technisierten klinischen Bereichen sowie Einheiten, welche mit einer hohen Datenflut zu kämpfen haben (z.B. Intensivmedizin), hielt der Computer schon sehr früh Einzug. In den anderen klinischen Bereichen begnügte man sich mit papiergebundenen Lösungen. Tatsächlich war der Markt nicht vorhanden und die Technik bezüglich der Mobilität der Hardware stand in keinem wirtschaftlichen Verhältnis, bzw. war noch nicht verfügbar. In den letzten Jahren sind zahlreiche Anbieter für Krankenhaus-informationssysteme (KIS) mit pflegerischen Modulen und Dateneingabemedien entstanden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung und Vorbemerkungen
- 1.1 Ausgangssituation
- 1.2 Vorstellung des Projektthemas
- 1.3 Entscheidungsgründe für dieses Projektthema
- 1.4 Organisationsstruktur des Klinikums
- 1.5 Begriffliche Grundlagen
- 1.6 Softwarebeschreibung
- 2 Projektvorbereitung
- 2.1 Projektidee
- 2.2 Problemanalyse
- 2.3 Projektziel
- 2.4 Projektauftrag
- 3 Projektplanung
- 3.1 Projektstrukturplan
- 3.2 Terminplan und Projektablaufplan
- 3.3 Projektorganisation
- 3.4 Ressourcen- und Kostenplanung
- 3.5 Meilensteine
- 3.6 Risikobewertung
- 3.7 Projektablauf
- 4 Projektleitung
- 4.1 Motivation und Moderation der Projektgruppe
- 4.2 Projektsteuerung
- 4.3 Methoden der Projektbegleitung
- 5 Projektabschluss
- 5.1 Mitarbeiterschulung
- 5.2 Change Management
- 5.3 Einführungskontrolle
- 5.4 Projektauflösung
- 6 Reflexion
- 6.1 Fazit
- 6.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Einführung einer IT-gestützten Abbildung und Dokumentation von integrierten klinischen Pfaden als Modul eines Krankenhausinformationssystems. Das Ziel der Arbeit ist es, die Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Implementierung eines solchen Systems im klinischen Alltag zu beleuchten.
- Analyse der Ausgangssituation und der Entscheidungsgründe für die Einführung eines IT-gestützten Pfadesystems
- Beschreibung der Projektorganisation und der Planungsschritte zur erfolgreichen Implementierung
- Bewertung der relevanten IT-Systeme und Softwarelösungen im Kontext der klinischen Pfade
- Diskussion der Herausforderungen bei der Einführung des Systems, insbesondere im Hinblick auf die Akzeptanz der Mitarbeiter und das Change Management
- Bewertung der Auswirkungen der Einführung eines IT-gestützten Pfadesystems auf die Effizienz und Qualität der Pflege im Klinikum
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Ausgangssituation im Klinikum dargestellt und das Projektthema, die Einführung eines IT-gestützten Pfadesystems, vorgestellt. Die Entscheidungsgründe für das Projekt werden analysiert und die Organisationsstruktur des Klinikums erläutert. Kapitel zwei befasst sich mit der Vorbereitung des Projekts, einschließlich der Projektidee, der Problemanalyse, dem Projektziel und dem Projektauftrag.
Kapitel drei widmet sich der Projektplanung, inklusive des Projektstrukturplans, des Terminplans, der Projektorganisation und der Ressourcen- und Kostenplanung. Die Meilensteine, die Risikobewertung und der Projektablauf werden ebenfalls diskutiert.
Kapitel vier behandelt die Projektleitung, insbesondere die Motivation und Moderation der Projektgruppe, die Projektsteuerung und die Methoden der Projektbegleitung.
Schlüsselwörter
Krankenhausinformationssystem, integrierte klinische Pfade, IT-gestützte Pfadsysteme, Projektmanagement, Change Management, Mitarbeiterschulung, Effizienz, Qualität, Pflege
Häufig gestellte Fragen
Was sind integrierte klinische Pfade?
Klinische Pfade sind fächerübergreifende Behandlungsabläufe im Krankenhaus, die den optimalen Prozess für eine bestimmte Diagnose oder Prozedur definieren und dokumentieren.
Warum wird eine IT-gestützte Dokumentation eingeführt?
Die IT-Unterstützung soll die Effizienz steigern, die Qualität der Pflege verbessern und die bisher oft papiergebundenen Lösungen durch moderne Krankenhausinformationssysteme (KIS) ersetzen.
Welche Rollen spielen Projektmanagement und Change Management?
Projektmanagement sichert die Planung und Termineinhaltung, während Change Management entscheidend ist, um die Akzeptanz der Mitarbeiter für die neuen digitalen Arbeitsabläufe zu gewinnen.
Welche Risiken gibt es bei solchen IT-Projekten im Klinikum?
Zu den Risiken gehören technische Hürden bei der Hardware-Mobilität, Widerstände in der Belegschaft gegen neue Software sowie die Bewältigung der hohen Datenflut im klinischen Alltag.
Wie erfolgt die Schulung der Mitarbeiter?
Die Projektarbeit sieht gezielte Mitarbeiterschulungen vor, um den Umgang mit den neuen pflegerischen Modulen des KIS sicherzustellen und die Fehlerquote zu minimieren.
Was ist ein Projektstrukturplan im Krankenhauskontext?
Es ist eine hierarchische Darstellung aller Aufgaben, die für die Einführung der Pfaddokumentation nötig sind, unterteilt in Phasen wie Vorbereitung, Planung, Leitung und Abschluss.
- Quote paper
- Andreas Schober (Author), 2011, Einführung einer IT-gestützten Abbildung und Dokumentation von integrierten klinischen Pfaden als Modul eines Krankenhausinformationssystems, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184865