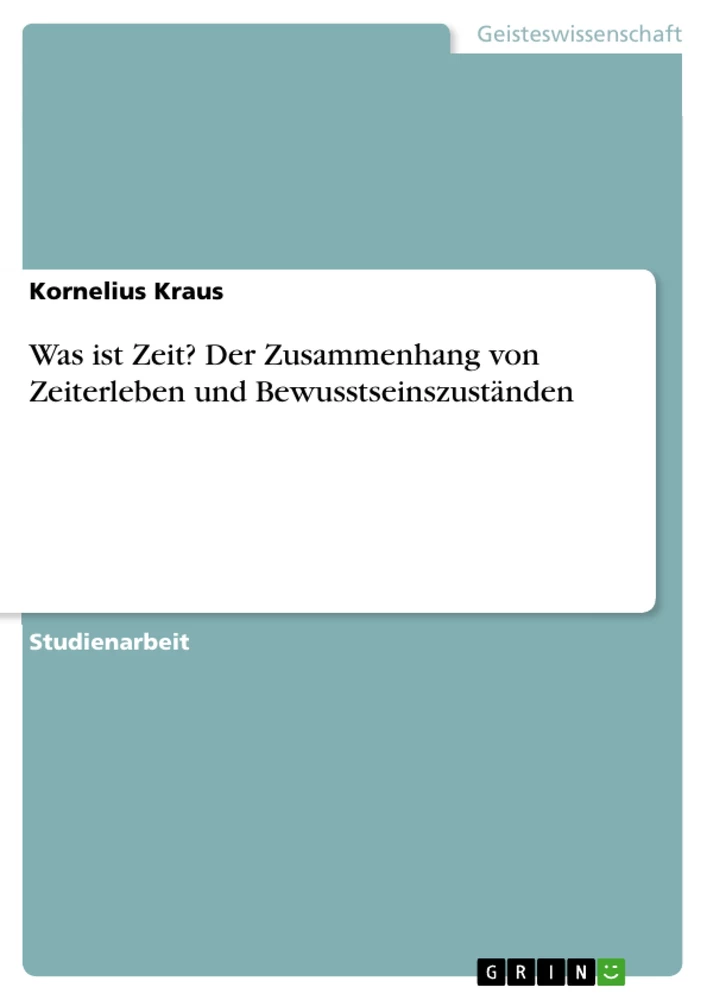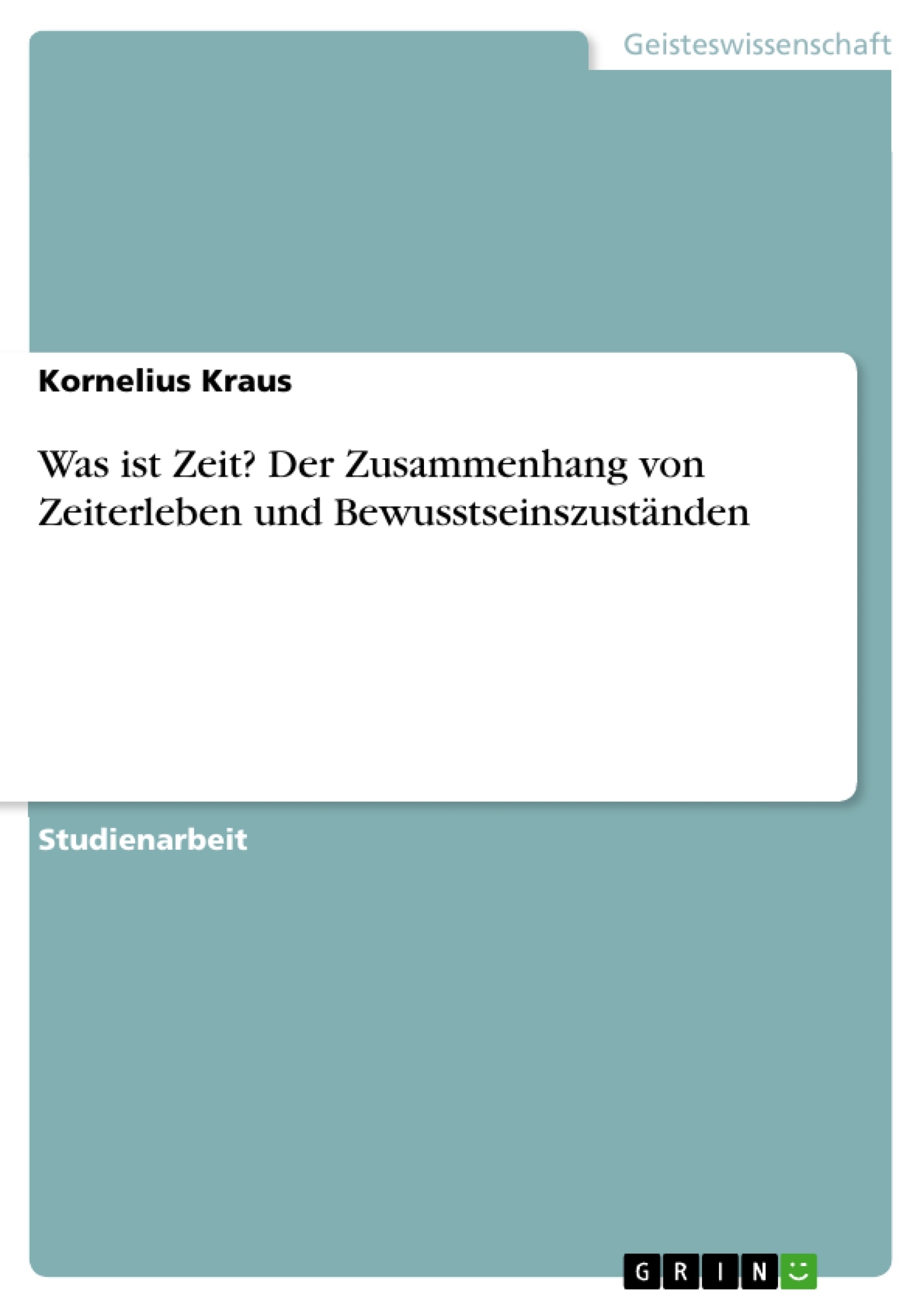Das menschliche Leben kann für die Wahrnehmung mit einem Anfang und einem Ende skizziert werden. Ebenso hat jeder Tag in unserer Zeitrechnung einen Anfang und ein Ende. Im Unterschied dazu ist das Lebensende in der Regel offen gestaltet. Laut Statistik (Weltbank, 2009) drehen sich die Deutschen circa 80 Jahre oder 29200 Tage mit der Erde.
Für die Beschreibung von Zeit und Bewusstsein eignen sich komplexe Systeme. Denn das Phänomen des Zeitbewusstseins hängt eng mit der Dynamik von Bewusstseinszuständen des Gehirns zusammen. Basierend auf der Komplexitätstheorie wird das Bewusstsein charakterisiert, die Gehirnenergetik sowie die synaptische Plastizität erklärt, welche das tragende Element für die Selbstorganisation des Menschen ist. Mainzer (2005) weißt daraufhin, dass dieses Zeitbewusstsein nicht im Gegensatz zur Physik stehe, und als Ergebnis der komplexen neuronalen Wechselwirkungsprozesses erklärbar sei. Dadurch werden Konfrontationen wie die zwischen Bergson und Einstein überflüssig, da jene Ebenen nicht vergleichbar sind. Im Gegensatz zur traditionellen Physik ist die Zeit für die Intelligenz unterschiedlich erfahrbar. Einstein zerstörte die alte Idee der absoluten Zeit. Mit der Relativitätstheorie stieß er das Fundament der klassischen Physik um. Seitdem sind Raum und Zeit miteinander verwandt. Das Konzept der Zeitdehnung oder die Idee von Wurmlöchern wurden für die Wissenschaftler existent (Coveney und Highfield, 1994), allerdings ist die Theorie komplexer Systeme fern des thermischen Gleichgewichts als Erklärungsversuch zu verstehen und das Bewusstsein wird demzufolge als ein globaler makroskopischer Ordnungszustand von neuronalen Verschaltungsmuster verstanden, die durch lokale mikroskopische Wechselwirkungen in komplexen neuronalen Netzen entstünden (Mainzer, 2005).
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundlagen der Neurophysiologie aus der Perspektive der Komplexitätstheorie
- Synaptische Plastizität und der Weg als Ziel
- Zeiterlebnis und die Emergenz des Bewusstseins
- Charakteristik des Bewusstseins
- Emotion
- Konstitutions-Merkmale von Emotionen
- Emotionen und Stimmungen
- Emotionsverarbeitung im limbischen Gehirn
- Kreativer und effizienter Rechner
- Computerzeit und künstliche Intelligenz
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Zeit und Bewusstsein aus der Perspektive der Neurophysiologie und Komplexitätstheorie. Ziel ist es, die Beziehung zwischen Zeitwahrnehmung, neuronalen Prozessen und der Entstehung des Bewusstseins zu erforschen. Dabei werden die Grundlagen der Neurophysiologie aus der Sicht der Komplexitätstheorie beleuchtet, die Rolle der synaptischen Plastizität für die Selbstorganisation des Gehirns hervorgehoben und die Charakteristik des Bewusstseins, insbesondere im Hinblick auf Emotionen, untersucht.
- Zeitwahrnehmung und Bewusstseinszustände
- Komplexitätstheorie und Selbstorganisation des Gehirns
- Synaptische Plastizität und Lernen
- Emergenz des Bewusstseins und die Rolle von Emotionen
- Vergleich zwischen Gehirn und Computer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Zeit und Bewusstsein ein und skizziert die Relevanz der Komplexitätstheorie für die Erforschung dieser Phänomene. Das zweite Kapitel beleuchtet die Grundlagen der Neurophysiologie aus der Perspektive der Komplexitätstheorie und erklärt die Bedeutung von neuronalen Netzwerken und Selbstorganisation für das Gehirn. Das dritte Kapitel widmet sich der synaptischen Plastizität und ihrer Rolle für das Lernen und die Anpassungsfähigkeit des Gehirns. Das vierte Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Zeiterlebnis und der Entstehung des Bewusstseins, wobei die Bedeutung von neuronalen Verschaltungsmustern und der Dynamik von Bewusstseinszuständen hervorgehoben wird. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Charakteristik des Bewusstseins, insbesondere mit der Rolle von Emotionen und ihrer Verarbeitung im limbischen Gehirn. Die Kapitel sechs und sieben behandeln die Leistungsfähigkeit des Gehirns im Vergleich zu Computern und die Frage nach künstlicher Intelligenz. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Zeitwahrnehmung, Bewusstsein, Neurophysiologie, Komplexitätstheorie, Synaptische Plastizität, Selbstorganisation, Emotionen, Gehirn, Computer, künstliche Intelligenz.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Zeitwahrnehmung und Gehirn zusammen?
Zeitwahrnehmung ist ein Ergebnis komplexer neuronaler Wechselwirkungsprozesse. Das Gehirn konstruiert Zeitbewusstsein durch die Dynamik von Bewusstseinszuständen.
Was ist synaptische Plastizität?
Es ist die Fähigkeit von Synapsen, ihre Stärke je nach Nutzung zu verändern. Dies ist die biologische Grundlage für Lernen, Gedächtnis und die Selbstorganisation des Gehirns.
Welche Rolle spielt das limbische System bei Emotionen?
Das limbische System ist die zentrale Schaltstelle für die Verarbeitung von Emotionen und Stimmungen, die wiederum unsere Wahrnehmung von Zeit stark beeinflussen können.
Was besagt die Komplexitätstheorie über das Bewusstsein?
Bewusstsein wird als ein globaler Ordnungszustand verstanden, der aus den mikroskopischen Wechselwirkungen in komplexen neuronalen Netzen hervorgeht (Emergenz).
Kann man das menschliche Gehirn mit einem Computer vergleichen?
Während Computer seriell und fest verdrahtet arbeiten, ist das Gehirn ein selbsterregendes, plastisches System, das Informationen parallel und kontextabhängig verarbeitet.
- Quote paper
- Diplom-Sportwissenschaftler Kornelius Kraus (Author), 2011, Was ist Zeit? Der Zusammenhang von Zeiterleben und Bewusstseinszuständen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184888