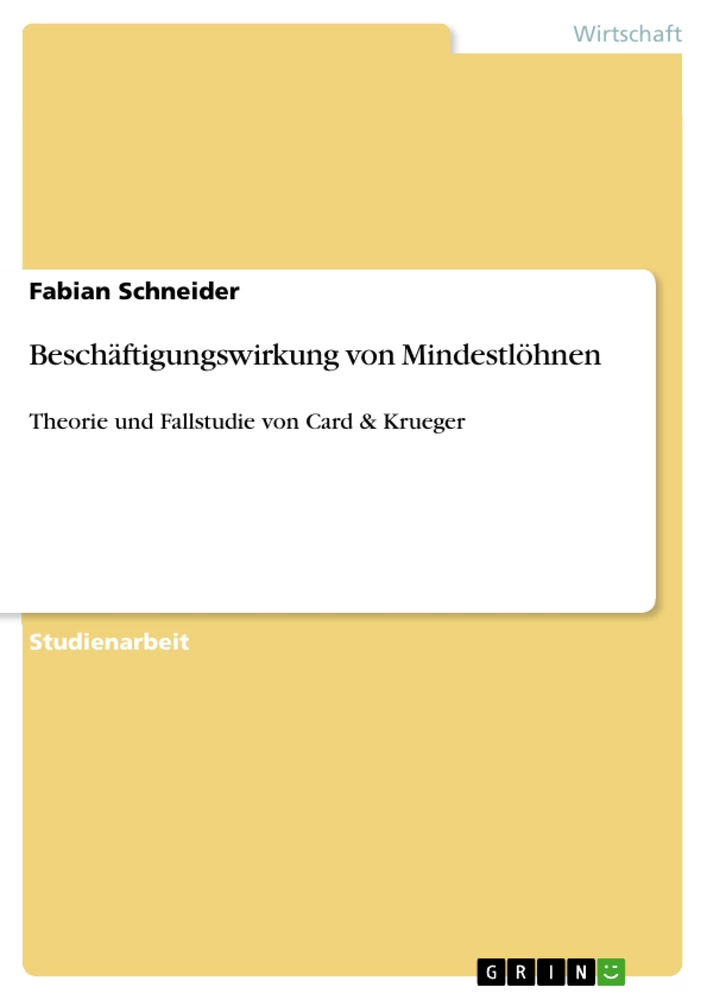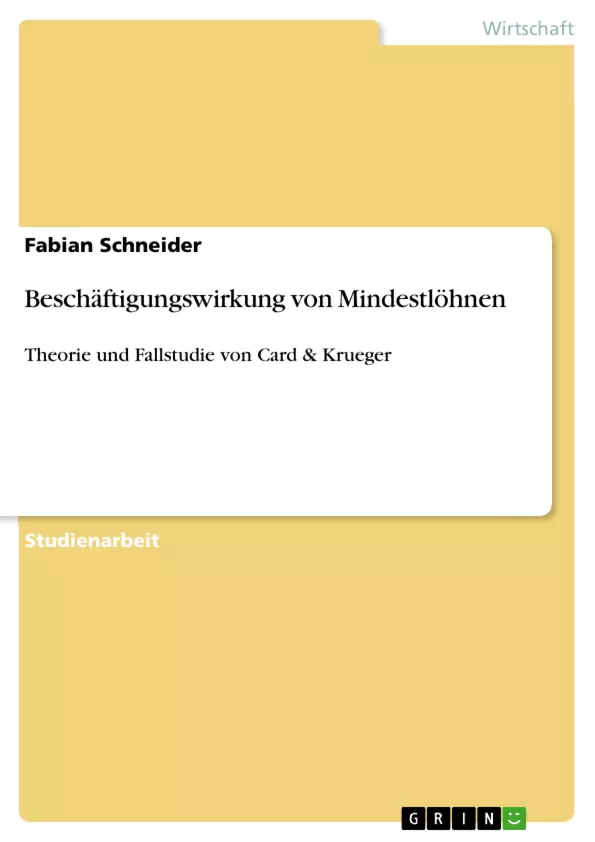Um aber das unerschöpfliche Reservoir der Lohn- und Arbeitsmarkdebatten sinnvoll
einzugrenzen, werde ich mich im Weiteren rein mit Mindestlöhnen und ihren
Effekten auf den Arbeitsmarkt, und hier speziell auf die Beschäftigung, befassen.
Selbst diese Beschränkung auf bietet noch genug Stoff für eine profunde Analyse.
Denn allein die Differenzierung in obiger zweiter Studie (genereller vs.
branchenspezifischer Mindestlohn) zeigt schon die Problematik einer oberflächlichen
Betrachtung dieses Themas.
Die Basis für eine tiefergehende Analyse bildet eine kurze Erläuterung von Inhalt
und Form des Begriffs „Mindestlohn“, inklusive der rivalisierenden Theorien dazu,
besonders der Neoklassischen Theorie und der Monopsonmarkt-Theorie, die jeweils
unterschiedliche Wirkungen von Mindestlohnkonzepten voraussagen.
Doch Theorien müssen bestätigt oder widerlegt werden, und so befand der intensiv
mit diesem Thema beschäftigte Alan Manning 2003: „The impact of minimum wages
on employment should primarily be an empirical issue...“[2] Daher werden hier zwei
konkrete Fallstudien vorgestellt, die beide zwar verschiedene Ergebnisse, aber die
selbe (Daten-)Grundlage haben – die Erhöhung des staatlichen Mindestlohns in New
Jersey im Jahr 1992. Die zweite Studie „evaluiert“ hierbei die erste, kritisiert diese
und ergänzt sie – und schafft so einen zweiten Standpunkt.
Allein die unterschiedlichen Ergebnisse dieser Autoren, untermauert von vielen
weiteren Studienergebnissen, zeigen am Ende, wie uneinig der Forschungsstand hier
ist. Es bieten sich also durchaus einige Ansatzpunkte für die weitere Forschung, die
ich ebenfalls darzulegen versuchen werde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie des Mindestlohns
- Begriff u. Entwicklung
- Neoklassische Theorie
- Monopsonmarkt-Theorie
- Andere Arbeitsmarkttheorien
- Fallstudie von Card u. Krueger
- Rahmenbedingungen
- Untersuchungsmethodik
- Ergebnisse der Studie
- Validität der Ergebnisse
- Kritik von Neumark u. Wascher
- Ansatz- u. Kritikpunkte
- Untersuchungsmethodik
- Ergebnisse der Studie
- Validität der Ergebnisse
- Konklusion
- Schlussfolgerungen
- Ausblick
- Tabellen- u. Schaubildverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Beschäftigungswirkung von Mindestlöhnen. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen des Mindestlohns zu beleuchten und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt anhand von empirischen Studien zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Neoklassische Theorie und die Monopsonmarkt-Theorie, die unterschiedliche Effekte von Mindestlöhnen prognostizieren.
- Begriff und Entwicklung des Mindestlohns
- Theoretische Modelle zur Erklärung der Beschäftigungswirkung von Mindestlöhnen
- Empirische Studien zur Analyse der Beschäftigungswirkung von Mindestlöhnen
- Kritik an den empirischen Studien und deren Validität
- Schlussfolgerungen und Ausblick auf weitere Forschungsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Mindestlohn im Kontext der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise dar und beleuchtet die öffentliche Diskussion um die Einführung eines Mindestlohns in Deutschland.
Das zweite Kapitel widmet sich der Theorie des Mindestlohns. Es werden der Begriff und die Entwicklung des Mindestlohns erläutert, sowie die neoklassische Theorie und die Monopsonmarkt-Theorie vorgestellt, die unterschiedliche Effekte von Mindestlöhnen auf den Arbeitsmarkt prognostizieren.
Das dritte Kapitel analysiert die Fallstudie von Card und Krueger, die die Auswirkungen der Erhöhung des staatlichen Mindestlohns in New Jersey im Jahr 1992 untersucht. Die Studie zeigt, dass die Erhöhung des Mindestlohns zu keiner signifikanten Reduktion der Beschäftigung führte.
Das vierte Kapitel präsentiert die Kritik von Neumark und Wascher an der Studie von Card und Krueger. Die Autoren argumentieren, dass die Studie methodische Schwächen aufweist und die Ergebnisse nicht verallgemeinerbar sind.
Die Konklusion fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Schlussfolgerungen für die weitere Forschung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Mindestlohn, die Beschäftigungswirkung, die Neoklassische Theorie, die Monopsonmarkt-Theorie, empirische Studien, Fallstudien, Kritik, Validität, Schlussfolgerungen und Ausblick.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirken sich Mindestlöhne auf die Beschäftigung aus?
Die Auswirkungen sind umstritten. Während die neoklassische Theorie Beschäftigungsrückgänge voraussagt, sieht die Monopsonmarkt-Theorie unter bestimmten Bedingungen sogar positive Effekte.
Was besagt die neoklassische Theorie zum Mindestlohn?
Sie geht davon aus, dass ein Mindestlohn über dem Gleichgewichtspreis zu einem Überangebot an Arbeit und damit zu Arbeitslosigkeit führt, da Unternehmen weniger Personal einstellen.
Was ist die Monopsonmarkt-Theorie?
In einem Monopson (einem Markt mit nur einem großen Arbeitgeber) kann ein Mindestlohn die Beschäftigung erhöhen, da er die Marktmacht des Arbeitgebers einschränkt.
Welche Erkenntnisse lieferte die Fallstudie von Card und Krueger?
Die Untersuchung der Mindestlohnerhöhung in New Jersey 1992 ergab überraschenderweise keine signifikante Reduktion der Beschäftigung in der Fast-Food-Branche.
Warum kritisieren Neumark und Wascher diese Studie?
Sie bemängeln die Datengrundlage und Methodik und kommen in ihrer eigenen Analyse zu dem Schluss, dass Mindestlöhne sehr wohl negative Auswirkungen auf die Beschäftigung haben.
- Quote paper
- Fabian Schneider (Author), 2008, Beschäftigungswirkung von Mindestlöhnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184898