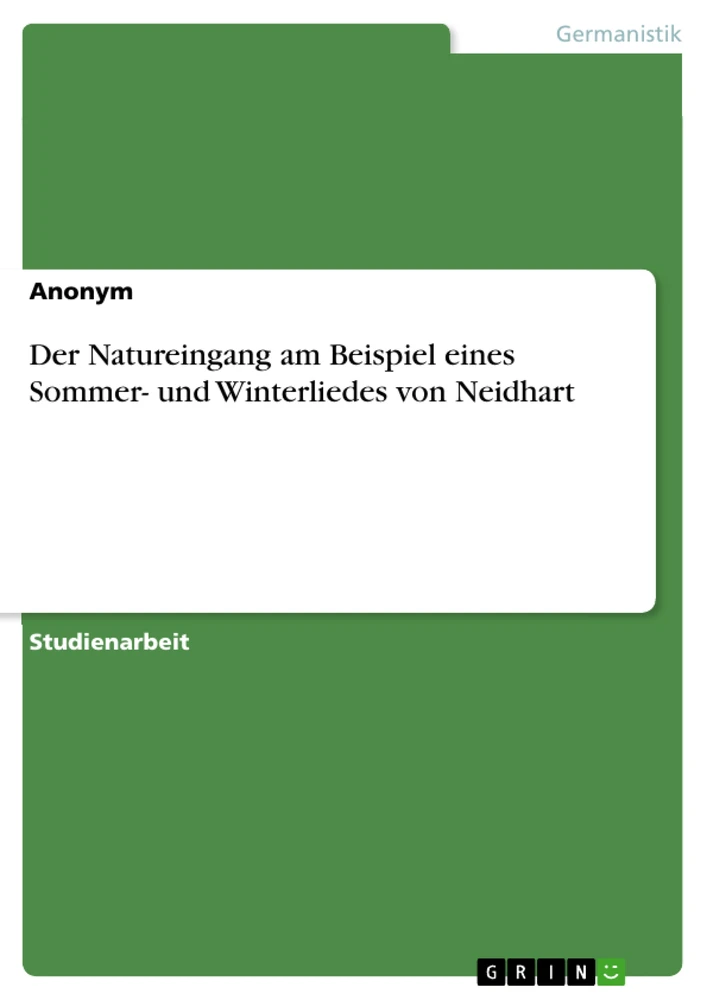Beim Lesen von Minneliedern ist auffallend, dass einige Minnesänger in ihren Liedern gerne einleitend Bezug auf die Natur und deren Erscheinungen nehmen. Die literarische Einleitung mittels Natur- und Jahreszeitenbildern wurde bereits in der antiken Rhetorik verwendet. „Dabei werden Jahreszeiten oft als Folie für den Gemütszustand des lyrischen Ichs beschworen: gleichsinnig, etwa als Erwachen der Natur und der Lebens- und Liebesfreude (Sommerfreude-Minnefreude) […]. Die Jahreszeiten werden in dreifacher Weise eingesetzt: als Natureingang (bes. häufig im 13. Jh.), als Jahreszeitenapostrophe, oft im Natureingang […] und am häufigsten als kurzer Jahreszeitenbezug […].“
Verschiedene Phänomene und Vorkommnisse der Natur als Einleitungstopos werden dabei genutzt, um eine Stimmung zu etablieren. Bei Neidhart von Reuental haben diese Mittel allerdings eine viel weitreichendere Bedeutung: „Die ersten sommerlichen Natureingänge gestaltet Dietmar […], motivlich erweitert dann etwa Walther […]. Neidhart baut den […] Natureingang zum gattungsstiftenden Prinzip aus und erweitert diese Grundelemente nochmals […].“
Hier erscheinen besonders die Unterschiede zwischen Sommer- und Winterliedern interessant, da die Liebe in die Natur und in die Jahreszeit eingebettet ist.
Welche große Rolle der Natureingang in seinen Liedern spielt, soll in dieser Arbeit anhand zweier Lieder Neidharts, dem Sommerlied 19 und dem Winterlied 6, aufgezeigt werden.
In der Forschung wurde der Begriff der Naturlieder im Minnesang u.a. von Günther Schweikle ausgearbeitet. Intensiv beschäftigten sich mit dem Natureingang Anna Kathrin Bleuler, Barbara von Wulffen, Wolfgang Adam und Jessica Warning. Motive der Erotik bei Neidhart behandelte u.a. Bruno Fritsch; Richard Alewyn stellte Überlegungen zum Naturalismus bei Neidhart an. Eine neuhochdeutsche Übersetzung, die hier herangezogen wird, lieferte Siegfried Beyschlag. Auffallend ist, dass zum Natureingang der Sommerlieder weit mehr Forschungsliteratur vorhanden ist, als zu den Winterliedern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Natureingang bei Neidhart
- Sommerlied 19
- Aufbau und inhaltlicher Überblick
- Die bewirkte Stimmung
- Der Handlungsraum
- Die erzielte Vorausdeutung
- Winterlied 6
- Aufbau und inhaltlicher Überblick
- Die bewirkte Stimmung
- Der Handlungsraum
- Die Vorausdeutung
- Sommerlied 19
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Natureingangs in den Liedern Neidharts von Reuental. Anhand eines Sommer- und eines Winterliedes wird analysiert, wie die Naturbeschreibung die Stimmung des jeweiligen Liedes prägt und welche Rolle sie im Gesamtkontext spielt. Der Fokus liegt auf der Vergleichenden Analyse der unterschiedlichen Funktionen des Natureingangs in verschiedenen Jahreszeiten.
- Die Funktion des Natureingangs in der Minnelyrik Neidharts
- Der Vergleich von Sommer- und Winterliedern im Hinblick auf den Natureingang
- Die Darstellung von Stimmung und Handlungsraum durch die Naturbeschreibung
- Die Rolle des Natureingangs in der Vorausdeutung der Handlung
- Der Einfluss der Naturbeschreibung auf die Interpretation der Liebeslyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Natureingangs in der Minnelyrik ein und erläutert die Bedeutung dieser literarischen Technik. Sie beschreibt die Verwendung von Natur- und Jahreszeitenbildern als Einleitungstopos, insbesondere im 13. Jahrhundert, und hebt die besondere Bedeutung des Natureingangs bei Neidhart von Reuental hervor. Die Arbeit kündigt die Analyse zweier Lieder Neidharts an: eines Sommer- und eines Winterliedes, um die Rolle des Natureingangs zu untersuchen und die Unterschiede zwischen beiden Liedtypen herauszuarbeiten. Die Einleitung verweist auf relevante Forschungsliteratur zu diesem Thema.
Der Natureingang bei Neidhart: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert den Natureingang in zwei Liedern Neidharts, einem Sommerlied (Nr. 19) und einem Winterlied (Nr. 6). Es werden Aufbau, Stimmung, Handlungsraum und Vorausdeutung in beiden Liedern im Detail untersucht und verglichen. Die Analyse beleuchtet, wie Neidhart den Natureingang als gattungsstiftendes Prinzip einsetzt und wie die Naturbeschreibung die Stimmung und die Handlung der Lieder beeinflusst. Der Vergleich zwischen Sommer- und Winterliedern soll Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Verwendung des Natureingangs aufzeigen.
Schlüsselwörter
Minnelyrik, Neidhart von Reuental, Natureingang, Sommerlied, Winterlied, Jahreszeiten, Stimmung, Handlungsraum, Vorausdeutung, mittelhochdeutsche Literatur, Lyrik des 13. Jahrhunderts.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Analyse des Natureingangs in Liedern Neidharts von Reuental
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung des Natureingangs in der Minnelyrik Neidharts von Reuental. Der Fokus liegt auf einem vergleichenden Studium der Funktion des Natureingangs in Sommer- und Winterliedern, um dessen Einfluss auf Stimmung, Handlungsraum und Vorausdeutung zu untersuchen.
Welche Lieder werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf zwei spezifische Lieder Neidharts: ein Sommerlied (Nummer 19) und ein Winterlied (Nummer 6). Diese Lieder dienen als Fallbeispiele, um die unterschiedlichen Funktionen des Natureingangs in verschiedenen Jahreszeiten zu beleuchten.
Welche Aspekte der Lieder werden untersucht?
Die Analyse betrachtet verschiedene Aspekte der Lieder, darunter den Aufbau, die bewirkte Stimmung, den dargestellten Handlungsraum und die Vorausdeutung der Handlung. Es wird untersucht, wie die Naturbeschreibung diese Elemente beeinflusst und welche Rolle der Natureingang im Gesamtkontext der Lieder spielt.
Wie wird der Natureingang in den Liedern eingesetzt?
Die Arbeit untersucht, wie Neidhart den Natureingang als gattungsstiftendes Prinzip einsetzt und wie die Naturbeschreibung die Stimmung und die Handlung der Lieder beeinflusst. Der Vergleich zwischen Sommer- und Winterliedern soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Verwendung des Natureingangs aufzeigen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Funktion des Natureingangs in der Minnelyrik Neidharts zu ergründen und den Einfluss der Naturbeschreibung auf die Interpretation der Liebeslyrik zu analysieren. Der Vergleich von Sommer- und Winterliedern soll zu einem tieferen Verständnis der literarischen Technik des Natureingangs beitragen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Minnelyrik, Neidhart von Reuental, Natureingang, Sommerlied, Winterlied, Jahreszeiten, Stimmung, Handlungsraum, Vorausdeutung, mittelhochdeutsche Literatur, Lyrik des 13. Jahrhunderts.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Der Natureingang bei Neidhart"), welches die detaillierte Analyse der ausgewählten Lieder beinhaltet, und einen Schluss. Die Einleitung stellt den Kontext und die Forschungsfrage dar, während der Schluss die Ergebnisse zusammenfasst.
Welche Forschungsliteratur wird berücksichtigt?
Die Einleitung verweist auf relevante Forschungsliteratur zum Thema Natureingang in der Minnelyrik und zur Lyrik Neidharts von Reuental. Diese Literatur dient als Grundlage für die eigene Analyse.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für den akademischen Gebrauch bestimmt und richtet sich an Leser, die sich für mittelhochdeutsche Literatur, Minnelyrik und die Lyrik Neidharts von Reuental interessieren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Der Natureingang am Beispiel eines Sommer- und Winterliedes von Neidhart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184919