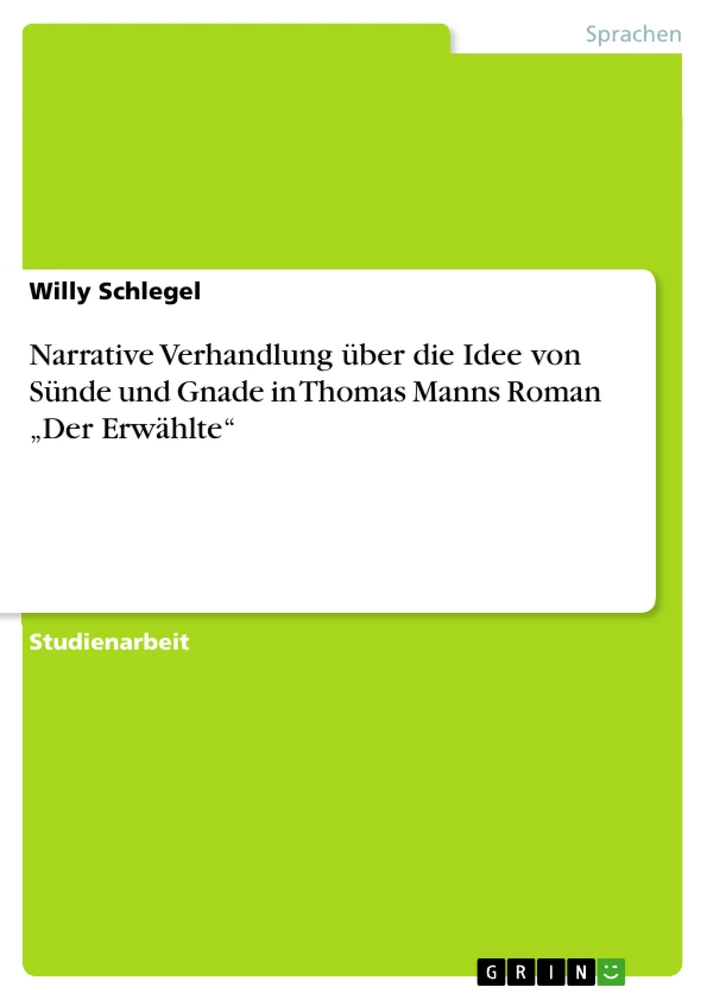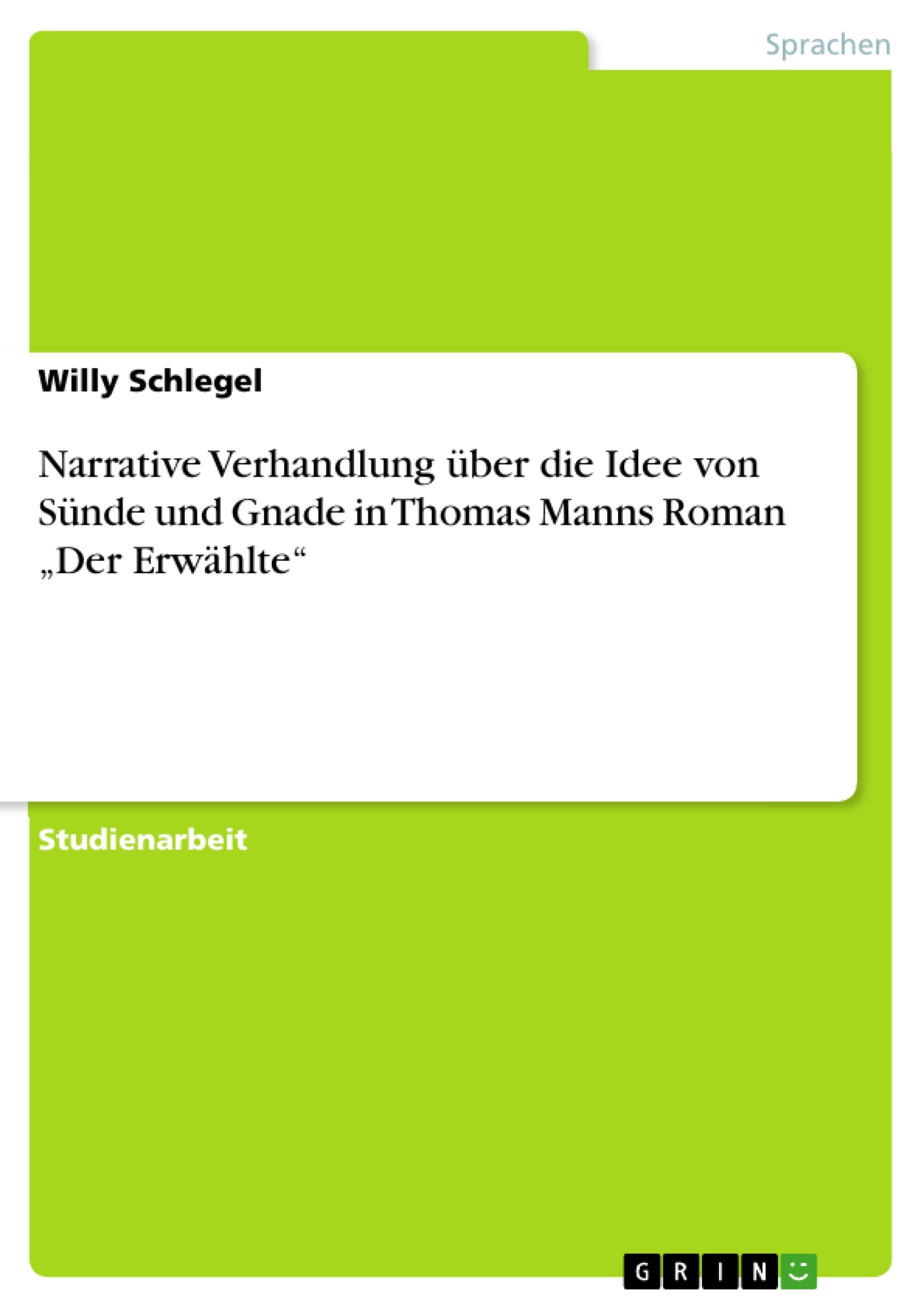Wie stehe ich eigentlich zu Inzest? Diese Frage sollte sich der Rezipient vor dem Zu-Gemüte-Führen des „Erwählten“ stellen. Ist es verwerflich? Ist es natürlich? Was ist natürlich? Etwa alles, was die Natur zulässt? Und dann frage ich denselben Rezipienten noch einmal nach der Lektüre des „Erwählten“. Wie stehen Sie zu Inzest? Er wird ins Stocken kommen, länger überlegen müssen als vorher. Ist Inzest verzeihbar? Sicher nicht, es ist eine Sünde. Doch kann der Sünder begnadigt werden? Und wenn ja, wie?
Im Folgenden möchte ich eine kritische Auseinandersetzung über die Mann’sche Idee von Sünde und Gnade im „Erwählten“ darlegen, die einen zentralen Aspekt im Werk Thomas Manns ausmacht und sich in besonderem Maße in der „Josephus-Trilogie“ sowie dem unmittelbar vorher verfassten „Doktor Faustus“ wiederfinden lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorbetrachtungen
- Was ist Sünde?
- Was ist Gnade?
- Wiligis & Sibylla – Bereiter des Untergangs
- Gregorius - Durch Buße aus der Sünde
- Eine Kindheit in Unwissenheit und Ahnung
- „Ein Jüngling, der auszieht […]“
- Buße als Murmeltier
- Der Erwählte
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Sünde und Gnade im Roman „Der Erwählte“ von Thomas Mann. Sie analysiert, wie der Autor die Konzepte von Sünde und Gnade innerhalb der Erzählung behandelt, insbesondere im Kontext der Figur Gregorius und seiner Familiengeschichte. Die Arbeit untersucht zudem den Einfluss des christlichen Weltbildes sowie psychologischer Theorien, wie beispielsweise des Ödipuskomplexes, auf die Entwicklung der Geschichte und die Gestaltung der Figuren.
- Die Bedeutung von Sünde und Gnade in der christlichen Tradition
- Die Darstellung von Inzest und sexueller Moral in der Geschichte
- Die Rolle des Vaters und des Sohnes in der Entwicklung des Protagonisten
- Der Einfluss psychoanalytischer Konzepte, insbesondere des Ödipuskomplexes, auf die Figuren und die Handlung
- Die Verbindung von christlicher Moral und menschlicher Psychologie im Werk Thomas Manns
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die zentrale Frage nach der Bedeutung von Sünde und Gnade im Roman „Der Erwählte“. Sie beleuchtet die Relevanz dieser Konzepte im Kontext der christlichen Lehre und des moralischen Bewusstseins der Figuren.
Das Kapitel „Vorbetrachtungen“ definiert die Begriffe „Sünde“ und „Gnade“ aus christlicher Sicht. Es zeigt auf, wie diese Konzepte in der Geschichte des Romans eine entscheidende Rolle spielen und auf die Handlungen der Figuren Einfluss nehmen.
Das Kapitel „Wiligis & Sibylla – Bereiter des Untergangs“ befasst sich mit der Kindheit Gregorius und der Geschichte seiner Eltern. Es analysiert die Rolle des Inzests als Auslöser für Sünde und Leid in der Familie und zeigt auf, wie der Ödipuskomplex sich in den Beziehungen der Figuren widerspiegelt.
Das Kapitel „Gregorius - Durch Buße aus der Sünde“ beschreibt die Entwicklung des Protagonisten Gregorius. Es analysiert seine Kindheit, seine Reise und sein Streben nach Erlösung von der Sünde. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Buße und die Rolle des christlichen Weltbildes in Gregorius' Lebensweg.
Schlüsselwörter
Sünde, Gnade, Inzest, Buße, Erlösung, Ödipuskomplex, Thomas Mann, Der Erwählte, Joseph-Trilogie, Doktor Faustus, christliches Weltbild, psychologische Konzepte, Familiengeschichte, moralische Entwicklung
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Thomas Manns Roman "Der Erwählte"?
Der Roman erzählt die mittelalterliche Legende von Gregorius, der aus einem doppelten Inzest hervorgeht und nach schwerer Buße schließlich zum Papst gewählt wird.
Wie wird das Thema Sünde im Werk verhandelt?
Sünde wird als schicksalhafte Verstrickung, insbesondere durch Inzest, dargestellt, die jedoch durch radikale Reue und Buße überwunden werden kann.
Welche Rolle spielt die Gnade?
Die Gnade ist die göttliche Antwort auf die Buße; sie zeigt, dass selbst der schwerste Sünder durch göttliches Eingreifen rehabilitiert werden kann.
Was hat der Ödipuskomplex mit dem Roman zu tun?
Thomas Mann verknüpft die christliche Legende mit psychoanalytischen Motiven, da Gregorius unbewusst seine eigene Mutter heiratet, ähnlich wie Ödipus.
Wie unterscheidet sich "Der Erwählte" von "Doktor Faustus"?
Während "Doktor Faustus" eine tragische, unrettbare Verdammnis schildert, bietet "Der Erwählte" eine humorvoll-ironische Perspektive auf die Möglichkeit der Erlösung.
- Quote paper
- Willy Schlegel (Author), 2010, Narrative Verhandlung über die Idee von Sünde und Gnade in Thomas Manns Roman „Der Erwählte“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184931