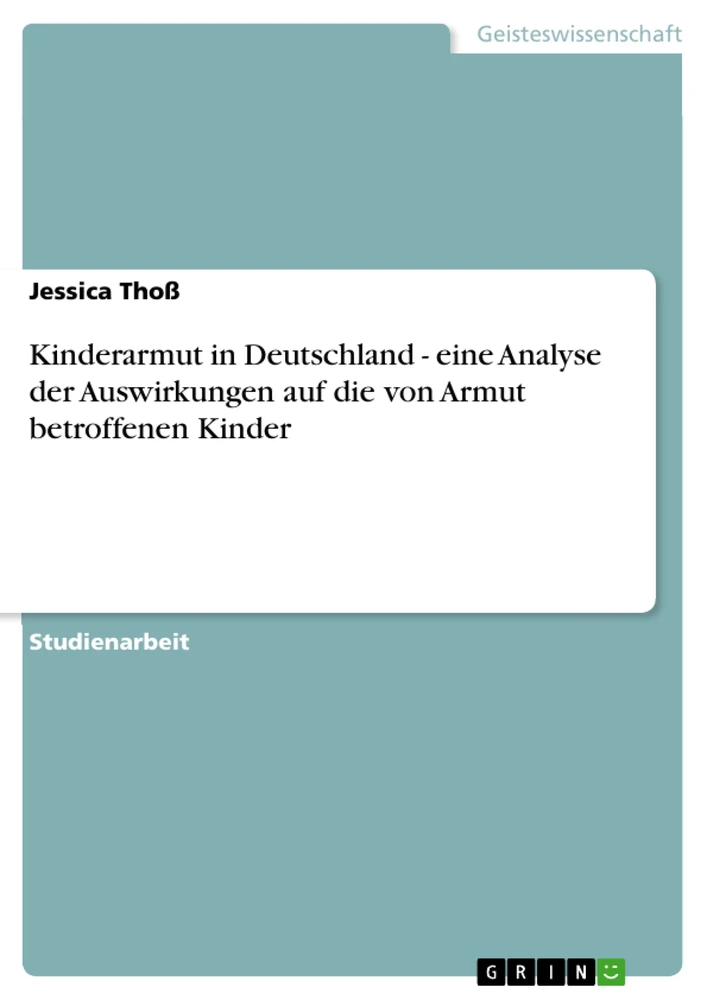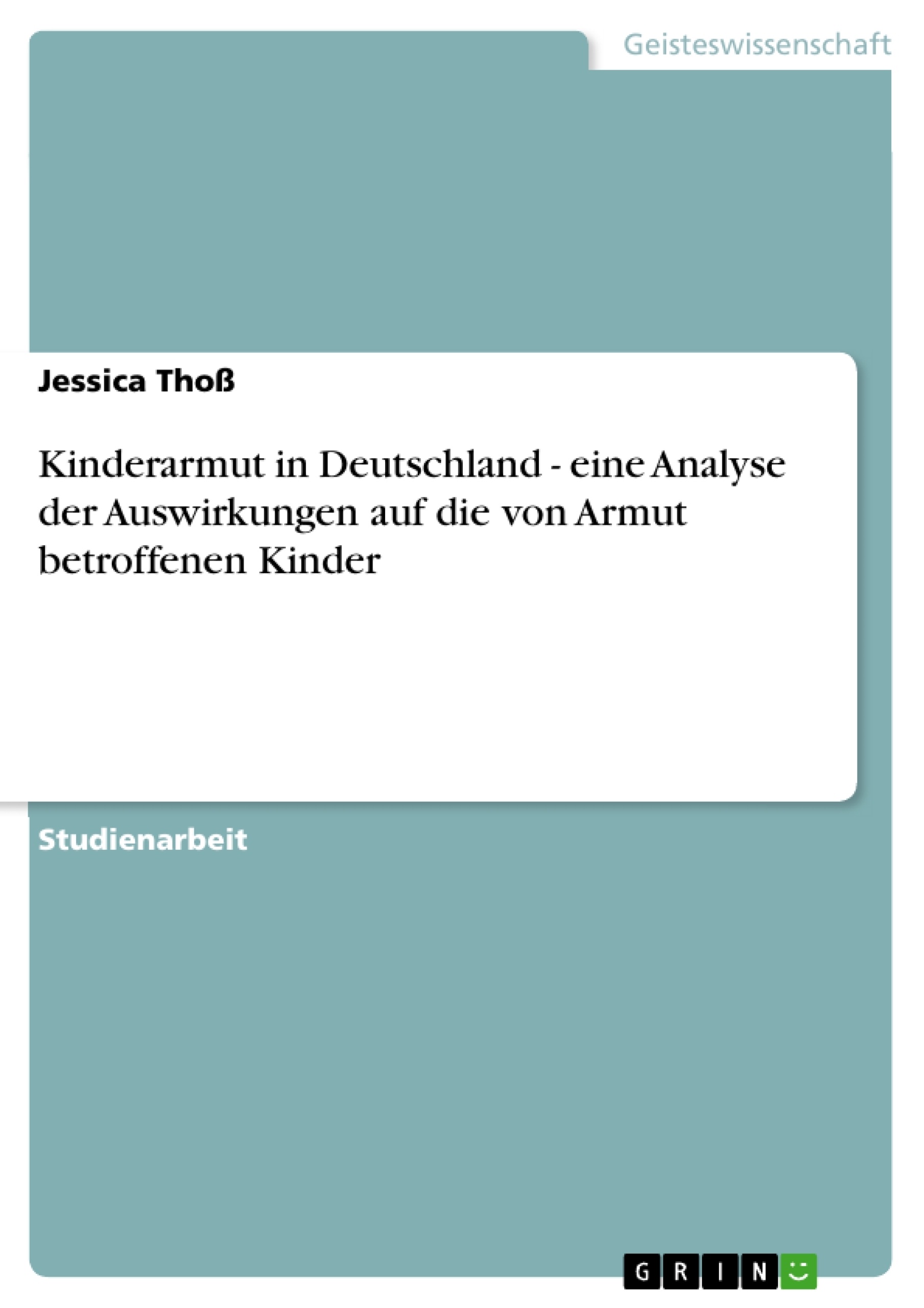1. Einleitung
Die Bundesrepublik Deutschland gilt als eines der wohlhabendsten Länder der Welt.
Laut einer Studie des „Legatum Institute“ im Jahr 2010, wonach die wirtschaftliche, gesundheitliche, unternehmerische Dimension, als auch Bildung, Soziales Kapital, persönliche Freiheit, Sicherheitsleistungen und die Regierungsform untersucht wurde, erreichte Deutschland in einem Ranking, von insgesamt 110 untersuchten Ländern, Platz 15. (vgl. Legatum Institute 2010)
Kaum vorstellbar ist daher, dass in Deutschland das Phänomen Armut existiert.
Zahlen bestätigen jedoch die Realität. Immerhin waren im Jahr 2007 14,3 % der Bevölkerung in Deutschland von relativer Armut gefährdet. (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2009)
Diese Ungerechtigkeit betrifft hierzulande vor allem die Kinder.
In Deutschland waren 2005 nach der Berechnung der EU-SILC 12%1 der Kinder im Alter von 0-15 Jahren von Armut betroffen. (vgl. EUROSTAT 2008, EU-SILC 2006 in Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2008, S. 91) Insbesondere Kinder, die in Haushalten von Alleinerziehenden leben, seien mit 24% arm. Leben drei und mehr Kinder bei einem Paar, so beträgt das Armutsrisiko 13%. Hingegen Paare mit nur einem Kind sind zu 8% und Paare mit zwei Kindern zu 9% betroffen.2 (vgl. EUROSTAT 2008, EU-SILC 2006 in Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2008, S. 92)
Des weiteren deuten die Statistiken daraufhin, dass insbesondere Familien, die kein Erwerbseinkommen erlangen, zu 48% von Armut betroffen sind. Jedoch schützt scheinbar auch eine Erwerbstätigkeit nicht vor Armut. Denn auch wenn mindestens eine Person in dem Haushalt mit Kindern voll erwerbstätig ist oder zwei Personen jeweils einer Halbtageserwerbstätigkeit nachgehen, liegt deren Armutsrisikoquote immer noch bei 22%.(vgl. EUROSTAT 2008, EU-SILC 2006 in Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2008, S. 95)
Diesen Zahlen zufolge ist es erschreckend, dass lange Zeit die Kinder eher als Verursacher von Armut für deren Familien, statt als „Leidtragende“ betrachtet wurden.
Mit der Veröffentlichung des Sozialberichts von 1993 wurde die Problematik der von Armut betroffenen Kindern und damit das Ausmaß der Ungleichheit in der Gesellschaft deutlich. (vgl. Holz 2010, S. 88 - 89)
Dies löste Empörung in der Bevölkerung aus und initiierte damit einhergehend Diskussionen bezüglich Kinderrechte und Kindeswohl. (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was bedeutet Kinderarmut und wie kann diese festgestellt werden?
- Die zwei grundlegendsten Definitionen der Armut
- Die „absolute\" Armut
- Die „relative\" Armut
- Zwei ausgewählte Konzepte zur Analyse von Kinderarmut
- Der ressourcenorientierte Ansatz
- Der Lebenslagenansatz
- Wie wirkt sich Armut auf die betroffenen Kinder aus?
- Wie wirkt sich „relative“ Einkommensarmut auf die materielle Situation der betroffenen Kinder aus?
- Wie wirkt sich „relative“ Einkommensarmut auf die Gesundheitsentwicklung der von Armut betroffenen Kinder aus?
- Die körperliche Gesundheit der von Armut betroffenen Kinder
- Die psychische Gesundheit der von Armut betroffenen Kinder
- Zeigt sich bei von Armut betroffenen Kindern eine Benachteiligung hinsichtlich der Sozialentwicklung?
- Sozialverhalten der von Armut betroffenen Kinder
- Soziale Kontakte der von Armut betroffenen Kinder
- Wirkt sich die „relative“ Armut von Kindern auf deren kulturelle Situation aus?
- Schluss
- Fazit
- Was kann die Soziale Arbeit leisten?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Hausarbeit ist es, die Auswirkungen von Kinderarmut auf die betroffenen Kinder im Alter von 0-10 Jahren zu analysieren. Die Arbeit untersucht, welche Folgen Kinderarmut für die materielle, gesundheitliche, soziale und kulturelle Situation der Kinder hat.
- Definition und Messung von Kinderarmut in Deutschland
- Auswirkungen von Armut auf die materielle Situation von Kindern
- Auswirkungen von Armut auf die gesundheitliche Entwicklung von Kindern
- Auswirkungen von Armut auf die soziale Entwicklung von Kindern
- Auswirkungen von Armut auf die kulturelle Situation von Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt die Problematik von Kinderarmut in Deutschland dar und zeigt auf, dass Armut in einem der wohlhabendsten Länder der Welt existiert. Der Fokus liegt auf den negativen Auswirkungen, die Kinderarmut auf die betroffenen Kinder hat, und auf die Notwendigkeit, die Auswirkungen von Armut in den wissenschaftlichen Blick zu nehmen.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und der Messung von Kinderarmut. Es werden die beiden grundlegendsten Definitionen der Armut, die „absolute“ und die „relative“ Armut, erläutert. Darüber hinaus werden zwei Konzepte zur Analyse von Kinderarmut, der ressourcenorientierte Ansatz und der Lebenslagenansatz, vorgestellt.
- Das dritte Kapitel analysiert die Auswirkungen von Armut auf die betroffenen Kinder. Es werden die Auswirkungen von „relativer“ Einkommensarmut auf die materielle, gesundheitliche, soziale und kulturelle Situation der Kinder untersucht. Die Kapitel werden mit ausgewählter Literatur und einer Studie auf Basis eines mehrdimensionalen Lebenslagenkonzepts untermauert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Hausarbeit sind Kinderarmut, Armutsrisiko, materielle Situation, gesundheitliche Entwicklung, soziale Entwicklung, kulturelle Situation, Lebenslagenansatz, ressourcenorientierter Ansatz, Prävention, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen absoluter und relativer Armut?
Absolute Armut bezeichnet einen Zustand, in dem Grundbedürfnisse (Nahrung, Kleidung) nicht gedeckt werden können. Relative Armut bezieht sich auf den Lebensstandard im Vergleich zum Durchschnittseinkommen der Gesellschaft (in Deutschland meist unter 60% des Medianeinkommens).
Wie wirkt sich Armut auf die Gesundheit von Kindern aus?
Armut beeinträchtigt sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit. Betroffene Kinder haben oft ein höheres Risiko für chronische Krankheiten, Entwicklungsverzögerungen und psychische Belastungen.
Welche sozialen Folgen hat Kinderarmut?
Kinder in Armut erleben oft Benachteiligungen in ihrer Sozialentwicklung, haben weniger soziale Kontakte und zeigen teilweise Auffälligkeiten im Sozialverhalten aufgrund von Ausgrenzung.
Was ist der Lebenslagenansatz?
Dieser Ansatz betrachtet Armut mehrdimensional: Nicht nur das Geld zählt, sondern die gesamte Lebenssituation, einschließlich Bildungschancen, Wohnumfeld, Gesundheit und kulturelle Teilhabe.
Kann die Soziale Arbeit gegen Kinderarmut helfen?
Ja, die Soziale Arbeit leistet wichtige Beiträge durch Präventionsangebote, Unterstützung der Familien in schwierigen Lebenslagen und die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe betroffener Kinder.
Gibt es Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass trotz des allgemeinen Wohlstands in Deutschland ein signifikantes Armutsrisiko für Kinder besteht, was weitreichende Folgen für deren Zukunft hat.
- Quote paper
- Jessica Thoß (Author), 2011, Kinderarmut in Deutschland - eine Analyse der Auswirkungen auf die von Armut betroffenen Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185053