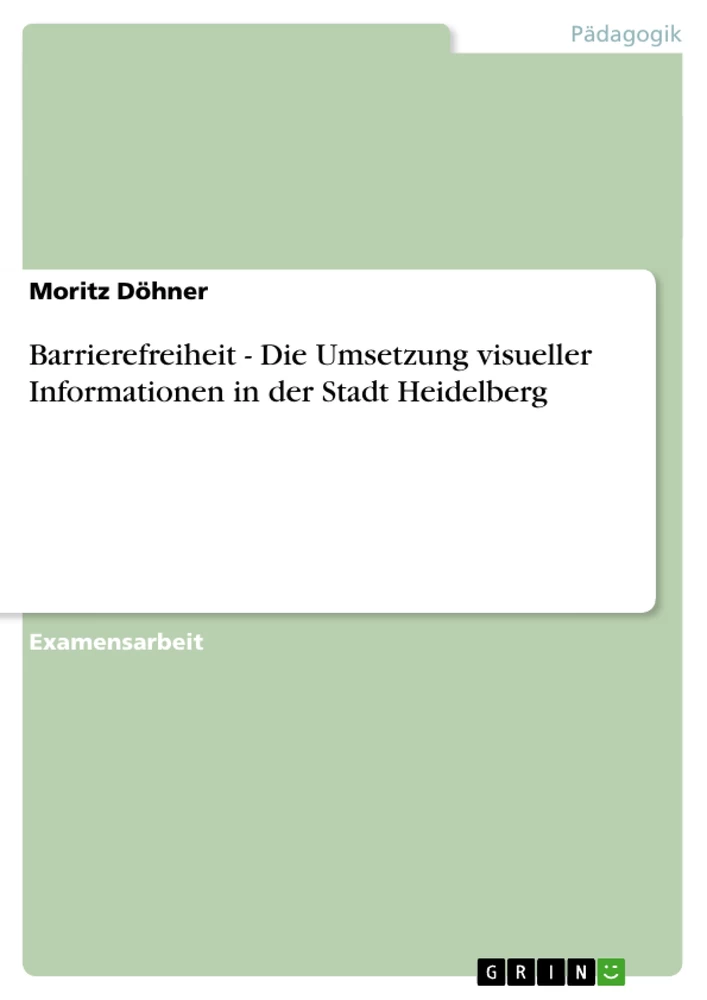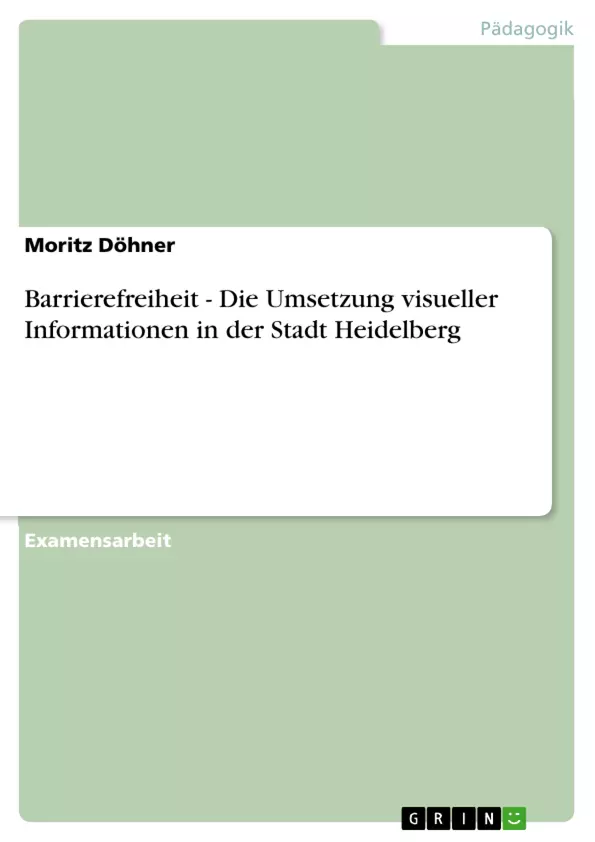Etwas sprichwörtlich „mit anderen Augen zu sehen“ ist oft sinnvoll, da es einem zu neuen Erfahrungen und Erkenntnissen verhilft. Indem ich mich im Zuge dieser wissenschaftlichen Arbeit in die Lage von sehbehinderten Menschen versetzte, konnte ich die Stadt Heidelberg, in der ich lebe, auf eine ganz neue Weise kennen lernen. Mein Blick wurde geschärft für die Gestaltung des öffentlichen Raumes im Bezug auf Sehbehinderte und, wie deutlich werden wird, auch im Bezug auf alle Menschen. Es ist erfreulich, dass die verantwortlichen Planer vermehrt ihr Augenmerk auf dieses Thema legen. Konkrete Vorschläge für eine sehbehindertengerechte Gestaltung der Umwelt liegen vor, dennoch besteht teilweise großer Nachholbedarf bei deren Umsetzung.
Die Hausarbeit besteht aus einem theoretischen Teil, in dem Kriterien aus der Fachliteratur zusammengestellt werden, und einem praktischen Teil, in dem über Untersuchungen an ausgewählten Orten in Heidelberg berichtet wird, die nach diesen Kriterien durchgeführt wurden. Wann immer das Fotografieren möglich und sinnvoll war, werden die Ergebnisse von Fotos begleitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Barrieren und Barrierefreiheit
- 1.1 Barrieren
- 1.2 Barrierefreiheit
- 2. Wahrnehmung visueller Informationen
- 2.1 Prinzip der geschlossenen Informationskette
- 2.2 Prioritätenmodell
- 2.3 Kontraste
- 2.3.1 Leuchtdichtekontrast (photometrischer Kontrast)
- 2.3.2 Farbkontrast
- 2.3.3 Physiologischer Kontrast
- 3. Beschreibung des Personenkreises
- 3.1 Definition des Begriffs Sehschädigung
- 3.2 Vielfalt der Augenerkrankungen
- 4. Visuelle Barrieren
- 4.1 Verbesserte visuelle Informationen nützen allen
- 4.2 Finanzierung
- 5. Kriterienkatalog
- 5.1 Grundsätzliche Empfehlungen für die Gestaltung
- 5.1.1 Kontrast
- 5.1.2 Farben
- 5.1.3 Helligkeit
- 5.1.4 Schrift
- 5.1.5 Form
- 5.2 Informationsträger
- 5.2.1 Piktogramme
- 5.2.2 Anbringung
- 5.2.3 Pflege
- 5.2.4 Beleuchtung
- 5.2.5 Schilder als Teil von Leitsystemen
- 5.3 Gestaltung visueller Informationen in Fußgängerbereichen des öffentlichen Verkehrsraums
- 5.3.1 Gehwege
- 5.3.1.1 Breite des Gehwegs
- 5.3.1.2 Oberflächen
- 5.3.1.3 Bodenindikatoren
- 5.3.1.4 Begrenzung des Gehwegs
- 5.3.1.5 Radwegabgrenzungen
- 5.3.2 Verkehrsknotenpunkte
- 5.3.2.1 Fußgängerüberwege
- 5.3.2.2 Das Grazer T
- 5.3.2.3 Fußgängerfurten
- 5.3.2.4 Fußgängerschutzinseln
- 5.3.3 Hindernisse
- 5.3.3.1 Nicht auskragende Hindernisse
- 5.3.3.2 Hindernisse mit hüfthoher Beinfreiheit
- 5.3.3.3 Hindernisse in Kopfhöhe
- 5.3.3.4 Parkende Fahrzeuge
- 5.3.3.5 Negativhindernisse
- 5.3.3.6 Baustellenabschrankungen
- 5.3.3.7 Telefonzellen
- 5.3.3.8 Kunstwerke
- 5.3.1 Gehwege
- 5.4 Gestaltung visueller Informationen an Fahrzeugen und Anlagen des ÖPNV
- 5.4.1 Bushaltestellen
- 5.4.2 Straßenbahnhaltestellen
- 5.4.3 Straßenbahnen und Busse
- 5.4.4 Bahnhöfe
- 5.5 Gestaltung visueller Informationen in und um öffentliche Gebäude
- 5.5.1 Treppen
- 5.5.1.1 Stufenmarkierungen
- 5.5.1.2 Handläufe
- 5.5.2 Rampen
- 5.5.3 Aufzüge
- 5.5.4 Flure und Innenräume
- 5.5.4.1 Türen
- 5.5.4.2 Glaswände und Glastüren
- 5.5.4.3 Beleuchtung
- 5.5.5 Sanitärräume
- 5.5.1 Treppen
- 5.1 Grundsätzliche Empfehlungen für die Gestaltung
- 6. Untersuchung
- 6.1 Öffentlich zugängliche Orte und Plätze
- 6.2 Öffentlich zugängliche Gebäude
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Barrierefreiheit visueller Informationen in Heidelberg für sehbehinderte Menschen. Ziel ist die Analyse bestehender Barrieren und die Entwicklung von Kriterien für eine verbesserte Gestaltung.
- Analyse visueller Barrieren im öffentlichen Raum Heidelbergs
- Entwicklung eines Kriterienkatalogs für barrierefreie visuelle Gestaltung
- Untersuchung der Umsetzung visueller Informationen an verschiedenen Orten
- Bewertung der vorhandenen Infrastruktur hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit
- Ableitung von Empfehlungen zur Verbesserung der visuellen Barrierefreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Barrieren und Barrierefreiheit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Barrierefreiheit und unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Barrieren, die Menschen mit Sehbehinderungen im Alltag begegnen. Es legt die Grundlage für die gesamte Arbeit, indem es die Bedeutung von barrierefreier Gestaltung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben herausstellt.
2. Wahrnehmung visueller Informationen: Das Kapitel beleuchtet die Prinzipien der visuellen Wahrnehmung bei Menschen mit und ohne Sehbehinderung. Es erklärt die Bedeutung von Kontrasten, Helligkeit und der geschlossenen Informationskette für eine erfolgreiche Informationsübermittlung und legt die physiologischen Grundlagen für die spätere Kriterienentwicklung dar. Das Prioritätenmodell wird als wichtiges Werkzeug zur Gestaltung visueller Informationen eingeführt.
3. Beschreibung des Personenkreises: Hier wird der Personenkreis der Sehbehinderten definiert und die Vielfalt der Augenerkrankungen erläutert. Es wird auf die heterogene Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Sehfähigkeiten eingegangen, was die Notwendigkeit individueller Lösungen für barrierefreie Gestaltung verdeutlicht.
4. Visuelle Barrieren: Dieses Kapitel beschreibt konkrete visuelle Barrieren, denen sehbehinderte Menschen in Heidelberg begegnen. Es wird argumentiert, dass eine verbesserte visuelle Gestaltung nicht nur sehbehinderten Menschen zugutekommt, sondern allen Nutzern, und es werden Aspekte der Finanzierung barrierefreier Maßnahmen diskutiert.
5. Kriterienkatalog: Dieses zentrale Kapitel präsentiert einen detaillierten Kriterienkatalog für die Gestaltung barrierefreier visueller Informationen. Es werden Empfehlungen zu Kontrasten, Farben, Helligkeit, Schrift, Formen und verschiedenen Informationsträgern wie Piktogrammen gegeben. Die Gestaltungshinweise beziehen sich auf Fußgängerbereiche, den öffentlichen Nahverkehr und öffentliche Gebäude, einschließlich detaillierter Ausführungen zu einzelnen Elementen wie Gehwegen, Haltestellen und Treppen.
6. Untersuchung: Dieses Kapitel präsentiert eine empirische Untersuchung der visuellen Barrierefreiheit an ausgewählten öffentlichen Orten und Gebäuden in Heidelberg. Es werden konkrete Beispiele analysiert und dokumentiert, wie die im Kriterienkatalog festgelegten Richtlinien in der Praxis umgesetzt (oder nicht umgesetzt) werden. Die Untersuchung umfasst öffentliche Plätze, Gebäude und den öffentlichen Nahverkehr.
Schlüsselwörter
Barrierefreiheit, visuelle Informationen, Sehbehinderung, Heidelberg, Kontrast, Gestaltung, Kriterienkatalog, öffentlicher Raum, öffentliche Gebäude, Empirische Untersuchung, Piktogramme, Leitsysteme, Barrieren, Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Barrierefreiheit visueller Informationen in Heidelberg für sehbehinderte Menschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Barrierefreiheit visueller Informationen in Heidelberg für sehbehinderte Menschen. Sie analysiert bestehende Barrieren und entwickelt Kriterien für eine verbesserte Gestaltung im öffentlichen Raum und in öffentlichen Gebäuden.
Welche Aspekte der visuellen Barrierefreiheit werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der visuellen Barrierefreiheit, darunter die Wahrnehmung visueller Informationen (Kontraste, Helligkeit, geschlossene Informationskette), die Beschreibung des Personenkreises der Sehbehinderten, konkrete visuelle Barrieren im öffentlichen Raum Heidelbergs, und die Finanzierung barrierefreier Maßnahmen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung eines detaillierten Kriterienkatalogs für die Gestaltung barrierefreier visueller Informationen.
Was beinhaltet der Kriterienkatalog?
Der Kriterienkatalog umfasst Empfehlungen zu Kontrasten, Farben, Helligkeit, Schrift, Formen und verschiedenen Informationsträgern (Piktogramme). Er bezieht sich auf Fußgängerbereiche, den öffentlichen Nahverkehr (Bushaltestellen, Straßenbahnhaltestellen, Straßenbahnen und Busse, Bahnhöfe) und öffentliche Gebäude (Treppen, Rampen, Aufzüge, Flure, Innenräume, Sanitärräume). Der Katalog beinhaltet detaillierte Ausführungen zu einzelnen Elementen wie Gehwegbreite, Oberflächen, Bodenindikatoren, Verkehrsknotenpunkten, Hindernissen und der Beleuchtung.
Welche Orte und Gebäude wurden in der Untersuchung berücksichtigt?
Die empirische Untersuchung analysiert die visuelle Barrierefreiheit an ausgewählten öffentlichen Orten und Gebäuden in Heidelberg. Dies umfasst öffentliche Plätze, Gebäude und den öffentlichen Nahverkehr.
Welche Ziele werden mit dieser Arbeit verfolgt?
Die Ziele sind die Analyse visueller Barrieren im öffentlichen Raum Heidelbergs, die Entwicklung eines Kriterienkatalogs für barrierefreie visuelle Gestaltung, die Untersuchung der Umsetzung visueller Informationen an verschiedenen Orten, die Bewertung der vorhandenen Infrastruktur hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit und die Ableitung von Empfehlungen zur Verbesserung der visuellen Barrierefreiheit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Barrieren und Barrierefreiheit; 2. Wahrnehmung visueller Informationen; 3. Beschreibung des Personenkreises; 4. Visuelle Barrieren; 5. Kriterienkatalog; 6. Untersuchung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der visuellen Barrierefreiheit, beginnend mit Definitionen und Grundlagen und endend mit einer empirischen Untersuchung.
Wer profitiert von den Ergebnissen dieser Arbeit?
Von den Ergebnissen profitieren primär sehbehinderte Menschen, indem die Arbeit zu einer Verbesserung ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beiträgt. Die Ergebnisse sind aber auch für Stadtplaner, Architekten, Gestalter und alle Verantwortlichen im öffentlichen Raum relevant, die an der Verbesserung der Barrierefreiheit interessiert sind. Eine verbesserte visuelle Gestaltung nützt letztlich allen Nutzern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Barrierefreiheit, visuelle Informationen, Sehbehinderung, Heidelberg, Kontrast, Gestaltung, Kriterienkatalog, öffentlicher Raum, öffentliche Gebäude, Empirische Untersuchung, Piktogramme, Leitsysteme, Barrieren, Teilhabe.
- Arbeit zitieren
- Moritz Döhner (Autor:in), 2011, Barrierefreiheit - Die Umsetzung visueller Informationen in der Stadt Heidelberg, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185062