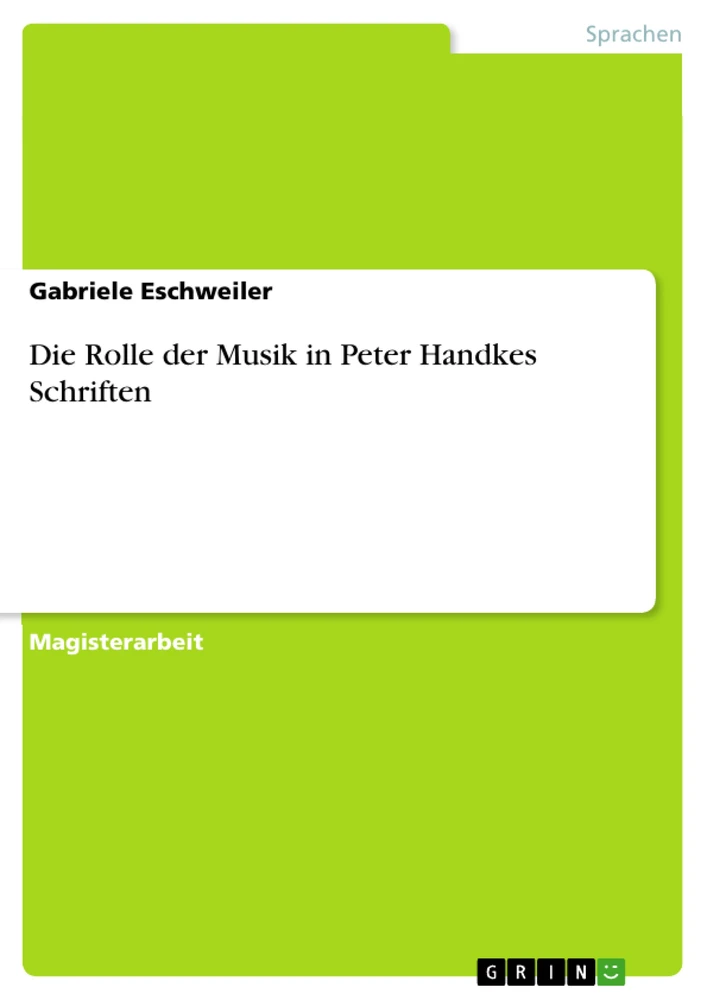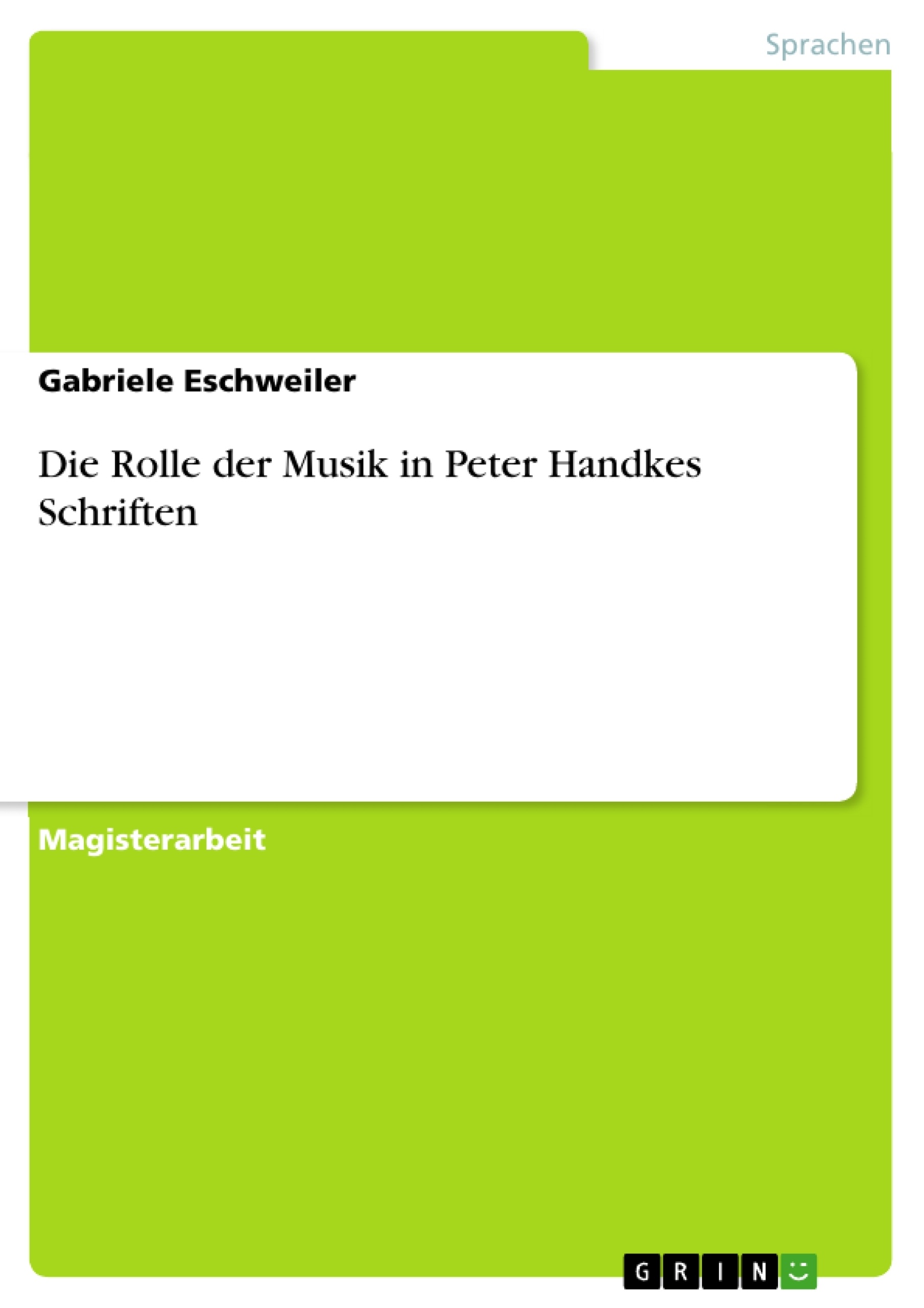Der 1942 in einem kleinen Ort in Kärnten, Österreich, geborene Schriftsteller Peter Handke gehört in die Reihe der Autoren, die es Ende der sechziger Jahre in Deutschland mit ihrem Interesse an Rock-, Popmusik und -Kultur nicht auf der Ebene der privaten Auseinandersetzung bewenden ließen, sondern diese Elemente ganz bewußt in ihre Literatur aufnahmen. Er und Schriftstellerkollegen wie Rolf Dieter Brinkmann, Wolf Wondratschek et al folgten in diesem Punkt der amerikanischen Pop-Literatur. „Die neuen Anti-Götter, Anti-Helden, Nach-Götter und Nach-Helden entsteigen den Welten des Jazz, des Rock, der Schlagzeilen und der Comics, der alten Filme"1 konstatierte 1968 der amerikanische Literaturprofessor Leslie A. Fiedler in seinem Freiburger Vortrag zur Standort- und programmatischen Schwerpunktbestimmung der neuen postmodernen Literatur. Ein sinnvoller Zugang zum Verständnis dieser neuen Haltung läßt sich nur auf dem Hintergrund der folgenden literarischen und gesellschaftlich-kulturellen Entwicklungen und Zustände erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Der Hintergrund der literarischen und gesellschaftlich-kulturellen Entwicklungen, die zu einer literarischen Rezeption von Popularkultur führten
- 1. Die Tradition der Beats, deren literarische Verfahren in mehrfacher Hinsicht richtungweisend für die Handkegeneration waren
- 2. Die sozio-kulturellen Voraussetzungen zur literarischen Rezeption von Popularkultur
- 3. Die Bedeutung der Rezeption von Popularkultur für die Literatur (BRD)
- B. Die Arten der Musik in den Schriften Peter Handkes
- 1. Rock
- 1.1. Die Musikbox
- 1.2. Rockmusik im Theaterstück und Hörspiel
- 1.3. Objets trouvés, Cut-up Collagen et al aus dem Bereich der Rockmusik
- 1.4. Rockzitate als Motto
- 1.5. Rockzitate im Text
- 1.5.1. in Übersetzung
- 1.5.2. im Originalzitat
- 1.6. Rocksongs als Identifikationslieder
- 1.7. Probleme und Perspektiven der literarischen Integration von Rock/Popmusik
- 2. Pop
- 2.1. Beat
- 3. Muzak - Musik im Alltag - Gebrauchsmusik
- 4. Schlager
- 5. Karawanenmusik
- 6. Musik und Glück
- 1. Rock
- C. Ausklang
- Anhang: Diskographie zu den Schriften Peter Handkes
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Rolle der Musik in den Schriften Peter Handkes. Sie analysiert, wie Handke Elemente der Popularkultur, insbesondere Rock- und Popmusik, in seine Werke integriert und welche Bedeutung diese für seine literarische Gestaltung haben. Die Arbeit beleuchtet die literarischen und gesellschaftlich-kulturellen Entwicklungen, die zur Rezeption von Popularkultur in der Literatur führten, und analysiert die verschiedenen Arten der Musik, die in Handkes Schriften vorkommen.
- Die Rezeption von Popularkultur in der Literatur der 1960er Jahre
- Die Rolle der Beats als Vorläufer der Popularkultur-Rezeption
- Die Integration von Rock- und Popmusik in Handkes Werken
- Die Bedeutung von Musik für die literarische Gestaltung
- Die verschiedenen Arten der Musik in Handkes Schriften
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel A beleuchtet den historischen Hintergrund der literarischen und gesellschaftlich-kulturellen Entwicklungen, die zur Rezeption von Popularkultur in der Literatur führten. Es werden die Tradition der Beats, die sozio-kulturellen Voraussetzungen und die Bedeutung der Rezeption von Popularkultur für die Literatur in der BRD untersucht.
Kapitel B analysiert die verschiedenen Arten der Musik, die in den Schriften Peter Handkes vorkommen. Es werden Rock, Pop, Muzak, Schlager, Karawanenmusik und Musik und Glück behandelt. Die Analyse konzentriert sich auf die Integration von Rockmusik in Handkes Werke, die verschiedenen Formen der Verwendung von Rockzitaten und die Bedeutung von Rocksongs als Identifikationslieder.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Peter Handke, Popularkultur, Rockmusik, Literatur, Rezeption, Beat Generation, Musik in der Literatur, literarische Gestaltung, Identifikationslieder, Musik und Glück.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Rockmusik in Peter Handkes Werken?
Handke integriert Rockmusik bewusst als Element der Popularkultur durch Zitate, Mottos und als Identifikationsmittel für seine literarischen Figuren.
Welchen Einfluss hatte die „Beat Generation“ auf Handke?
Die literarischen Verfahren der Beats waren richtungweisend für Handkes Generation und ebneten den Weg für die Rezeption von Popularkultur in der deutschen Literatur.
Was sind „Objets trouvés“ im Kontext von Handkes Musikrezeption?
Es handelt sich um „gefundene Objekte“ oder Fragmente aus der Welt der Rock- und Popmusik (z. B. Songtexte oder Plattenhüllen), die er wie Collagen in seine Texte einbaut.
Wie wird Musik im Alltag (Muzak) in seinen Schriften dargestellt?
Handke thematisiert auch Gebrauchsmusik und Schlager als Teil der alltäglichen Geräuschkulisse, die die Wahrnehmung der Realität beeinflusst.
Gibt es eine Verbindung zwischen Musik und Glück in Handkes Texten?
Ja, die Arbeit untersucht, wie Musik in Handkes Schriften oft als Auslöser für Momente des Glücks, der Reflexion oder der Identitätsfindung fungiert.
- Quote paper
- Gabriele Eschweiler (Author), 1983, Die Rolle der Musik in Peter Handkes Schriften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185127