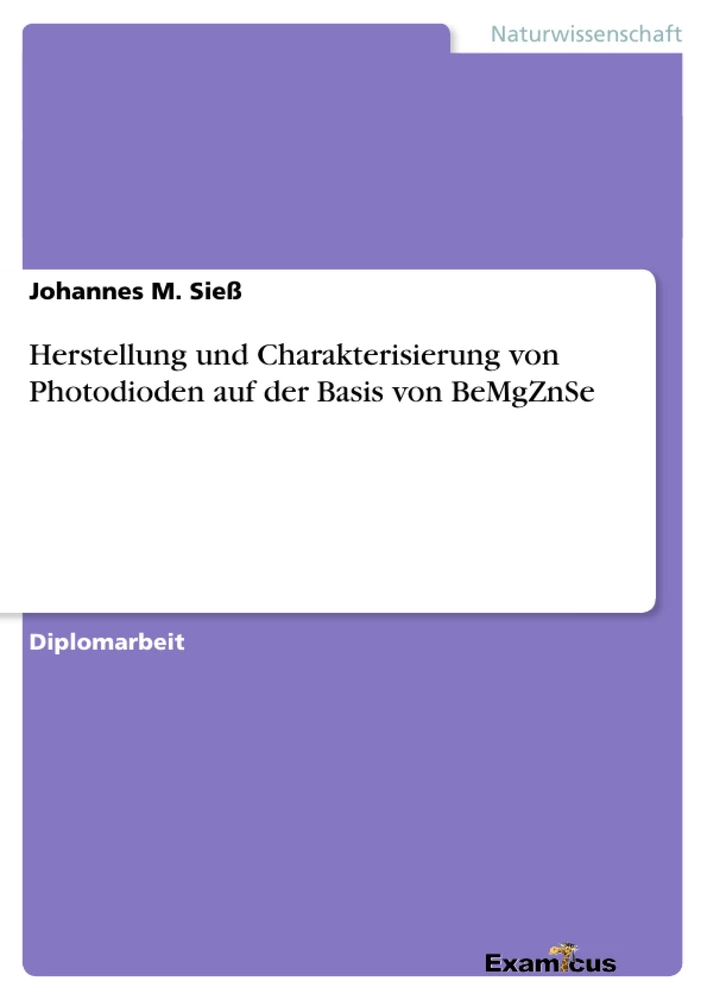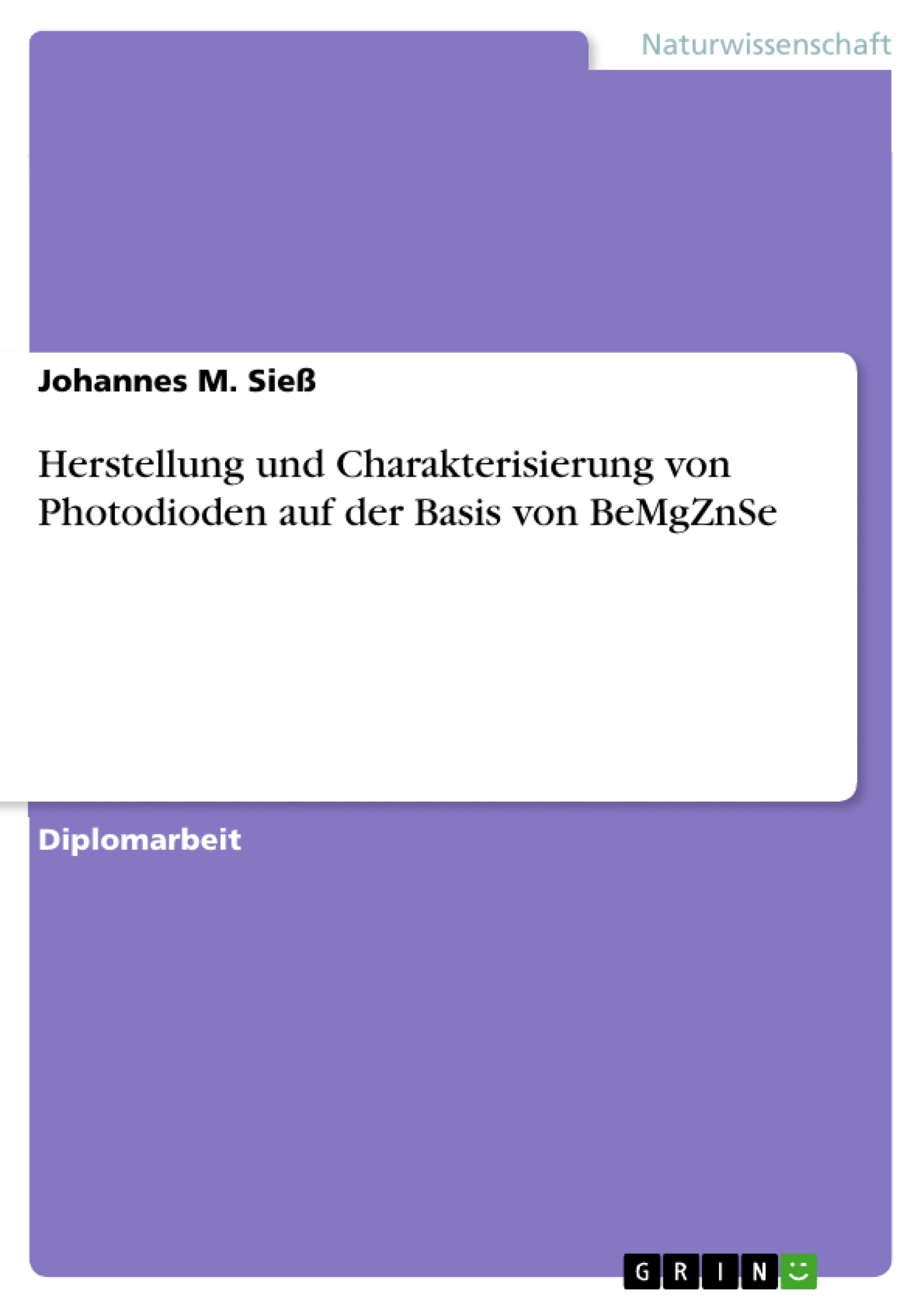Es ist wichtig, die UV-Bestrahlung des menschlichen Körpers zu kontrollieren und nötigenfalls zu beschränken. Kleine handliche Detektoren, die nur in diesem Spektralbereich empfindlich sind, würden dem Einzelnen eine Möglichkeit geben, jederzeit über die
momentane UV-Strahlenbelastung informiert zu sein. Weitere Anwendungen für UV-Detektoren sind denkbar zur Umweltanalyse oder auch in unwirtlichen Umgebungen, wie zur Überwachung von Verbrennungsprozessen, bei denen immer UV-Emission auftritt, die aus der Emission von Verbrennungsprodukten (z.B. Stickstoff) stammt. Diese sind abhängig von der Temperatur. Durch die selektive
Überwachung der UV-Emission ließe sich eine Verbrennung schadstoffarm regeln.
UV-Halbleiterdetektoren bieten die Möglichkeit, die Größe optischer Bauteile zu verringern.
Bisher wurden zur Detektion von UV-Strahlung Siliziumdetektoren mit vorgeschalteten Filtern verwendet, ein hoher Dunkelstrom und die Schwächung der Strahlung durch die Filter machen diese Detektoren aber sehr uneffektiv und oft ist eine Kühlung des Halbleiters
notwendig. Andere Detektoren sind Photomultiplier, aber auch diese benötigen Filter und immer Kühlung. Als vielversprechendes Material wird auch Galliumnitrid genannt, dessen Cut-off jedoch bei 365 nm liegt, wodurch man einen Teil des UV-A-Spektrums nicht
detektieren kann. Mittels Molekularstrahlepitaxie ist es in Würzburg gelungen, lichtemittierende Halbleiterbauelemente aus Beryllium-Chalkogeniden herzustellen [23] mit Bandlücken, die an der Grenze zwischen sichtbarem und ultraviolettem Licht liegen. In dieser Arbeit wird daher versucht, aus diesem Material p-i-n Photodetektoren herzustellen. Dazu wird im 1. und
2. Kapitel die dazu nötige Theorie beschrieben sowie die praktischen Grundlagen vermittelt. Im 3. Kapitel werden dann alle Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefaßt und erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Verzeichnis der Tabellen
- Einleitung
- 1. Theorie der p-i-n Diode
- 1.1. Halbleiterdiode, Photodiode, oder Photodetektor
- 1.1.1. Quantenwirkungsgrad - Responsivität
- 1.1.2. Die p-i-n Photodiode
- 1.1.3. Anforderungen für Detektor-Bauelemente
- 1.2. Materialsysteme
- 1.2.1. Substrate
- 1.2.2. BeTe-Puffer, BeTe-Barriere
- 1.2.3. Aktive Schichten: BeMgZnSe und BeZnSe
- 1.2.4. Der Metall-Halbleiter-Übergang
- 2. Experimente
- 2.1. MBE -p-i-n - Wachstum
- 2.2. Technologie - Photolithographie
- 2.3. Charakterisierung
- 2.3.1. Defektätzen
- 2.3.2. HR-XRD – Hochauflösende Röntgendiffraktometrie
- 2.3.3. Photolumineszenz
- 2.3.4. Strom-Spannungs-Kennlinien
- 2.3.5. Ermittlung der Quanteneffizienz
- 3. Ergebnisse
- 3.1. Detektoren im Sichtbaren
- 3.1.1. CB1001: 64% Quanteneffizienz
- 3.1.2. CB1081
- 3.1.3. CB987: ITO statt n-BeMgZnSe
- 3.1.4. Supergitter - Dioden
- 3.1.5. Defekte
- 3.2. Solar Blind Detektoren
- 3.2.1. CB1176: UV-Detektor
- 3.2.2. CB1105
- 3.2.3. CB1065 und CB1114
- 3.2.4. Defekte
- 3.3. Dioden auf Silizium
- 3.3.1. Strukturelle Qualität
- 3.3.2. Strom-Spannungs-Kennlinien
- 3.4. Vergleichende Betrachtungen
- 3.4.1. Quanteneffizienz und Stromdichte
- 3.4.2. Quanteneffizienz und Gitteranpassung
- 3.4.3. Kommerzielle Si- und GaN-Detektoren
- 3.5. Anwendungen: UV-Bestrahlung
- 3.6. Ausblick
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Herstellung und Charakterisierung von Photodioden auf der Basis von BeMgZnSe
- Untersuchung der Materialeigenschaften von BeMgZnSe für die Anwendung in Photodetektoren
- Optimierung der Wachstumsbedingungen und technologischen Prozesse für die Herstellung von hocheffizienten Photodioden
- Charakterisierung der optischen und elektrischen Eigenschaften der hergestellten Photodioden
- Entwicklung von Anwendungen für die hergestellten Photodioden im sichtbaren und ultravioletten Spektralbereich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Herstellung und Charakterisierung von Photodioden auf der Basis von BeMgZnSe. Ziel ist es, die Herstellung von hocheffizienten Photodetektoren im sichtbaren und ultravioletten Spektralbereich zu ermöglichen. Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Herstellung und Charakterisierung dieser Dioden, darunter die Materialauswahl, die Wachstumsbedingungen, die technologischen Prozesse und die optischen und elektrischen Eigenschaften der Bauelemente.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit behandelt die theoretischen Grundlagen der p-i-n Diode und der Photodetektion. Es werden die Funktionsweise der p-i-n Diode, die Anforderungen an Detektor-Bauelemente und die relevanten Materialsysteme erläutert. Das zweite Kapitel beschreibt die experimentellen Methoden, die für die Herstellung und Charakterisierung der Photodioden verwendet wurden. Dazu gehören das Molekularstrahlepitaxie-Wachstum (MBE), die Photolithographie, die Defektätzen, die Hochauflösende Röntgendiffraktometrie (HR-XRD), die Photolumineszenz (PL) und die Messung der Strom-Spannungs-Kennlinien. Das dritte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen. Es werden die Eigenschaften der hergestellten Photodioden im sichtbaren und ultravioletten Spektralbereich diskutiert, einschließlich der Quanteneffizienz, der Stromdichte, der Gitteranpassung und der Defektdichte. Außerdem werden die Ergebnisse mit kommerziellen Si- und GaN-Detektoren verglichen. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion der möglichen Anwendungen der hergestellten Photodioden und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Herstellung und Charakterisierung von Photodioden, BeMgZnSe, Molekularstrahlepitaxie (MBE), Photolithographie, Hochauflösende Röntgendiffraktometrie (HR-XRD), Photolumineszenz (PL), Strom-Spannungs-Kennlinien, Quanteneffizienz, Gitteranpassung, Defekte, UV-Detektoren, Solar Blind Detektoren, Anwendungen, UV-Bestrahlung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Vorteil von BeMgZnSe-Photodioden gegenüber Silizium?
Sie sind selektiv im UV-Bereich empfindlich und benötigen keine zusätzlichen Filter oder Kühlung, was sie effizienter für UV-Anwendungen macht.
Was sind „Solar Blind“-Detektoren?
Detektoren, die nur auf UV-Strahlung reagieren und das sichtbare Sonnenlicht ignorieren, was sie ideal für die Umweltanalyse macht.
Wie werden diese Halbleiterbauelemente hergestellt?
Die Herstellung erfolgt mittels Molekularstrahlepitaxie (MBE) und anschließender technologischer Prozesse wie der Photolithographie.
Warum ist die Kontrolle der UV-Bestrahlung wichtig?
Um den menschlichen Körper vor Strahlenbelastung zu schützen und Verbrennungsprozesse in der Industrie schadstoffarm zu regeln.
Welche Rolle spielt die Quanteneffizienz bei Photodioden?
Sie gibt an, wie effektiv die Diode einfallende Photonen in elektrischen Strom umwandelt; im Werk werden Werte bis zu 64 % erreicht.
- Arbeit zitieren
- Johannes M. Sieß (Autor:in), 1999, Herstellung und Charakterisierung von Photodioden auf der Basis von BeMgZnSe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185379