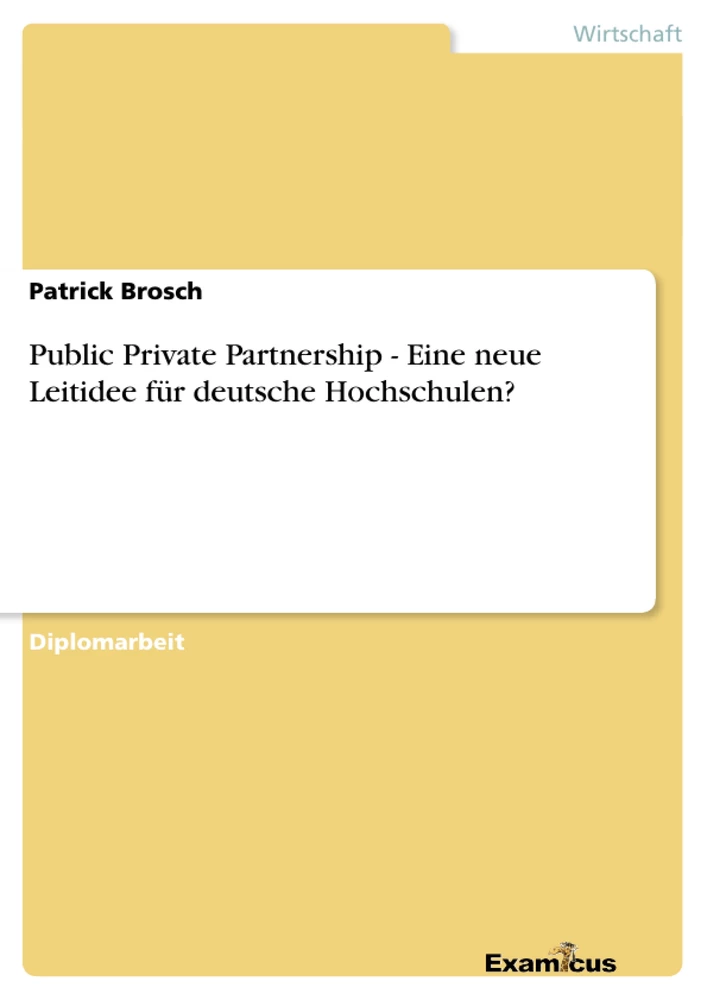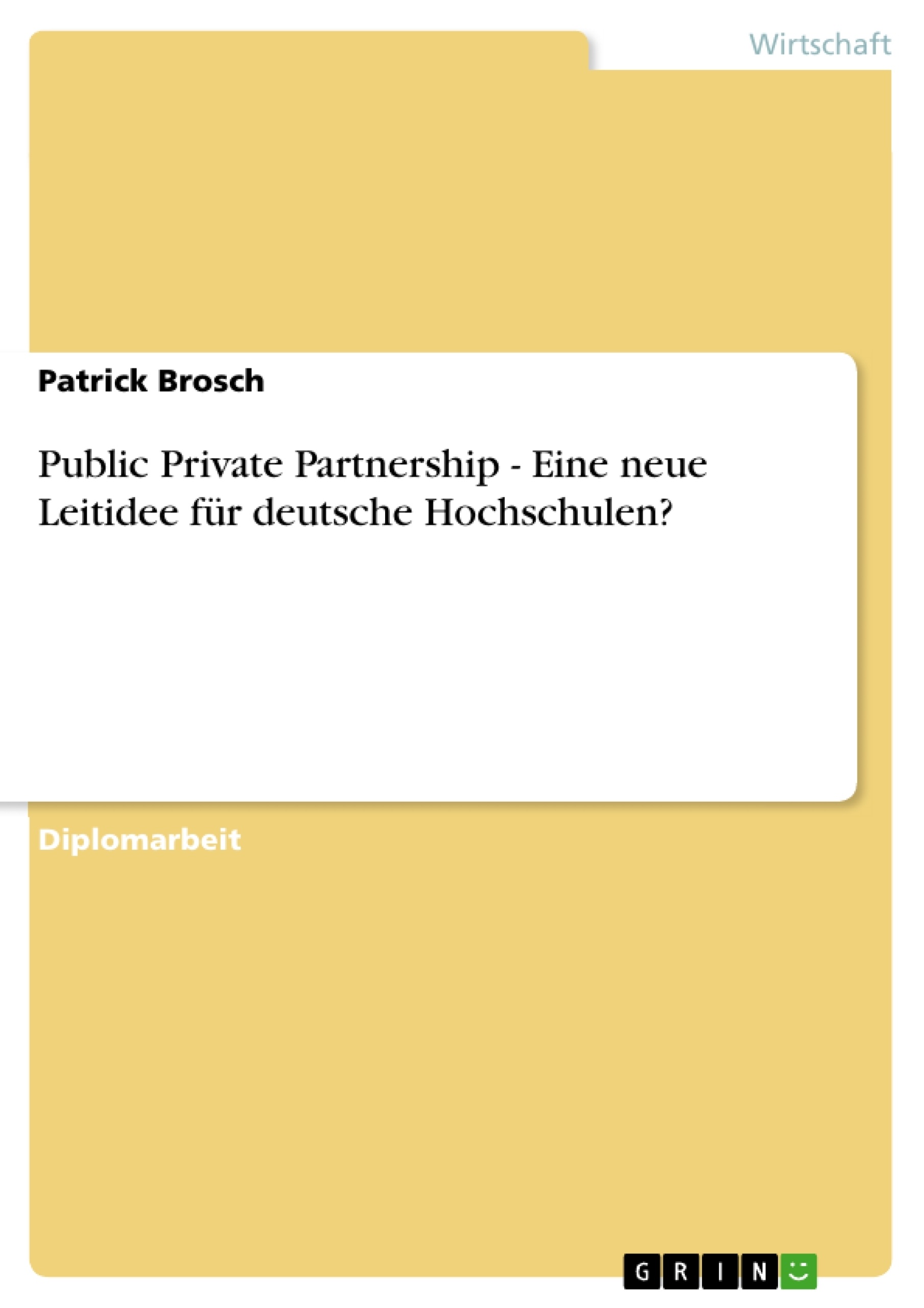Public Private Partnership (PPP) ist ein in den USA entstandenes Konzept, das die direkte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Einrichtungen und privater Wirtschaft symbolisiert. Beide Seiten verfolgen dabei bestimmte persönliche Interessen, so erhofft sich die öffentliche Institution vor allem wirtschaftliche Vorteile, während das Unternehmen z.B. aus Imagegründen investiert. Beispiele für diese Form der Kooperation gibt es viele. Unternehmen oder Unternehmensgruppen investieren etwa in kulturelle Veranstaltungen, in öffentliche Medien, in Forschungszentren oder in Hochschulen.
In dieser Arbeit wird Public Private Partnership am Beispiel öffentlicher Hochschulen dargestellt. Gerade auf diesem Sektor ist das Interesse an privaten Förderern in den letzten Jahren stark gestiegen. Hauptgrund dafür ist wohl die Finanznot an den deutschen Hochschulen und die wachsende Konkurrenz zwischen den verschiedenen Universitäten bzw. Fachhochschulen. Das Prinzip eröffnet beiden Seiten Chancen, birgt aber auch Risiken, die hier aufgezeigt werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Public Private Partnership - ein neues Schlagwort
- 2.1 Konzept des PPP im Wissenschaftssektor
- 2.2 Voraussetzungen für die Realisierung der Ziele in einer PPP
- 2.3 Kooperationsformen
- 2.3.1 Praxisorientierte Studiengänge
- 2.3.2 Berufsvorbereitung
- 2.3.3 Existenzgründungsförderung
- 2.3.4 Die berufsbezogene, wissenschaftliche Weiterbildung
- 2.3.5 Leitprojekte und Leitkonzepte
- 2.3.6 Ausgründung verschiedener Aktivitäten
- 2.3.7 Sponsorship-Leistungen
- 2.4 Mögliche Probleme bei Public Private Partnerships
- 2.4.1 Managementprobleme
- 2.4.2 Ziel-, Wahrnehmungs- und Verhaltensdivergenzen
- 2.5 PPP in anderen Sektoren
- 2.5.1 PPP in der Forschung
- 2.5.2 PPP im Kultursektor
- 2.5.3 Öko-Sponsoring
- 2.5.4 Weitere Bereiche
- 3. Deutsche Hochschulen unter dem Druck des internationalen Innovationswettbewerbs
- 3.1 Ziele der Hochschule
- 3.1.1 Beschaffungsziele
- 3.1.2 Kommunikationsziele
- 3.1.3 Lernziele
- 3.2 Gegenleistungen der Hochschule
- 3.2.1 Projektrealisierung
- 3.2.2 Image
- 3.2.3 Zielgruppen
- 3.2.4 Kommunikative Unterstützung
- 4. Unternehmen als Kooperationspartner von Hochschulen
- 4.1 Ziele des Unternehmens
- 4.1.1 Wissens- und Know-How-Transfer
- 4.1.2 Bekanntheitsgrad
- 4.1.3 Image
- 4.1.4 Goodwill
- 4.1.5 Kontaktpflege
- 4.1.6 Unternehmenskultur
- 4.1.7 Ökonomische Ziele
- 4.2 Zielgruppen
- 4.3 Klassifikation möglicher Gesponsorter
- 5. Instrumente des PPP
- 5.1 Mäzenatentum
- 5.2 Spenden
- 5.3 Sponsoring
- 5.4 Fördervereine
- 5.5 Stiftungen
- 6. Rechtliche und steuerliche Aspekte des PPP
- 6.1 Rechtliche Aspekte
- 6.2 Steuerliche Aspekte
- 7. Praktische Umsetzung / Vorgehensweise
- 7.1 Partnersuche
- 7.2 Gemeinsame Planung und Zielsetzung
- 7.3 Vertrag
- 7.4 Durchführung
- 7.5 Kontrolle
- 7.5.1 Prozeßkontrolle
- 7.5.2 Parallelkontrolle
- 7.5.3 Abschlußkontrolle
- 8. PPPs in Deutschland und den USA
- 8.1 Der Vergleich USA - Deutschland
- 8.2 Fallbeispiel „Kooperativer Bachelor Studiengang Informatik“ an der Fachhochschule Darmstadt
- 8.2.1 Das PPP-Modell
- 8.2.2 Ziele der PPP
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Public Private Partnerships (PPPs) im Kontext deutscher Hochschulen. Ziel ist es, das Konzept des PPP zu erläutern, die Chancen und Risiken für Hochschulen und Unternehmen aufzuzeigen und praktische Umsetzungsmöglichkeiten zu diskutieren. Die Arbeit beleuchtet dabei verschiedene Aspekte des PPP-Modells.
- Konzept und Kooperationsformen von PPPs im Hochschulbereich
- Ziele und Herausforderungen für Hochschulen und Unternehmen in PPPs
- Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen von PPPs
- Praktische Umsetzung und Erfolgsfaktoren von PPPs
- Vergleich von PPPs in Deutschland und den USA
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Public Private Partnerships (PPPs) ein und beschreibt deren Bedeutung im Kontext deutscher Hochschulen, insbesondere vor dem Hintergrund der finanziellen Herausforderungen und des internationalen Wettbewerbs. Der Fokus liegt auf der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Einrichtungen und der Privatwirtschaft, wobei die jeweiligen Interessen beider Seiten beleuchtet werden.
2. Public Private Partnership - ein neues Schlagwort: Dieses Kapitel definiert das Konzept der PPP im Wissenschaftssektor und beschreibt verschiedene Kooperationsformen wie praxisorientierte Studiengänge, Berufsvorbereitung, Existenzgründungsförderung, berufsbezogene Weiterbildung, Leitprojekte, Ausgründungen und Sponsoring-Leistungen. Es werden Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung von PPPs genannt und mögliche Probleme wie Managementprobleme und Zielkonflikte aufgezeigt. Zusätzlich werden Beispiele aus anderen Sektoren wie Forschung, Kultur und Öko-Sponsoring präsentiert, um das breite Anwendungsspektrum von PPPs zu illustrieren.
3. Deutsche Hochschulen unter dem Druck des internationalen Innovationswettbewerbs: Dieses Kapitel analysiert die Ziele deutscher Hochschulen im Kontext von PPPs, einschließlich Beschaffungs-, Kommunikations- und Lernzielen. Es beschreibt die Gegenleistungen der Hochschulen, wie die Unterstützung bei Projektrealisierungen, Imageverbesserung und die gezielte Ansprache von Zielgruppen. Die Bedeutung kommunikativer Unterstützung für erfolgreiche Partnerschaften wird hervorgehoben.
4. Unternehmen als Kooperationspartner von Hochschulen: Hier werden die Ziele von Unternehmen bei Kooperationen mit Hochschulen untersucht. Dies beinhaltet den Wissens- und Know-How-Transfer, die Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Images, den Aufbau von Goodwill, die Kontaktpflege und die Förderung der Unternehmenskultur. Die ökonomischen Ziele der Unternehmen im Kontext von PPPs werden ebenfalls beleuchtet, ebenso wie die verschiedenen Zielgruppen, die durch diese Partnerschaften erreicht werden sollen.
5. Instrumente des PPP: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Instrumente, die im Rahmen von PPPs eingesetzt werden können, wie Mäzenatentum, Spenden, Sponsoring und die Beteiligung von Fördervereinen und Stiftungen. Es analysiert die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit und deren jeweilige Vor- und Nachteile.
6. Rechtliche und steuerliche Aspekte des PPP: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für PPPs. Es beleuchtet die relevanten Rechtsvorschriften und steuerlichen Regelungen, die für die Gestaltung und Umsetzung von PPPs berücksichtigt werden müssen.
7. Praktische Umsetzung / Vorgehensweise: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf der praktischen Umsetzung von PPPs, beginnend mit der Partnersuche über die gemeinsame Planung und Zielsetzung bis hin zur Vertragsgestaltung, Durchführung und Kontrolle. Es werden verschiedene Kontrollmechanismen vorgestellt, um den Erfolg der Zusammenarbeit zu gewährleisten.
8. PPPs in Deutschland und den USA: Dieses Kapitel vergleicht PPPs in Deutschland und den USA und analysiert ein Fallbeispiel eines kooperativen Bachelor-Studiengangs Informatik an der Fachhochschule Darmstadt, um die praktische Umsetzung und die erzielten Ergebnisse einer PPP aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Public Private Partnership (PPP), Hochschulen, Unternehmen, Kooperationen, Sponsoring, Mäzenatentum, Wissenschaftssektor, Finanzierung, Innovation, Rechtliche Aspekte, Steuerliche Aspekte, Praxisorientierte Studiengänge, Deutschland, USA.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Public Private Partnerships (PPPs) an deutschen Hochschulen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Public Private Partnerships (PPPs) im Kontext deutscher Hochschulen. Sie erläutert das PPP-Konzept, zeigt Chancen und Risiken für Hochschulen und Unternehmen auf und diskutiert praktische Umsetzungsmöglichkeiten. Verschiedene Aspekte des PPP-Modells werden beleuchtet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Konzept und Kooperationsformen von PPPs im Hochschulbereich, Ziele und Herausforderungen für Hochschulen und Unternehmen in PPPs, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen, praktische Umsetzung und Erfolgsfaktoren, sowie ein Vergleich von PPPs in Deutschland und den USA.
Welche Kooperationsformen von PPPs im Hochschulbereich werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Kooperationsformen, darunter praxisorientierte Studiengänge, Berufsvorbereitung, Existenzgründungsförderung, berufsbezogene Weiterbildung, Leitprojekte, Ausgründungen und Sponsoring-Leistungen.
Welche Ziele verfolgen Hochschulen und Unternehmen in PPPs?
Hochschulen verfolgen Ziele wie die Verbesserung der Beschaffung, Kommunikation und des Lernens. Unternehmen hingegen zielen auf Wissens- und Know-How-Transfer, Steigerung des Bekanntheitsgrades und Images, Aufbau von Goodwill, Kontaktpflege, Förderung der Unternehmenskultur und ökonomische Ziele ab.
Welche rechtlichen und steuerlichen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit gibt einen Überblick über die relevanten Rechtsvorschriften und steuerlichen Regelungen, die für die Gestaltung und Umsetzung von PPPs berücksichtigt werden müssen.
Wie wird die praktische Umsetzung von PPPs beschrieben?
Die praktische Umsetzung wird Schritt für Schritt beschrieben: von der Partnersuche über die gemeinsame Planung und Zielsetzung bis hin zur Vertragsgestaltung, Durchführung und Kontrolle (Prozess-, Parallel- und Abschlusskontrolle).
Wie werden PPPs in Deutschland und den USA verglichen?
Die Arbeit vergleicht PPPs in beiden Ländern und analysiert ein Fallbeispiel: einen kooperativen Bachelor-Studiengang Informatik an der Fachhochschule Darmstadt.
Welche Instrumente des PPP werden genannt?
Die Arbeit nennt verschiedene Instrumente: Mäzenatentum, Spenden, Sponsoring, Fördervereine und Stiftungen.
Welche Probleme können bei Public Private Partnerships auftreten?
Mögliche Probleme sind Managementprobleme und Ziel-, Wahrnehmungs- und Verhaltensdivergenzen zwischen den Partnern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Public Private Partnership (PPP), Hochschulen, Unternehmen, Kooperationen, Sponsoring, Mäzenatentum, Wissenschaftssektor, Finanzierung, Innovation, Rechtliche Aspekte, Steuerliche Aspekte, Praxisorientierte Studiengänge, Deutschland, USA.
- Arbeit zitieren
- Patrick Brosch (Autor:in), 2000, Public Private Partnership - Eine neue Leitidee für deutsche Hochschulen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185402