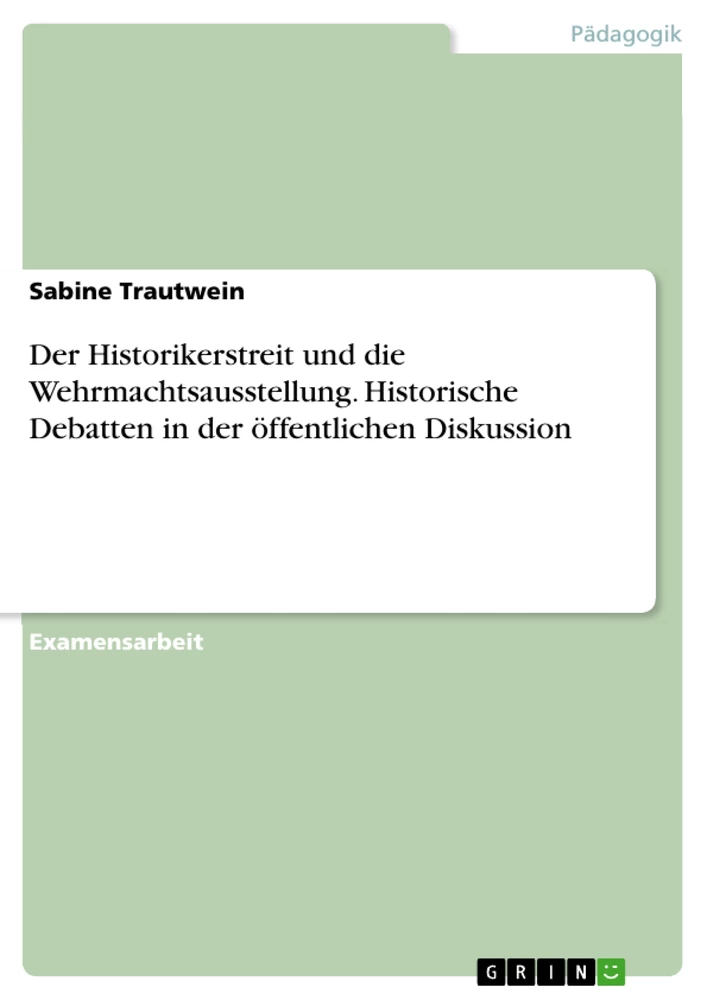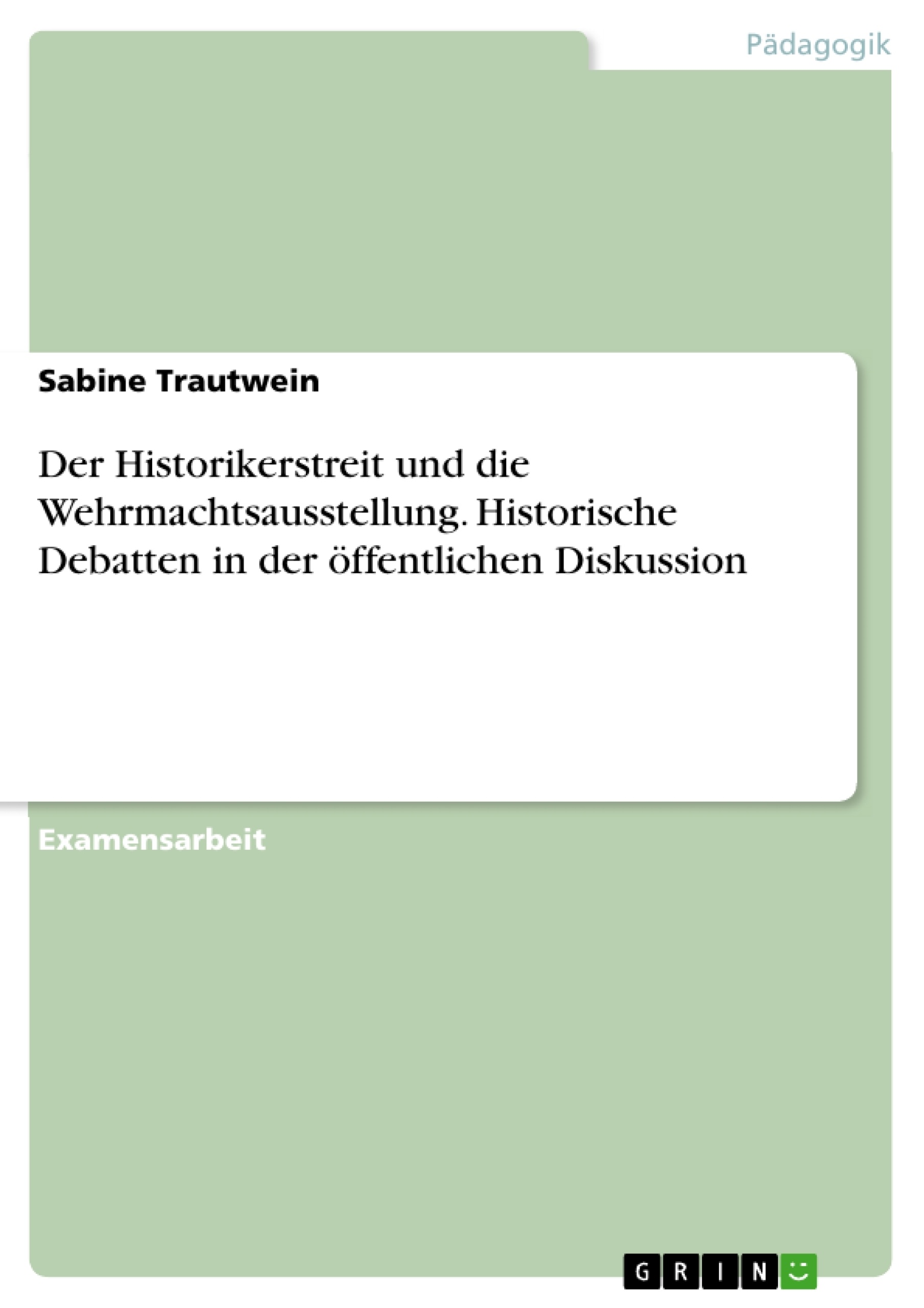Der Historikerstreit und die Wehrmachtsausstellung haben in der Bundesrepublik Deutschland tiefsitzende Widersprüche bloßgelegt. Kein geschichtspolitischer Versuch der Vergangenheitsbewältigung hat die deutsche Öffentlichkeit in den letzten Jahren so erregt wie die Ausstellung „Vernichtungskrieg.Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“, die vom Hamburger Institut für Sozialforschung am 5. März 1995 zum ersten Mal präsentiert, und seitdem in deutschen Städten gezeigt wurde. Nachdem die Ausstellung vier Jahre lang gezeigt wurde, konkretisierten sich die schon seit Beginn geäußerten Zweifel an ihrer wissenschaftlichen Genauigkeit. Der polnische
Historiker Bogdan Musial und der ungarische Geschichtsforscher Krisztian Ungvary haben in wissenschaftlichen Fachaufsätzen die Fragwürdigkeit der Aussage- und Beweiskraft von Bildern der Ausstellung nachgewiesen. Dies hat dazu geführt, daß sie für drei Monate geschlossen wurde, um ein Überarbeitung zu ermöglichen.
Die Schwierigkeiten bei der Darstellung der öffentlichen Debatte um den Historikerstreit lagen in der übermäßigen Politisierung und Moralisierung der Materie. Gegenseitige Vorwürfe moralischer Inkompetenz überlagerten nicht selten die fachwissenschaftliche
Aussage. Dem Gegenstand nicht angemessene, den Andersdenkenden teilweise beleidigende Aussagen und Formulierungen erschwerten, beziehungsweise verhinderten eine sachliche und fruchtbringende Diskussion. Die ideologisierende Emotionalisierung eröffnete Jürgen Habermas mit seinen persönlichen Angriffen auf Ernst Nolte und dessen
umstrittene Thesen. Aber auch die Gegenseite um Klaus Hildebrand und Michael Stürmer bediente sich nicht selten der Irrationalität. Namentlich hielt sich jede Seite zugute, alleine die reine Wissenschaft zu vertreten, während die andere nur Ideologie betreibe. Es ging, auf den Historikerstreit bezogen, nicht um die Präsentation neuer Quellen- und Forschungsergebnisse und deren Verarbeitung in größere Interpretationszusammenhänge.
Vielmehr standen Grundfragen des Verständnisses der deutschen Geschichte im Hinblick auf das geschichtliche und politische Bewußtsein der Gegenwart im Vordergrund. In diesem Zusammenhang lag ein Vergleich mit der Fischer - Kontroverse, die 1961 einsetzte und Deutschlands Rolle vor und im Ersten Weltkrieg thematisierte, nahe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Methodik
- II. Forschungsüberblick
- 1. Der Historikerstreit
- 2. Die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944"
- 3. Die öffentliche Komponente
- III. Die Erinnerung an den Nationalsozialismus im Spiegel von Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik
- 1. Erinnerungskultur
- 2. Erinnerungspolitik
- IV. Deutsche Geschichtswissenschaft und Nationalsozialismus
- 1. Die Totalitarismusforschung
- 2. Intentionalismus contra Funktionalismus
- 3. Die Täter und ihre Weltanschauung
- V. Die Systemlogik von Wissenschaft und Öffentlichkeit
- 1. Die Wissenschaft
- 2. Die massenmediale Öffentlichkeit
- VI. Geschichte in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit
- 1. Geschichte zwischen Wissenschaft und Lebenswelt
- 2. Geschichte als Begründung des persönlichen Standpunktes
- 3. Besonderheiten zwischen Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit
- 3.1 Historiker und Öffentlichkeit
- 3.2 Wissenschaftliche und öffentliche Sicht des Nationalsozialismus
- VII. Der Historikerstreit
- 1. Einleitende Bemerkungen
- 2. Die Auslöser des Historikerstreits
- 2.1 Ernst Nolte
- 2.2 Andreas Hillgruber
- 2.3 Jürgen Habermas
- 3. Jürgen Habermas: „Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung“
- 4. Die Diskussion um den Historikerstreit
- 4.1 Allgemeine Betrachtungen
- 4.2 Der Gang der Habermas - Kontroverse
- 5. Die Äußerungen von Klaus Hildebrand, Michael Stürmer und Joachim Fest
- 5.1 Klaus Hildebrand
- 5.2 Michael Stürmer
- 5.3 Joachim Fest
- 6. Die Äußerungen von Eberhard Jäckel, Heinrich August Winkler, Hans und Wolfgang Mommsen sowie Rudolf Augstein
- 6.1 Eberhard Jäckel
- 6.2 Heinrich August Winkler
- 6.3 Hans Mommsen
- 6.4 Wolfgang Mommsen
- 6.5 Rudolf Augstein
- 7. Weitere Beiträge zum Historikerstreit
- 7.1 Hagen Schulze
- 7.2 Thomas Nipperdey
- 7.3 Martin Broszat
- 7.4 Christian Meier
- 8. Der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit
- 8.1 „Historisierung“
- 8.2 Kritik der,,Historisierung“
- 8.3 „Normalisierung“
- 9. Nationalsozialismus und nationale Identität
- 9.1 Die nationale Identität als Streitpunkt in der Historikerdebatte
- 9.2 1989/90 - Die Verwirklichung der nationalen Einheit
- 9.3 Der Historikerstreit aus heutiger Sicht
- 9.4 Wissenschaft und Politik im Selbstverständnis der Zeithistorie
- VIII. Das Ausland und der deutsche Historikerstreit
- 1. Reaktionen in Israel
- 2. Reaktionen in den USA
- 3. Reaktionen in Osteuropa
- 3.1 Sowjetunion
- 3.2 Tschechoslowakei, Polen, DDR
- 4.Reaktionen in Westeuropa
- 4.1 Frankreich
- 4.2 Großbritannien
- 4.3 Italien
- 4.4 Österreich
- 5. Resümee der Auslandbetrachtungen
- IX. Die deutsche Presse als Meinungsführer
- 1. Die „Popularität“ des Historikerstreits
- 2."Die Frankfurter Allgemeine Zeitung"
- 3.,,Die Zeit"
- 4."Die Süddeutsche Zeitung"
- 5.,,Die Frankfurter Rundschau"
- 6. „Der Spiegel"
- 7.,,Focus"
- 8. Sich widerspiegelnde Positionen - Die „Historikerstreiter“ und die Zeitungen
- X. Die Ausstellung: „Vernichtungskrieg. Die Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944"
- 1. Die Zielsetzung der Aussteller
- 2. Die Wirkung der Ausstellung in der Öffentlichkeit
- Exkurs: Formen der Vergangenheitsbewältigung
- 3. Warum entstand eine öffentliche Diskussion um die Wehrmachtsausstellung?
- 4. Die Medien und die Wehrmachtsausstellung
- 4.1 „Die Zeit“ als Vorreiter
- 4,2 Die zunehmende Politisierung der öffentlichen Debatte um die Wehrmachtsausstellung
- 5. Die Entstehung der öffentliche Diskussion um die Wehrmachtsausstellung
- 5.1 Wie stellte die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“ Öffentlichkeit her?
- 5.2 Stuttgart 10.9.1995 bis 12.10.1995
- 5.3 Freiburg im Breisgau 10.1.1986 bis 11.2.1996
- 5.4 Karlsruhe 10.1.1997 bis 16.2.1997
- 5.5 Konstanz 24.10.1997 bis 26.11.1997
- 6. Auswertung der Untersuchungsergebnisse
- 6.1 Die Unterschiedlichkeit der öffentlichen Diskurse
- 6.2 Die Eigendynamik der öffentlichen Diskurse
- XI Der Historikerstreit und die Wehrmachtsausstellung - Ein Vergleich der öffentlichen Debatten
- 1.,,Öffentlichkeit“ contra „inszenierte Öffentlichkeit"
- 2. Die unterschiedlichen Ebenen der Diskussionen
- 3. Die persönliche Dimension
- 4. Die unterschiedlichen Funktionen von Leserbriefen in den Diskussionen um den Historikerstreit sowie um die Wehrmachtsausstellung
- 5. Legendenbildung
- 6. Die Politisierung der Debatten
- 7. Das moralische Element beider Debatten
- 8. Die wissenschaftliche Komponente beider Debatten
- 9. Die Medien als Multiplikatoren des öffentlichen Interesses
- 10. Fazit des Vergleichs
- Schlußbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- 1. Primärliteratur
- 2. Sekundärliteratur
- 3. Veröffentlichungen in Zeitungen und Nachrichtenmagazinen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Historikerstreit und der Wehrmachtsausstellung, zwei bedeutenden Debatten in der deutschen Öffentlichkeit, die sich mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandersetzen. Die Arbeit analysiert die Entstehung, die Entwicklung und die Auswirkungen dieser Debatten, wobei ein besonderer Fokus auf die Rolle der Medien und der öffentlichen Meinung gelegt wird.
- Die Rolle der Medien in der öffentlichen Meinungsbildung
- Die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in der deutschen Gesellschaft
- Die Bedeutung von Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik
- Die wissenschaftliche und öffentliche Debatte um den Historikerstreit und die Wehrmachtsausstellung
- Der Vergleich der öffentlichen Debatten um den Historikerstreit und die Wehrmachtsausstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Historikerstreits und der Wehrmachtsausstellung ein und beleuchtet die Bedeutung dieser Debatten für die deutsche Gesellschaft. Sie stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Kapitel I behandelt die Methodik der Arbeit. Es werden die verwendeten Forschungsmethoden und die theoretischen Grundlagen der Arbeit erläutert.
Kapitel II bietet einen Forschungsüberblick über den Historikerstreit und die Wehrmachtsausstellung. Es werden die wichtigsten Akteure, die zentralen Argumente und die wichtigsten Publikationen vorgestellt.
Kapitel III befasst sich mit der Erinnerung an den Nationalsozialismus im Spiegel von Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik. Es werden die unterschiedlichen Formen der Erinnerungskultur und die Rolle der Erinnerungspolitik in der deutschen Gesellschaft analysiert.
Kapitel IV untersucht die deutsche Geschichtswissenschaft und den Nationalsozialismus. Es werden die wichtigsten Forschungsansätze und die Debatten um die Interpretation der nationalsozialistischen Vergangenheit beleuchtet.
Kapitel V analysiert die Systemlogik von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Es werden die unterschiedlichen Funktionsweisen von Wissenschaft und Öffentlichkeit und die Interaktion zwischen beiden Bereichen untersucht.
Kapitel VI befasst sich mit der Geschichte in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschichte und die Rolle der Geschichte in der öffentlichen Debatte analysiert.
Kapitel VII untersucht den Historikerstreit im Detail. Es werden die wichtigsten Akteure, die zentralen Argumente und die wichtigsten Publikationen vorgestellt.
Kapitel VIII analysiert die Reaktionen auf den Historikerstreit im Ausland. Es werden die Reaktionen in Israel, den USA, Osteuropa und Westeuropa beleuchtet.
Kapitel IX untersucht die Rolle der deutschen Presse als Meinungsführer im Historikerstreit. Es werden die wichtigsten Zeitungen und ihre Positionen in der Debatte analysiert.
Kapitel X befasst sich mit der Wehrmachtsausstellung. Es werden die Zielsetzung der Aussteller, die Wirkung der Ausstellung in der Öffentlichkeit und die Entstehung der öffentlichen Diskussion um die Ausstellung analysiert.
Kapitel XI vergleicht die öffentlichen Debatten um den Historikerstreit und die Wehrmachtsausstellung. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Debatten herausgearbeitet.
Die Schlußbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen für die weitere Forschung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Historikerstreit, die Wehrmachtsausstellung, die Erinnerungskultur, die Erinnerungspolitik, die deutsche Geschichtswissenschaft, die öffentliche Meinung, die Medien und die Vergangenheitsbewältigung. Die Arbeit analysiert die Entstehung, die Entwicklung und die Auswirkungen dieser Debatten, wobei ein besonderer Fokus auf die Rolle der Medien und der öffentlichen Meinung gelegt wird.
Häufig gestellte Fragen
Was war der "Historikerstreit" in den 1980er Jahren?
Eine wissenschaftliche und öffentliche Debatte über die Einzigartigkeit des Holocaust und die Interpretation der deutschen Geschichte (Nolte vs. Habermas).
Worum ging es in der "Wehrmachtsausstellung"?
Die Ausstellung thematisierte die Verbrechen der Wehrmacht im Vernichtungskrieg 1941–1944 und zerstörte die Legende von der "sauberen Wehrmacht".
Welche Rolle spielten die Medien in diesen Debatten?
Zeitungen wie die "FAZ" und "Die Zeit" fungierten als Meinungsführer und Multiplikatoren, die die akademischen Streitigkeiten in die breite Öffentlichkeit trugen.
Warum wurde die Wehrmachtsausstellung zeitweise geschlossen?
Wegen berechtigter Zweifel an der wissenschaftlichen Genauigkeit einiger Bilder musste sie für drei Monate zur Überarbeitung geschlossen werden.
Was versteht man unter "Vergangenheitsbewältigung"?
Der Prozess der moralischen und historischen Auseinandersetzung einer Gesellschaft mit den Verbrechen ihrer eigenen Vergangenheit.
- Quote paper
- Sabine Trautwein (Author), 2000, Der Historikerstreit und die Wehrmachtsausstellung. Historische Debatten in der öffentlichen Diskussion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185496