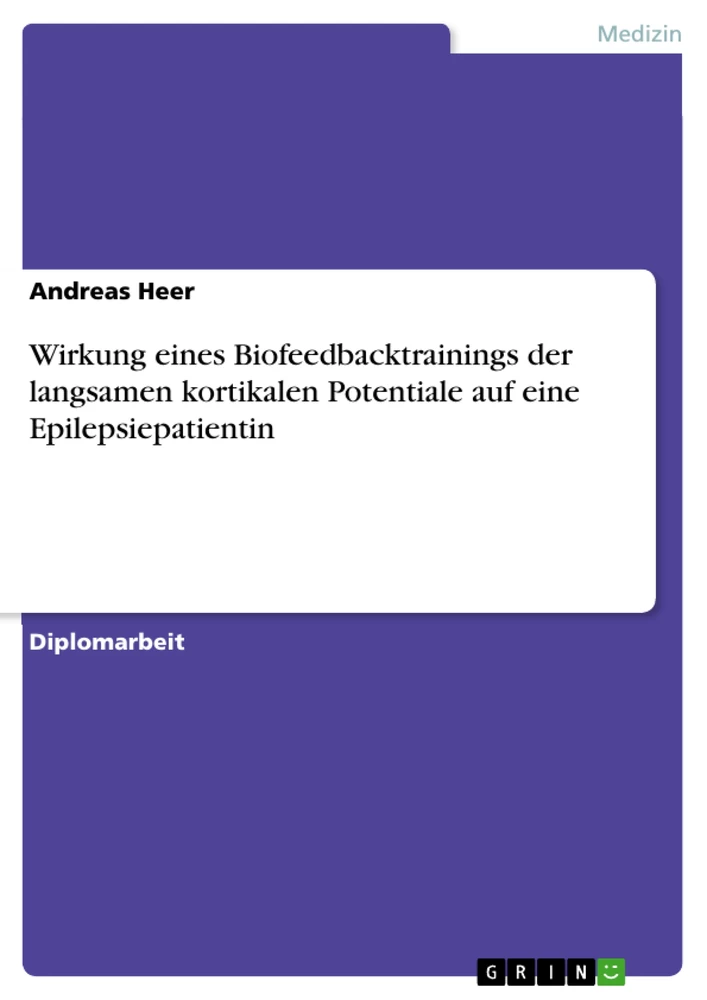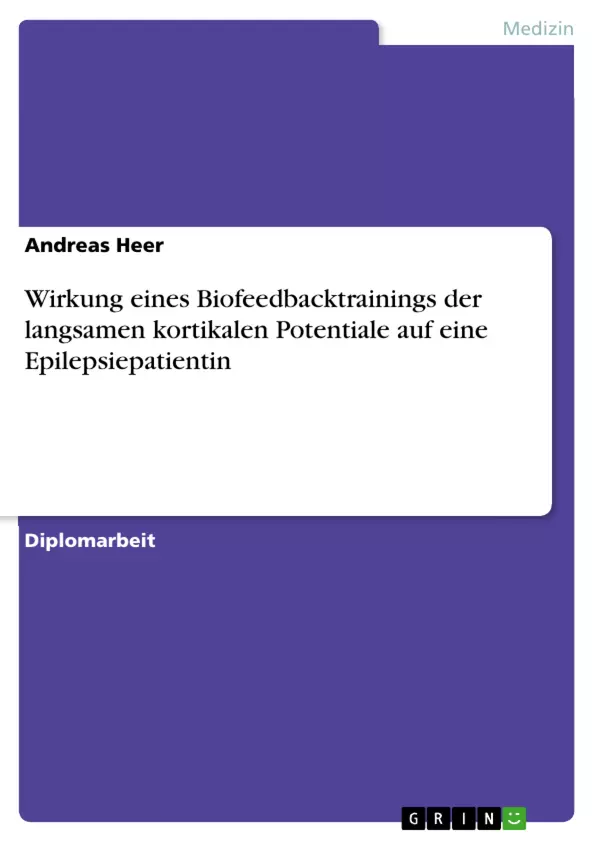In den letzten Jahrzehnten konnte durch verschiedene Forschungsprojekte gezeigt werden, daß die neurophysiologische Aktivität des menschlichen Gehirns durch die Methode Biofeedback der willentlichen Kontrolle zugänglich gemacht werden kann. Diese Erkenntnis ist um so erstaunlicher, da die neurophysiologische Aktivität des Gehirns der bewußten Wahrnehmung entzogen ist. Das ist ein Fortschritt von großer Tragweite, denn dadurch wird es möglich das menschliche Verhalten direkt zu beeinflussen.
In Biofeedbackuntersuchungen wird einer Versuchsperson die Entwicklung ihrer langsamen kortikalen Potentiale (LP) rückgemeldet, dadurch erhält sie die Möglichkeit ihre LP willentlich zu beeinflussen. Für Potentialverschiebungen in die vorgegebene Richtung wird die Versuchsperson positiv verstärkt und so wird es möglich die LP-Selbstkontrolle zu erlernen. Nach der Theorie von Elbert und Rockstroh (1987) stellen die LP ein neurophysiologisches Korrelat der Aufmerksamkeitsregulation dar. Das LP-Biofeedbacktraining wurde bei Patientengruppen mit unterschiedlichen Erkrankungen (z.B. Aufmerksamkeitsstörungen, Schizophrenie, Depression) eingesetzt. Epilepsiepatienten erleiden auch aufgrund einer gestörten LP-Selbstregulation wiederkehrende Anfälle, durch das LP-Biofeedbacktraining kann sie wiederhergestellt bzw. verbessert werden.
Die Tübinger Arbeitsgruppe um Professor Birbaumer entwickelte ein Therapieprogramm mit dem Epilepsiepatienten die LP-Selbstkontrolle erlernen können (z.B. Strehl, 1998). Nach Durchlaufen dieses Therapieprogrammes zeigen Epilepsiepatienten eine deutliche Senkung der Anfallsfrequenz, damit stellt es eine wichtige Alternative zur herkömmlichen Epilepsiebehandlung mit Antiepileptika dar. Das Epilepsie Zentrum Berlin ist, durch den leitenden Neuropsychologen Heinz Hättig in diesem Forschungsfeld aktiv.
Durch die verbesserte Regulation der LP sollte auch die Aufmerksamkeitsleistung der Epilepsiepatienten gesteigert werden. Jedoch ist der Effekt auf die Aufmerksamkeit noch wenig untersucht. In der vorliegenden Arbeit werden die Auswirkungen eines Biofeedbacktrainings auf die Aufmerksamkeit und das Anfallsgeschehen der Epilepsiepatientin SZ untersucht. Durch Prüfung der Abweichung von Positivierung und Negativierung der LP wird die Lernleistung im Biofeedbacktraining überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Epilepsien
- Einführung und Definition
- Diagnostik von Epilepsien
- Klassifikation epileptischer Anfälle und Epilepsien
- Modelle zur Entstehung epileptischer Anfälle
- Psychische Aspekte von Epilepsien
- Behandlung von Epilepsien
- Elektroenzephalographie
- Einführung und Definition
- Das klinische EEG
- EEG und Chaos
- Langsame kortikale Potentiale
- Einführung und Definition
- Elektrogenese langsamer kortikaler Potentiale
- Neuroanatomie und Regulation von langsamen kortikalen Potentialen
- Das integrative Modell der langsamen kortikalen Potentiale
- Langsame kortikale Potentiale und die Schwellenregulation kortikaler Netzwerke
- Langsame kortikale Potentiale und Aufmerksamkeit
- Langsame kortikale Potentiale und Epilepsien
- Biofeedback
- Definition und Einführung
- Anwendung der Methode Biofeedback
- Die Methode Biofeedback zur Behandlung von Epilepsien
- Aufmerksamkeit
- Einführung und Definition
- Einige Aspekte von Aufmerksamkeitstheorien
- Das Modell von van Zomeren und Brouwer
- Steuerung und Kontrolle der Aufmerksamkeit
- Neuroanatomie und -physiologie der Aufmerksamkeit
- Epilepsien
- Fragestellungen und Hypothesen
- Fragestellungen
- Hypothesen
- Methoden
- Untersuchungsdesign
- Einzelfallanalysen im Allgemeinen
- Die vorliegende Einzelfallanalyse im Speziellen
- Charakteristik der Probanden und Institutioneller Rahmen der Untersuchung
- Meßinstrumente
- Testverfahren
- Fragebögen
- Andere Datenquellen und Testaufgaben
- Meßapparaturen
- Meßapparatur zur Erhebung der TAP
- Meßapparatur für das Biofeedbacktraining
- Meßapparatur zur Erhebung des EEG
- Untersuchungsplan
- Unabhängige Variablen
- Abhängige Variablen
- Kontrollvariablen
- Störvariablen
- Untersuchungsdurchführung
- Untersuchungsdurchführung der Testphasen (Meßphasen)
- Untersuchungsdurchführung der Treatmentphase (Biofeedbacksitzungen)
- Untersuchungsdurchführung der EEG-Sitzungen
- Datenbearbeitung und Datenauswertung
- Daten der TAP
- Biofeedbackdaten
- Anfallsdaten
- EEG-Daten
- Untersuchungsdesign
- Ergebnisse
- Langsame kortikale Potentiale
- Trainingsumfang
- Beobachtung während des Biofeedbacktrainings
- Strategien zur Positivierung und Negativierung
- Differenzierung von Positivierung und Negativierung
- Verlauf der Differenzierung von Positivierung und Negativierung
- Aufmerksamkeit
- Alertness
- Geteilte Aufmerksamkeit
- Go/Nogo
- Reaktionswechsel
- Gesamtschau der Ergebnisse zur Aufmerksamkeit
- Anfallsdaten
- Ergebnisse der Patientin SZ
- Ergebnisse zur Komplexität
- LP-Kurven
- LP-Kurven der kognitiven Items (Analogien, Rechenaufgaben, Wortflüssigkeit, emotionale Analogien und Zeitreihen)
- Entropiewerte
- Testverfahren und Fragebögen
- Testverfahren
- Fragebögen
- Langsame kortikale Potentiale
- Diskussion
- Aufmerksamkeitsleistungen
- Leistungen im Biofeedbacktraining
- Methodische Aspekte
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Wirkung eines Biofeedbacktrainings der langsamen kortikalen Potentiale (TAP) auf eine Epilepsiepatientin. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Effektivität dieser Methode zur Behandlung von Epilepsie in einem Einzelfall zu analysieren. Dabei wird die Veränderung der TAP, der Aufmerksamkeit und der Anfallsfrequenz der Patientin im Verlauf des Trainings untersucht.
- Die Wirkung des Biofeedbacktrainings auf die langsamen kortikalen Potentiale
- Die Veränderung der Aufmerksamkeit der Patientin im Verlauf des Trainings
- Die Auswirkungen des Trainings auf die Anfallsfrequenz der Patientin
- Die Anwendung des Biofeedbacktrainings als Therapieoption für Epilepsie
- Die Rolle der langsamen kortikalen Potentiale bei der Entstehung und Behandlung von Epilepsie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Epilepsie und des Biofeedbacktrainings ein und stellt die Forschungsfrage und die Hypothesen der Arbeit vor. Kapitel 1 bietet einen umfassenden theoretischen Hintergrund zu Epilepsie, Elektroenzephalographie, langsamen kortikalen Potentialen, Biofeedback und Aufmerksamkeit. Es werden verschiedene Modelle und Theorien zu diesen Themen vorgestellt und die Relevanz für die Untersuchung der Wirkung des Biofeedbacktrainings auf eine Epilepsiepatientin erläutert.
Kapitel 2 beschreibt die Fragestellungen und Hypothesen der Arbeit. Es werden vier Forschungsfragen formuliert, die sich auf die Veränderung der TAP, der Aufmerksamkeit, der Anfallsfrequenz und der Komplexität der EEG-Daten der Patientin im Verlauf des Biofeedbacktrainings beziehen. Die Hypothesen formulieren die erwarteten Ergebnisse der Untersuchung.
Kapitel 3 erläutert die Methoden der Untersuchung. Es wird das Untersuchungsdesign, die Charakteristik der Probanden, die Meßinstrumente, die Meßapparaturen, der Untersuchungsplan und die Untersuchungsdurchführung detailliert beschrieben. Die Datenbearbeitung und Datenauswertung werden ebenfalls dargestellt.
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es werden die Veränderungen der TAP, der Aufmerksamkeit, der Anfallsfrequenz und der Komplexität der EEG-Daten der Patientin im Verlauf des Biofeedbacktrainings dargestellt und analysiert.
Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es werden die Ergebnisse im Kontext der bestehenden Literatur interpretiert und die Bedeutung der Ergebnisse für die Behandlung von Epilepsie mit Biofeedbacktraining diskutiert. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse und die Limitationen der Untersuchung zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Biofeedback, langsame kortikale Potentiale, Epilepsie, Einzelfallanalyse, Aufmerksamkeit, EEG, Komplexität, Therapie, Behandlung, Neurofeedback.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Biofeedback bei langsamen kortikalen Potentialen (LP)?
Es ist eine Methode, bei der Patienten lernen, ihre neurophysiologische Gehirnaktivität willentlich zu kontrollieren, indem sie Rückmeldungen über ihre LP erhalten.
Wie hilft Biofeedback bei Epilepsie?
Epileptische Anfälle hängen oft mit einer gestörten LP-Selbstregulation zusammen. Durch das Training kann die Anfallsfrequenz deutlich gesenkt werden.
Welchen Einfluss hat das Training auf die Aufmerksamkeit?
LP gelten als neurophysiologisches Korrelat der Aufmerksamkeitsregulation. Das Training zielt darauf ab, auch die Aufmerksamkeitsleistung der Patienten zu steigern.
Was sind Positivierung und Negativierung der LP?
Es handelt sich um Verschiebungen der elektrischen Potentiale im Gehirn, die unterschiedliche Aktivierungszustände (Erregung vs. Hemmung) widerspiegeln.
Ist Biofeedback eine Alternative zu Medikamenten?
Die Arbeit beschreibt das LP-Biofeedbacktraining als eine wichtige ergänzende Alternative zur herkömmlichen Behandlung mit Antiepileptika.
- Arbeit zitieren
- Andreas Heer (Autor:in), 2001, Wirkung eines Biofeedbacktrainings der langsamen kortikalen Potentiale auf eine Epilepsiepatientin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185757