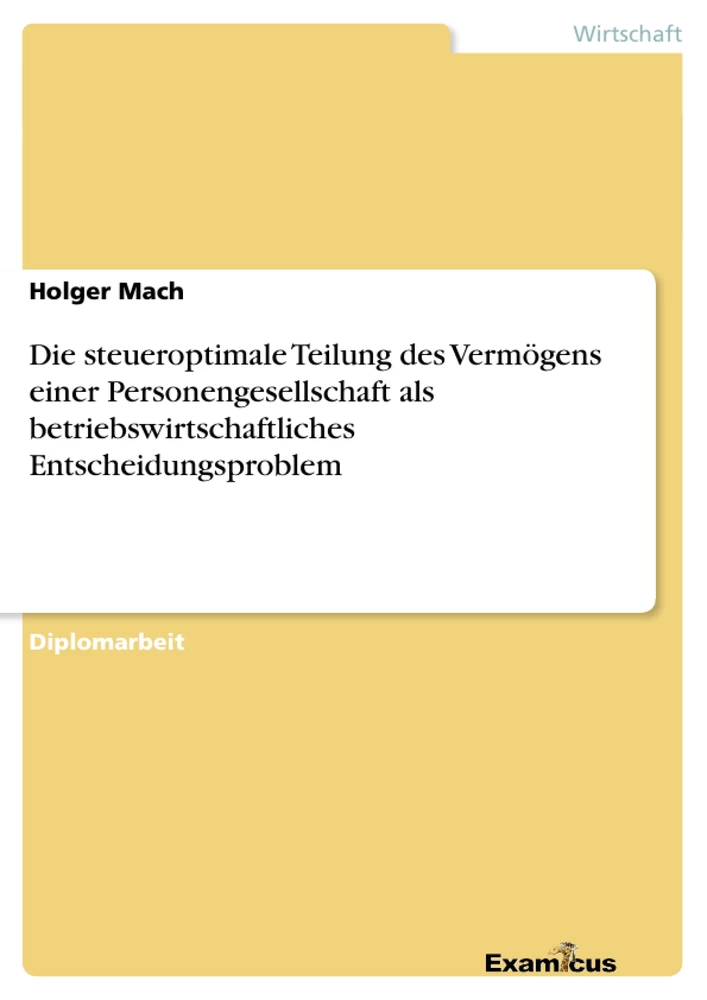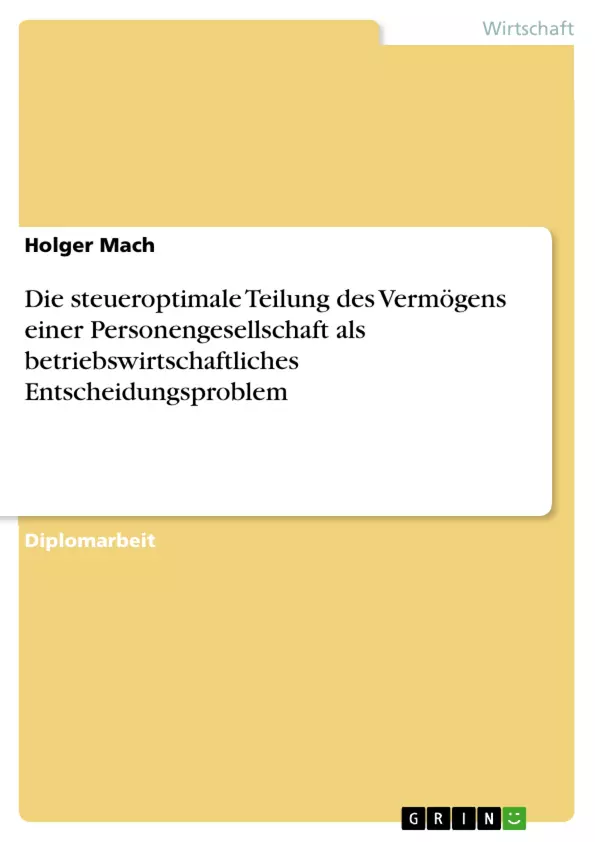Unabhängig von ihrem unternehmerischen Erfolg kann es bei einer Personengesellschaft irgendwann zu der Situation kommen, dass ihre Gesellschafter das bestehende Gesellschaftsvermögen nicht mehr in der bisherigen Zusammensetzung betrieblich fortführen wollen. Wenn zusätzlich der Wunsch besteht, dass das Vermögen nicht an außenstehende dritte Personen veräußert wird, sondern im Besitz einzelner, mehrerer oder aller Gesellschafter verbleibt, müssen sich die Gesellschafter für eine der vielen Möglichkeiten zur Teilung des Vermögens entscheiden. Hierbei sind sowohl Aufteilungen des Vermögens unter den Gesellschaftern als auch Vermögensverteilungen auf verschiedene Gesellschaften in unterschiedlichen Ausgestaltungen denkbar.
Für die Beantwortung der Frage, wie die Gesellschafter das Problem der Entscheidung für die richtige von vielen möglichen Teilungsalternativen lösen, ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Hintergründen und den Zielen eines solchen Teilungsvorhabens notwendig. Der Wunsch nach einer Teilung des Gesellschaftsvermögens kann vor allem im Hinblick auf gesellschafts- oder zivilrechtliche sowie betriebswirtschaftliche Aspekte entstehen. Auch private Umstände im persönlichen Umfeld der Gesellschafter sind eine mögliche Ursache.
Demgegenüber stellen steuerliche Gründe nur sehr selten den Auslöser für den Wunsch nach einer Teilung des bestehenden Gesellschaftsvermögens dar. Da die verschiedenen Teilungsvorgänge jedoch sehr unterschiedliche steuerliche Auswirkungen und hierdurch entstehende Belastungen für die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft verursachen, üben die Art und der Umfang der steuerlichen Behandlung der Teilung einen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidung aus, in welcher zivil-, gesellschafts- bzw. umwandlungsrechtlichen Form die Teilung durchgeführt werden soll. Insofern kommt der Zusammen-stellung der steuerlichen Folgen jeder einzelnen Teilungsalternative eine wichtige Bedeutung zu.
In der vorliegenden Arbeit soll die Lösung des Problems der Gesellschafter, sich für die aus ihrer Sicht optimale Teilungsform zu entscheiden, methodisch erarbeitet werden. Hierbei wird das Ziel der steueroptimalen Gestaltung der Teilung mit anderen unternehmerischen Zielen verknüpft. Einen derartig umfassenden Vergleich verschiedener Teilungsvorgänge unter Berücksichtigung mehrerer Zielsetzungen mit den Standardmethoden der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre zu erstellen, bereitet erhebliche Schwierigkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Einführung in den Untersuchungsgegenstand
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Einordnung innerhalb der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre
- Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes
- Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre
- Entscheidungstheoretische Ansätze
- Begriff der Entscheidungstheorie
- Klassifizierung der Entscheidungstheorie
- Betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie
- Betrieblicher Entscheidungsvorgang
- Deskriptiver Ansatz als Grundüberlegung
- Ablauf des betrieblichen Entscheidungsprozesses
- Grundmodell der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre
- Grundlagen der Modellbildung
- Aufbau und Wirkungsweise des Grundmodells
- Elemente des Grundmodells
- Entscheidungsträger
- Zielsystem
- Zielklassifizierungen
- Präferenzen
- Entscheidungsregeln
- Entscheidungsfeld
- Handlungsalternativen
- Umweltzustände
- Ergebnisfunktion
- Ergebnismatrix
- Entscheidungsmatrix
- Andere Darstellungsformen
- Entwicklung eines steueroptimalen Entscheidungsmodells
- Zusätzliche Prämissen des Modellansatzes
- Personengesellschaft als Entscheidungsträger
- Begriff der Personengesellschaft und des Gesamthandsvermögens
- Personengesellschaft im Steuerrecht
- Zielsystem der Personengesellschaft
- Ziele der Personengesellschaft
- Zielbeziehungen und Präferenzen
- Nutzenzuweisung durch Entscheidungsregeln
- Entscheidungsfeld der Personengesellschaft
- Teilungsvorgänge als Handlungsalternativen
- Spaltung
- Umwandlungsrechtliche Spaltungsarten
- Formen der Spaltung
- Realteilung unter gleichzeitiger Auflösung der Personengesellschaft
- Definition der Realteilung
- Formen der Realteilung
- Gesellschafteraustritt mit Sachwertabfindung
- Sonstige Vermögensübertragungen
- Zwischenfazit nach Abgrenzung der Teilungsvorgänge
- Bestimmung der Umweltsituation
- Unternehmenspolitische Ergebnisfunktion
- Steuerliche Ergebnisfunktion
- Auswahl der steuerlichen Ergebniskriterien
- Wertansatz des zu teilenden Vermögens
- Einkommensteuerliche Folgen
- Gewerbesteuerliche Folgen
- Steuerliche Konsequenzen der Spaltungsvorgänge
- Grundsätzliche steuerliche Behandlung
- Wertansatzwahlrecht der aufnehmenden Gesellschaft
- Steuerfolgen der Spaltungen auf Personengesellschaften
- Einkommensteuerliche Behandlung bei Übertragung von Teilbetrieben, Mitunternehmer- und Kapitalgesellschaftsanteilen
- Einkommensteuerliche Behandlung bei Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern
- Gewerbesteuerliche Behandlung
- Steuerfolgen der Spaltung auf Kapitalgesellschaften
- Einkommensteuerliche Behandlung bei Übertragung von Teilbetrieben und Mitunternehmeranteilen
- Einkommensteuerliche Behandlung bei Übertragung von Anteilen an Kapitalgesellschaften
- Einkommensteuerliche Behandlung bei Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern
- Gewerbesteuerliche Behandlung
- Steuerliche Folgen der Realteilung
- Einkommensteuerliche Behandlung der Realteilung
- Überführung ins Privatvermögen
- Übertragung in Einzelunternehmen oder Sonderbetriebsvermögen
- Übertragung auf Personengesellschaften
- Übertragung auf Kapitalgesellschaften
- Gewerbesteuerliche Behandlung der Realteilung
- Besonderheiten beim Spitzenausgleich
- Steuerliche Behandlung des Gesellschafteraustritts
- Einkommensteuerfolgen der Sachwertabfindung
- Übertragung ins Privatvermögen
- Übertragung in Einzelunternehmen oder Sonderbetriebsvermögen
- Übertragung in Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften
- Gewerbesteuerfolgen der Sachwertabfindung
- Steuerliche Auswirkungen der Vermögensübertragungen
- Darstellung der unternehmenspolitischen und steuerlichen Folgen in Ergebnismatrizen
- Bestimmung der steueroptimalen Alternative
- Praktische Anwendung des Entscheidungsmodell
- Grundsätzliche Anwendbarkeit des Modells
- Anwendung auf ausgewählte Beispielsfälle
- Beispiel 1
- Beispiel 2
- Beispiel 3
- Beispiel 4
- Zusammenfassende Würdigung
- Literaturverzeichnis
- Rechtsquellenverzeichnis
- Rechtsprechungsverzeichnis
- Verwaltungsvorschriftenverzeichnis
- Die Bedeutung der steuerlichen Optimierung bei der Vermögensteilung
- Die verschiedenen Teilungsvorgänge und ihre steuerlichen Folgen
- Die Entwicklung eines Entscheidungsmodells zur Ermittlung der steueroptimalen Alternative
- Die praktische Anwendung des Modells anhand von Beispielsfällen
- Die Zusammenfassende Würdigung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der steueroptimalen Teilung des Vermögens einer Personengesellschaft als betriebswirtschaftliches Entscheidungsproblem. Ziel ist es, ein Entscheidungsmodell zu entwickeln, das die relevanten unternehmenspolitischen und steuerlichen Faktoren berücksichtigt und die optimale Teilungsstrategie für die Personengesellschaft ermittelt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Untersuchungsgegenstand, die die Problemstellung, den Gang der Untersuchung, die Einordnung innerhalb der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre und die Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes beleuchtet. Anschließend werden die Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre erläutert, wobei die Entscheidungstheoretischen Ansätze, der betriebliche Entscheidungsvorgang und das Grundmodell der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre im Detail behandelt werden.
Im dritten Kapitel wird ein steueroptimales Entscheidungsmodell für die Teilung des Vermögens einer Personengesellschaft entwickelt. Hierbei werden die zusätzlichen Prämissen des Modellansatzes, die Personengesellschaft als Entscheidungsträger, das Zielsystem der Personengesellschaft und das Entscheidungsfeld der Personengesellschaft analysiert. Die verschiedenen Teilungsvorgänge, wie Spaltung, Realteilung, Gesellschafteraustritt und sonstige Vermögensübertragungen, werden im Detail betrachtet und ihre unternehmenspolitischen und steuerlichen Folgen dargestellt.
Im vierten Kapitel wird die praktische Anwendung des entwickelten Entscheidungsmodells anhand von ausgewählten Beispielsfällen demonstriert. Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Würdigung der Ergebnisse und einer Diskussion der Limitationen des Modells.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die steueroptimale Teilung des Vermögens, Personengesellschaften, Entscheidungsmodelle, Spaltung, Realteilung, Gesellschafteraustritt, Steuerliche Folgen, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Unternehmenspolitik, Betriebswirtschaftliche Steuerlehre.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer steueroptimalen Vermögensteilung?
Ziel ist es, das Vermögen einer Personengesellschaft so aufzuteilen, dass die steuerliche Belastung minimiert wird, um die Liquidität der Beteiligten zu schonen.
Welche Formen der Teilung werden unterschieden?
Die Arbeit analysiert die Spaltung (nach Umwandlungsrecht), die Realteilung unter Auflösung der Gesellschaft sowie den Gesellschafteraustritt gegen Sachwertabfindung.
Was ist eine Realteilung?
Bei einer Realteilung wird das Gesellschaftsvermögen unter den Gesellschaftern aufgeteilt, wobei die Wirtschaftsgüter meist in andere Betriebsvermögen überführt werden, um eine sofortige Versteuerung stiller Reserven zu vermeiden.
Welche Steuern sind bei der Teilung relevant?
Im Fokus stehen die einkommensteuerlichen Folgen für die Gesellschafter sowie die gewerbesteuerlichen Auswirkungen auf Ebene der Gesellschaft.
Wie hilft das entwickelte Entscheidungsmodell in der Praxis?
Das Modell verknüpft steuerliche Ergebnisfunktionen mit unternehmenspolitischen Zielen und ermöglicht durch Ergebnismatrizen einen systematischen Vergleich der Handlungsalternativen.
- Quote paper
- Holger Mach (Author), 2002, Die steueroptimale Teilung des Vermögens einer Personengesellschaft als betriebswirtschaftliches Entscheidungsproblem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185758