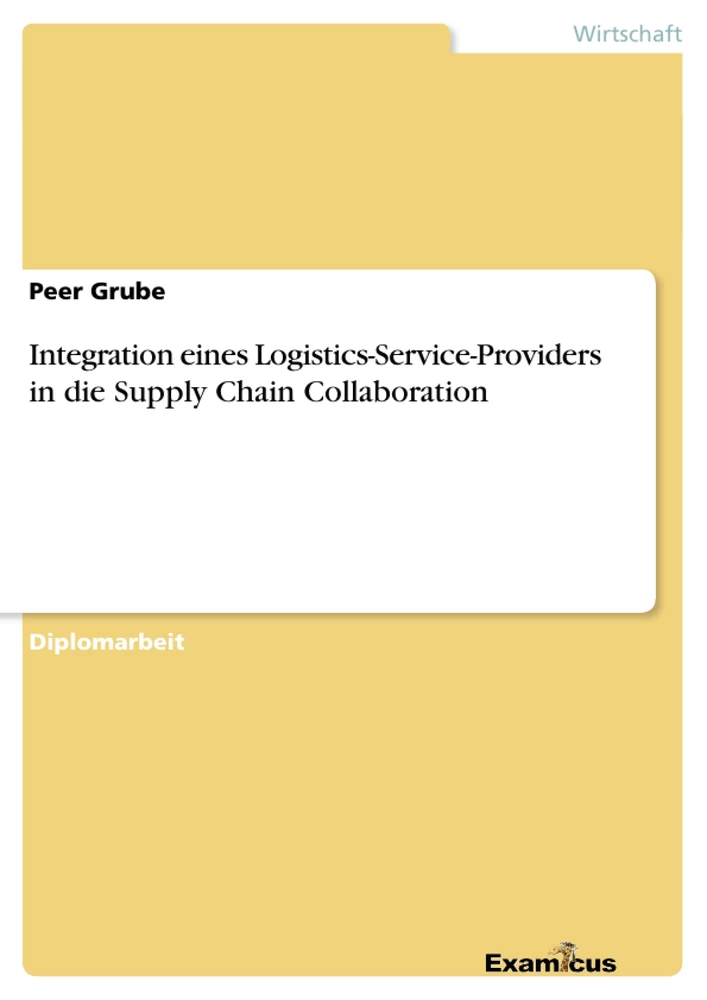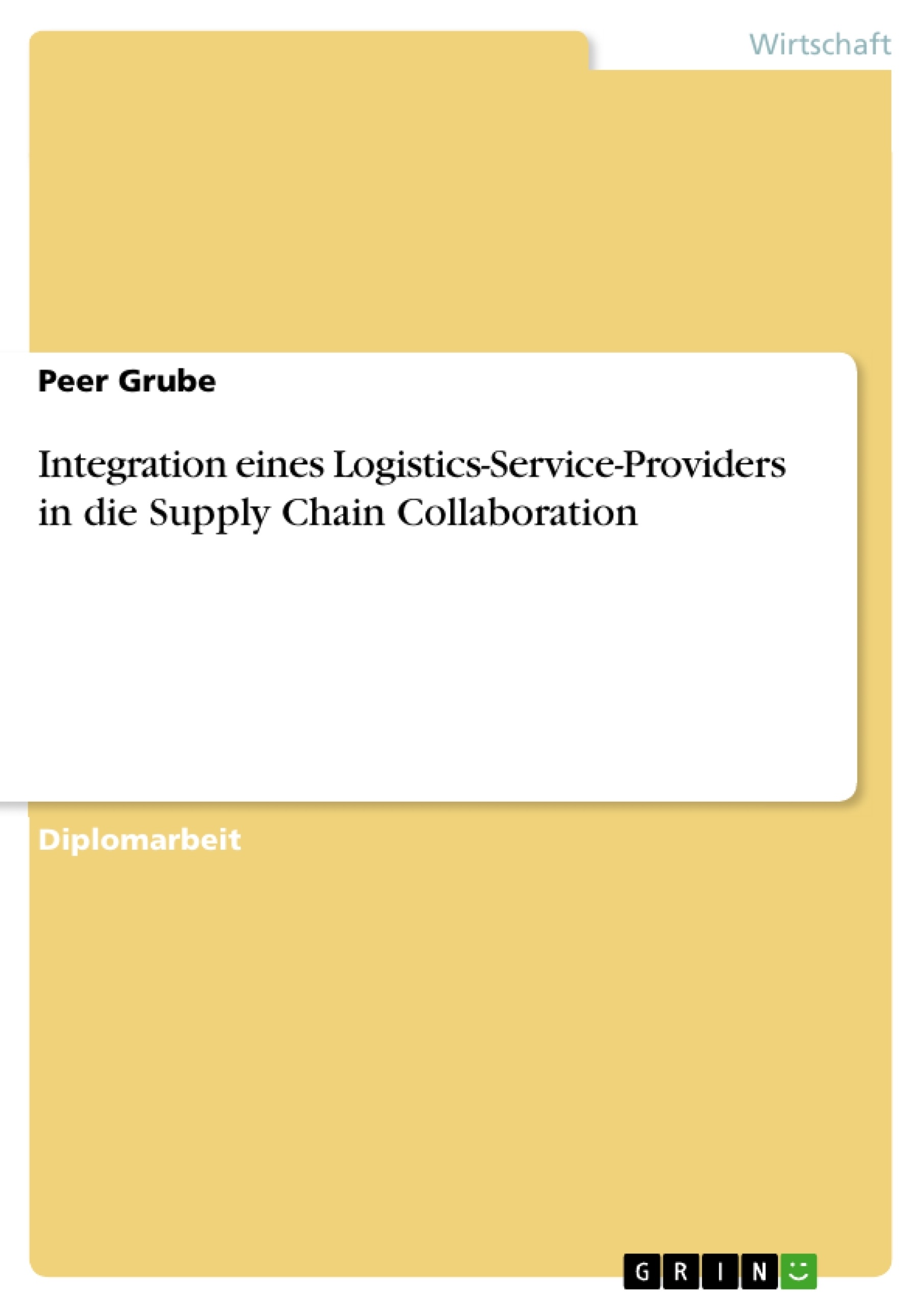Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Logistics-Service-Providern und deren Integration in Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette. Es wird ein Überblick gegeben, welche Arten von Kollaborationen es gibt, wie diese Kollaboration durch ...
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Aufbau der Arbeit
- 1.2 Grundlagen
- 1.2.1 Logistik
- 1.2.2 Supply Chain Management (SCM)
- 1.2.3 Collaborative Supply Chain Management (CSCM)
- 2.1 Vertikale Kooperationen
- 2.2 Horizontale Kooperationen
- 2.3 Diagonale Kooperationen
- 2.4 Kooperationsformen
- 2.4.1 Unternehmensnetzwerke
- 2.4.2 Kartelle
- 2.4.3 Konsortien
- 2.4.4 Fusionen
- 2.4.5 Joint Ventures (JV)
- 2.4.6 Virtuelle Unternehmen (VU)
- 2.5 Ziele der Kollaborationspartner
- 2.6 Vorteile und Nachteile für die Kollaborationspartner
- 3.1 Forecast Collaboration
- 3.2 Capacity Collaboration
- 3.3 Inventory Collaboration
- 3.4 Order Collaboration
- 3.5 Transportation Collaboration
- 3.6 Multi-Tier Collaboration
- 4.1 Aufgaben der Logistics-Service-Provider
- 4.1.1 Operative Aufgaben
- 4.1.2 Administrative Aufgaben
- 4.2 Klassifizierung der Logistics-Service-Provider
- 4.3 Third-Party-Logistics-Provider (3PL)
- 4.3.1 Service Provider
- 4.3.2 Solution Provider
- 4.4 Leistungen des 3PL
- 4.4.1 Financial Services
- 4.4.2 Information Technology
- 4.4.3 Forwarding and Customs Activities
- 4.4.4 Warehousing & Inventory Management
- 4.4.5 Transport Planning & Management
- 4.4.6 Consulting Services & Product related Services
- 4.5 Fourth-Party-Logistics-Provider (4PL)
- 4.5.1 Externe Weiterentwicklungsstrategie
- 4.5.2 Interne Weiterentwicklungsstrategie
- 4.5.3 Strategie der neuartigen Marktteilnehmer
- 4.6 Leistungen des 4PL
- 4.6.1 Logistik-Systemgestaltung (Design)
- 4.6.2 Prozessplanung und Collaboration
- 4.6.3 Monitoring
- 4.6.4 Fulfillment
- 4.6.5 Zusatzdienste
- 4.7 Beispiele für 4PL Unternehmen
- 4.7.1 Setlog GmbH
- 4.7.2 Volkswagen Transport GmbH & Co. OHG
- 4.7.3 eChain Logistics AG
- 4.8 Vorteile der Integration für die Unternehmen
- 5.1 Electronic Data Interchange (EDI)
- 5.2 Extensible Markup Language (XML)
- 5.3 XML/EDI
- 5.4 WebEDI
- 5.5 Web Collaboration
- 5.6 Business-to-Business Collaboration
- 5.7 Enterprise Application Integration (EAI)
- 6.1 Business-to-Business (B2B)
- 6.2 Business-to-Customer (B2C)
- 6.3 Elektronische Marktplätze (EMP)
- 6.4 Arten elektronischer Märkte
- 6.4.1 Einkaufsorientierte Marktplätze
- 6.4.2 Neutrale Marktplätze
- 6.4.3 Verkaufsorientierte Marktplätze
- 6.4.4 Horizontale Marktplätze
- 6.4.5 Vertikale Marktplätze
- 6.4.6 Schwarzes Brett
- 6.4.7 Katalogbasierte Marktplätze
- 6.4.8 Auktionsbasierte Marktplätze
- 6.5 Beispiele für Logistikportale
- 6.5.1 Bundesvereinigung Logistik e.V.
- 6.5.2 eLog-Center
- 6.5.3 Logistikinitiative Niedersachsen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Integration von Logistics-Service-Providern (LSPs), insbesondere 3PL und 4PL, in die Supply Chain Collaboration (SCC). Ziel ist es, die verschiedenen Arten von Kooperationen, die Rolle elektronischer Standards und die Aufgaben der LSPs bei der Umsetzung dieser Kooperationen zu beleuchten.
- Arten von Kooperationen (vertikal, horizontal, diagonal)
- Rolle von Logistics-Service-Providern (3PL und 4PL)
- Bedeutung elektronischer Standards (EDI, XML)
- Einsatz elektronischer Märkte (B2B, B2C)
- Optimierung von Supply Chains durch Kollaboration
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die dynamische und unvorhersehbare wirtschaftliche Situation, die Unternehmen zu schnellen Reaktionen und internationaler Zusammenarbeit zwingt. Sie betont die zunehmende Bedeutung von Flexibilität, Innovation und kurzen time-to-market sowie time-to-customer Zeiten. Die Auslagerung von Logistikleistungen an LSPs, insbesondere 4PL, wird als wichtiger Trend zur Effizienzsteigerung hervorgehoben.
2 Begriff und Merkmale von Kooperationen: Dieses Kapitel definiert Kooperationen als freiwillige zwischenbetriebliche Zusammenarbeit, die auf der komplementären Ergänzung von Kompetenzen beruht. Es differenziert zwischen vertikalen, horizontalen und diagonalen Kooperationen und beschreibt verschiedene Kooperationsformen wie Unternehmensnetzwerke, Kartelle, Konsortien, Fusionen, Joint Ventures und virtuelle Unternehmen. Die Ziele und Vor- und Nachteile der Kollaboration werden ebenfalls diskutiert.
3 Arten der Kollaborationen: Dieses Kapitel detailliert verschiedene Arten kollaborativer Prozesse in der Supply Chain, einschließlich Forecast Collaboration, Capacity Collaboration, Inventory Collaboration, Order Collaboration, Transportation Collaboration und Multi-Tier Collaboration. Für jede Art werden die Ziele, der Ablauf und der Nutzen erläutert. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Planung und Ausführung, um den Bullwhip-Effekt zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.
4 Logistics-Service-Provider (LSP): Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung und Klassifizierung von LSPs. Es beschreibt die Aufgaben von LSPs, unterscheidet zwischen 3PL (Service Provider und Solution Provider) und 4PL, und listet deren typische Leistungen auf. Beispiele für 4PL Unternehmen werden vorgestellt, um die verschiedenen Strategien ihrer Entwicklung und Integration in Supply Chains aufzuzeigen.
5 Elektronische Standards als Kollaborationsbasis: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung elektronischer Standards für die erfolgreiche Umsetzung von Kooperationen. EDI, XML, XML/EDI, WebEDI, Web Collaboration und Enterprise Application Integration (EAI) werden als wichtige Werkzeuge zur Integration und Automatisierung von Prozessen vorgestellt. Die Funktionsweise und Vor- und Nachteile jedes Standards werden erläutert.
6 Elektronische Märkte und Transaktionspartner: Dieses Kapitel beschreibt die Rolle des Internets und elektronischer Marktplätze (EMPs) in der Supply Chain Collaboration. Es unterscheidet zwischen B2B und B2C Transaktionen und beschreibt verschiedene Arten von EMPs (einkaufsorientiert, neutral, verkaufsorientiert, horizontal, vertikal, Schwarzes Brett, katalogbasiert, auktionsbasiert). Beispiele für Logistikportale werden genannt.
Schlüsselwörter
Logistics-Service-Provider (LSP), 3PL, 4PL, Supply Chain Collaboration (SCC), Collaborative Supply Chain Management (CSCM), Electronic Data Interchange (EDI), Extensible Markup Language (XML), Elektronische Marktplätze (EMP), B2B, Outsourcing, Kooperationen, Wertschöpfungskette, Logistik, Prozessoptimierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Integration von Logistics-Service-Providern in die Supply Chain Collaboration
Was ist der allgemeine Inhalt dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Integration von Logistics-Service-Providern (LSPs), insbesondere 3PL und 4PL, in die Supply Chain Collaboration (SCC). Sie untersucht verschiedene Arten von Kooperationen, die Rolle elektronischer Standards und die Aufgaben der LSPs bei der Umsetzung dieser Kooperationen zur Optimierung von Supply Chains.
Welche Arten von Kooperationen werden behandelt?
Die Arbeit differenziert zwischen vertikalen, horizontalen und diagonalen Kooperationen und beschreibt verschiedene Kooperationsformen wie Unternehmensnetzwerke, Kartelle, Konsortien, Fusionen, Joint Ventures und virtuelle Unternehmen. Zusätzlich werden spezifische Arten der Kollaboration in der Supply Chain detailliert, darunter Forecast, Capacity, Inventory, Order und Transportation Collaboration sowie Multi-Tier Collaboration.
Welche Rolle spielen Logistics-Service-Provider (LSPs)?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung und Klassifizierung von LSPs, unterscheidet zwischen 3PL (Service Provider und Solution Provider) und 4PL und listet deren typische Leistungen auf. Es werden Beispiele für 4PL-Unternehmen vorgestellt und die Strategien ihrer Entwicklung und Integration in Supply Chains analysiert. Die Aufgaben von LSPs werden in operative und administrative Aufgaben unterteilt.
Welche elektronischen Standards sind relevant für die Supply Chain Collaboration?
Die Bedeutung elektronischer Standards für die erfolgreiche Umsetzung von Kooperationen wird erörtert. EDI, XML, XML/EDI, WebEDI, Web Collaboration und Enterprise Application Integration (EAI) werden als wichtige Werkzeuge zur Integration und Automatisierung von Prozessen vorgestellt. Die Funktionsweise und Vor- und Nachteile jedes Standards werden erläutert.
Welche Rolle spielen elektronische Märkte?
Die Arbeit beschreibt die Rolle des Internets und elektronischer Marktplätze (EMPs) in der Supply Chain Collaboration. Es wird zwischen B2B und B2C Transaktionen unterschieden und verschiedene Arten von EMPs (einkaufsorientiert, neutral, verkaufsorientiert, horizontal, vertikal, Schwarzes Brett, katalogbasiert, auktionsbasiert) werden beschrieben. Beispiele für Logistikportale werden genannt.
Welche Ziele verfolgt die Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Arten von Kooperationen, die Rolle der LSPs (insbesondere 3PL und 4PL), die Bedeutung elektronischer Standards (EDI, XML) und den Einsatz elektronischer Märkte (B2B, B2C) zur Optimierung von Supply Chains durch Kollaboration zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Logistics-Service-Provider (LSP), 3PL, 4PL, Supply Chain Collaboration (SCC), Collaborative Supply Chain Management (CSCM), Electronic Data Interchange (EDI), Extensible Markup Language (XML), Elektronische Marktplätze (EMP), B2B, Outsourcing, Kooperationen, Wertschöpfungskette, Logistik, Prozessoptimierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriff und Merkmale von Kooperationen, Arten der Kollaborationen, Logistics-Service-Provider (LSP), Elektronische Standards als Kollaborationsbasis und Elektronische Märkte und Transaktionspartner. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung im Text.
- Arbeit zitieren
- Peer Grube (Autor:in), 2005, Integration eines Logistics-Service-Providers in die Supply Chain Collaboration, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185997