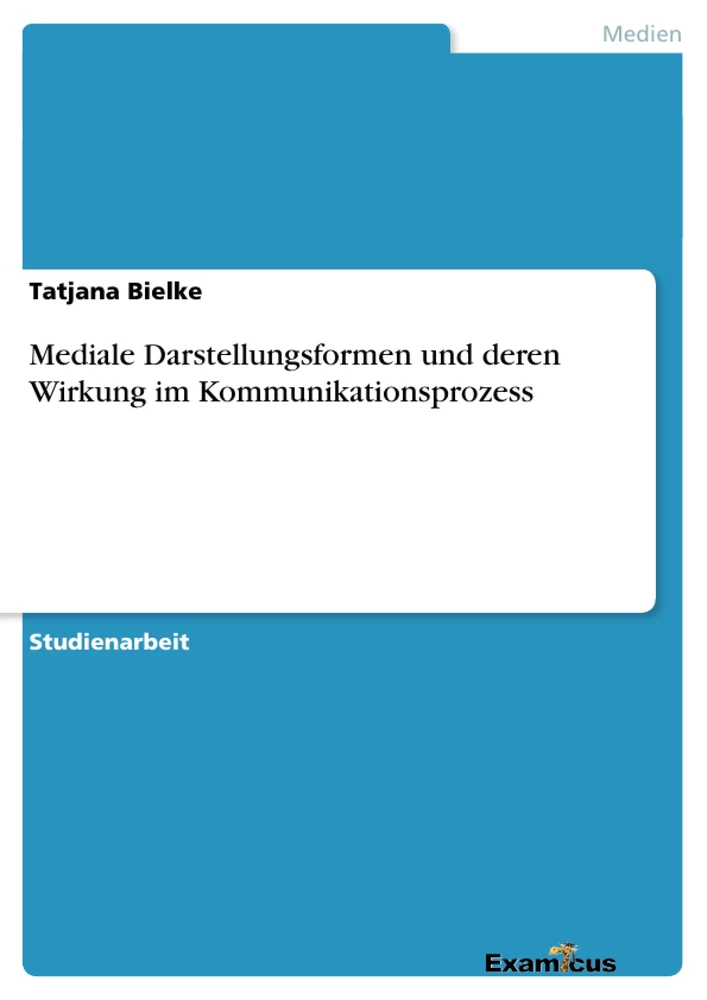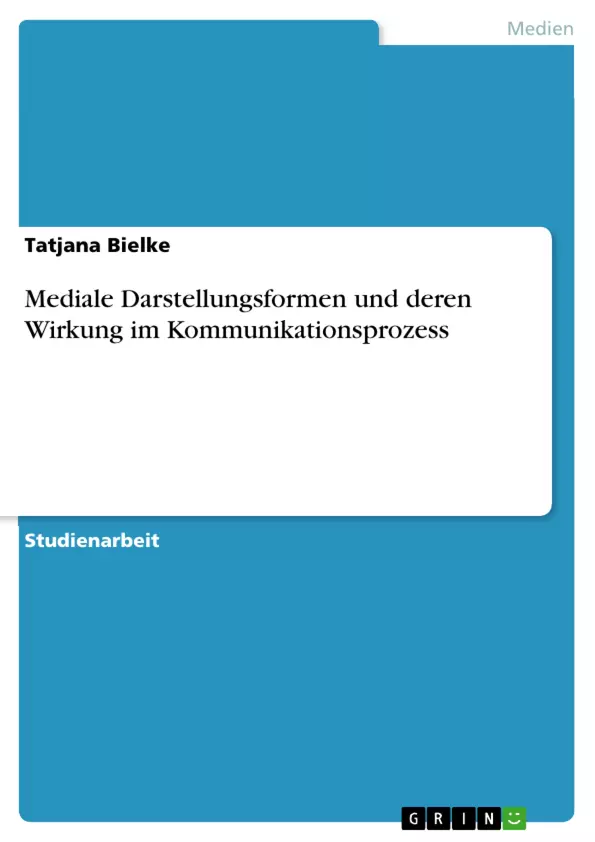In der vorliegenden Hausarbeit "Mediale Darstellungsformen und deren Wirkung im Kommunikationsprozess" beschäftige ich mich überwiegend mit technischen Medien und deren Einsatz bei der Vermittlung von Wissen.
Im ersten Kapitel stelle ich unterschiedliche Definitionen von Begriffen dar, die Ausgangspunkt für weitere Betrachtungen sind. Alle genannten Autoren scheinen sich einig zu sein, dass Medien Kommunikationsmittel sind, die unter Verwendung spezifischer Kodes Nachrichten übermitteln. Diskutiert wird über die erweiternde oder beschränkende Wirkung von Medien und über die Klassifizierung der einzelnen Kodes. Bei der Abgrenzung der Begriffe "Kommunikation" und "Interaktion" geht es hauptsächlich um die Rückbezüge innerhalb eines Kommunikationsprozesses und deren Relevanz für das weitere Geschehen.
Multimedialität ist eng verknüpft mit Multikodalität und Multimodalität, wobei die Meinungen auseinandergehen, ob Mulitmedialität die beiden anderen Begriffe subsummiert oder alle drei getrennt voneinander zu betrachten sind.
Um die kognitive Verarbeitung der medialen Angebote geht es im zweiten Kapitel. Ich stelle drei mentale Modelle vor, die sich in der Beschreibung der verschiedenen Verarbeitungsstufen unterscheiden. Während das Modell der doppelten Enkodierung von einer modalitätsspezifischen Verarbeitung ausgeht, vertreten Snodgrass, Ballstaed u.a.die Auffassung, dass es auf den Verarbeitungsebenen Verknüpfungen und Verbindungen einzelner Konzepte gibt, die modalitätsübergreifend sind.
Wie sich die strukturelle Verarbeitung auf den Wissenserwerb medial dargebotenen Lernstoffes auswirkt, versuche ich im dritten Kapitel näher zu beleuchten. Darin geht es auch um den wechselseitigen Einfluss der Inhalts-, Präsentations- und Verarbeitungsstruktur. Die Veränderung von Wissen als Wirkung medialer Vermittlung ist auch aus diagnostischer Sicht nicht unproblematisch. Tergan schlägt ein dynamisches Diagnoseverfahren vor, um die Zeitpunkte zu ermitteln, zu denen bereits vorhandenes und in bestimmten Konzepten repräsentiertes Wissen für den Wissenserwerb aktiviert wird.
Den Abschluss bilden einige Gedanken zum Einsatz von multimedialen Angeboten in Lernund Lehrzusammenhängen. Die Frage nach dem sinnvollen Einsatz von Medien in der Informationsvermittlung wird aber auch in den vorangehenden Kapiteln berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffsklärungen
- 1.1 Zum Begriff Medium
- 1.2 Zum Begriff des Kodes
- 1.3 Die Begriffe Kommunikation und Interaktion
- 1.4 Zum Begriff Multimedia
- 2. Kognitive Verarbeitung
- 2.1 Mentale Modelle
- 3. Wissenserwerb durch mediale Darstellungsformen
- 4. Wirkung einzelner Medien
- 5. Zum Einsatz von multimedialen Angeboten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss medialer Darstellungsformen auf den Kommunikationsprozess, insbesondere im Kontext der Wissensvermittlung durch technische Medien. Die Arbeit analysiert verschiedene Definitionen zentraler Begriffe wie Medium und Kode und beleuchtet die Unterschiede zwischen Kommunikation und Interaktion. Ein Schwerpunkt liegt auf der kognitiven Verarbeitung medialer Inhalte und deren Auswirkungen auf den Wissenserwerb.
- Begriffsbestimmungen von Medium, Kode, Kommunikation und Interaktion
- Kognitive Verarbeitungsprozesse und mentale Modelle
- Wissenserwerb durch verschiedene mediale Darstellungsformen
- Wirkung einzelner Medien (Bilder, Animationen, audio-visuelle Medien)
- Einsatz von multimedialen Angeboten im Lernkontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt den Fokus auf technische Medien und deren Rolle bei der Wissensvermittlung. Sie gibt einen kurzen Überblick über die behandelten Kapitel und die darin enthaltenen Argumentationslinien.
1. Begriffsklärungen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Definitionen von "Medium" und "Kode", wobei die Autoren Höflich, Posner und Böhme-Dürr im Detail betrachtet werden. Es werden unterschiedliche Perspektiven auf die beschränkende oder erweiternde Wirkung von Medien diskutiert, sowie die Klassifizierung von Kodes (verbal und nonverbal) und deren Einfluss auf die Kommunikation. Der Begriff der Multimedialität wird im Kontext von Multikodalität und Multimodalität erörtert.
2. Kognitive Verarbeitung: Kapitel 2 konzentriert sich auf die kognitive Verarbeitung medialer Angebote. Es werden drei mentale Modelle – die Theorie der doppelten Enkodierung, die Theorie der amodalen Verarbeitung und das Modell von Joan Snodgrass – vorgestellt und verglichen. Diese Modelle beschreiben verschiedene Stufen der Informationsverarbeitung und den Einfluss von Modalität und Kodalität auf den Wissenserwerb. Der "Bild-Überlegenheits-Effekt" wird ebenfalls erläutert.
3. Wissenserwerb durch mediale Darstellungsformen: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der strukturellen Verarbeitung auf den Wissenserwerb. Es werden die wechselseitigen Einflüsse von Inhalts-, Präsentations- und Verarbeitungsstruktur beleuchtet. Die Arbeit diskutiert die Bedeutung der Abstimmung von Darstellungs- und Inhaltsstruktur sowie die Rolle sozialer Faktoren und der individuellen Wissensbasis des Rezipienten. Tergans dynamisches Diagnoseverfahren zur Erfassung der Wissensveränderung wird vorgestellt.
4. Wirkung einzelner Medien: Kapitel 4 analysiert die Wirkung einzelner Medien auf den Lernprozess, wobei die Ergebnisse verschiedener Studien zu Bildern, Animationen und audio-visuellen Medien präsentiert werden. Der Einfluss von Faktoren wie Redundanz, Komplexität und der Reihenfolge der Medienpräsentation wird diskutiert. Die Bedeutung des Lernziels und die subjektive Wahrnehmung des Mediums durch den Rezipienten werden hervorgehoben.
5. Zum Einsatz von multimedialen Angeboten: Das abschließende Kapitel befasst sich mit dem sinnvollen Einsatz multimedialer Angebote im Lernkontext. Die drei Strukturprinzipien von Clark (Authentizität, multiple Kontexte, sozialer Kontext) werden erläutert, und es wird die Bedeutung der Medienkompetenz des Nutzers hervorgehoben. Die Herausforderungen und Chancen von Hypermedia im Lernprozess werden diskutiert, und es wird ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.
Schlüsselwörter
Mediale Darstellungsformen, Kommunikationsprozess, Wissensvermittlung, technische Medien, Kodes, Multimodalität, Multikodalität, Multimedialität, Kognitive Verarbeitung, Mentale Modelle, Wissenserwerb, Medienwirkung, Lernprozess, Hypermedia, Medienkompetenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Mediale Darstellungsformen und Wissensvermittlung
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss medialer Darstellungsformen auf den Kommunikationsprozess und insbesondere auf die Wissensvermittlung durch technische Medien. Sie analysiert zentrale Begriffe wie Medium, Kode, Kommunikation und Interaktion und beleuchtet die kognitive Verarbeitung medialer Inhalte und deren Auswirkungen auf den Wissenserwerb.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Begriffsbestimmungen von Medium, Kode, Kommunikation und Interaktion; kognitive Verarbeitungsprozesse und mentale Modelle; Wissenserwerb durch verschiedene mediale Darstellungsformen; Wirkung einzelner Medien (Bilder, Animationen, audio-visuelle Medien); und den Einsatz von multimedialen Angeboten im Lernkontext.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffsklärungen, Kognitive Verarbeitung, Wissenserwerb durch mediale Darstellungsformen, Wirkung einzelner Medien und Zum Einsatz von multimedialen Angeboten. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt und in der Zusammenfassung der Kapitel näher beschrieben.
Wie werden die Begriffe "Medium", "Kode", "Kommunikation" und "Interaktion" definiert?
Das Kapitel "Begriffsklärungen" analysiert verschiedene Definitionen dieser Begriffe, unter anderem unter Bezugnahme auf die Autoren Höflich, Posner und Böhme-Dürr. Es werden unterschiedliche Perspektiven auf die Wirkung von Medien und die Klassifizierung von Kodes (verbal und nonverbal) diskutiert. Der Begriff der Multimedialität wird im Kontext von Multikodalität und Multimodalität erörtert.
Wie wird die kognitive Verarbeitung medialer Inhalte behandelt?
Kapitel 2 konzentriert sich auf die kognitive Verarbeitung. Es werden verschiedene mentale Modelle (Theorie der doppelten Enkodierung, Theorie der amodalen Verarbeitung, Modell von Joan Snodgrass) vorgestellt und verglichen. Diese Modelle beschreiben die Informationsverarbeitung und den Einfluss von Modalität und Kodalität auf den Wissenserwerb. Der "Bild-Überlegenheits-Effekt" wird ebenfalls erläutert.
Wie wird der Wissenserwerb durch mediale Darstellungsformen untersucht?
Kapitel 3 untersucht den Einfluss der strukturellen Verarbeitung auf den Wissenserwerb. Es beleuchtet die wechselseitigen Einflüsse von Inhalts-, Präsentations- und Verarbeitungsstruktur und diskutiert die Bedeutung der Abstimmung von Darstellungs- und Inhaltsstruktur sowie die Rolle sozialer Faktoren und der individuellen Wissensbasis des Rezipienten. Tergans dynamisches Diagnoseverfahren wird vorgestellt.
Welche Erkenntnisse liefert die Hausarbeit zur Wirkung einzelner Medien?
Kapitel 4 analysiert die Wirkung von Bildern, Animationen und audio-visuellen Medien auf den Lernprozess. Der Einfluss von Redundanz, Komplexität und der Reihenfolge der Medienpräsentation wird diskutiert. Die Bedeutung des Lernziels und die subjektive Wahrnehmung des Mediums durch den Rezipienten werden hervorgehoben.
Wie wird der Einsatz von multimedialen Angeboten im Lernkontext bewertet?
Das letzte Kapitel befasst sich mit dem sinnvollen Einsatz multimedialer Angebote im Lernkontext. Die Strukturprinzipien von Clark (Authentizität, multiple Kontexte, sozialer Kontext) werden erläutert, und die Bedeutung der Medienkompetenz des Nutzers wird hervorgehoben. Herausforderungen und Chancen von Hypermedia im Lernprozess werden diskutiert, und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Mediale Darstellungsformen, Kommunikationsprozess, Wissensvermittlung, technische Medien, Kodes, Multimodalität, Multikodalität, Multimedialität, Kognitive Verarbeitung, Mentale Modelle, Wissenserwerb, Medienwirkung, Lernprozess, Hypermedia, Medienkompetenz.
- Arbeit zitieren
- Tatjana Bielke (Autor:in), 1999, Mediale Darstellungsformen und deren Wirkung im Kommunikationsprozess, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186000