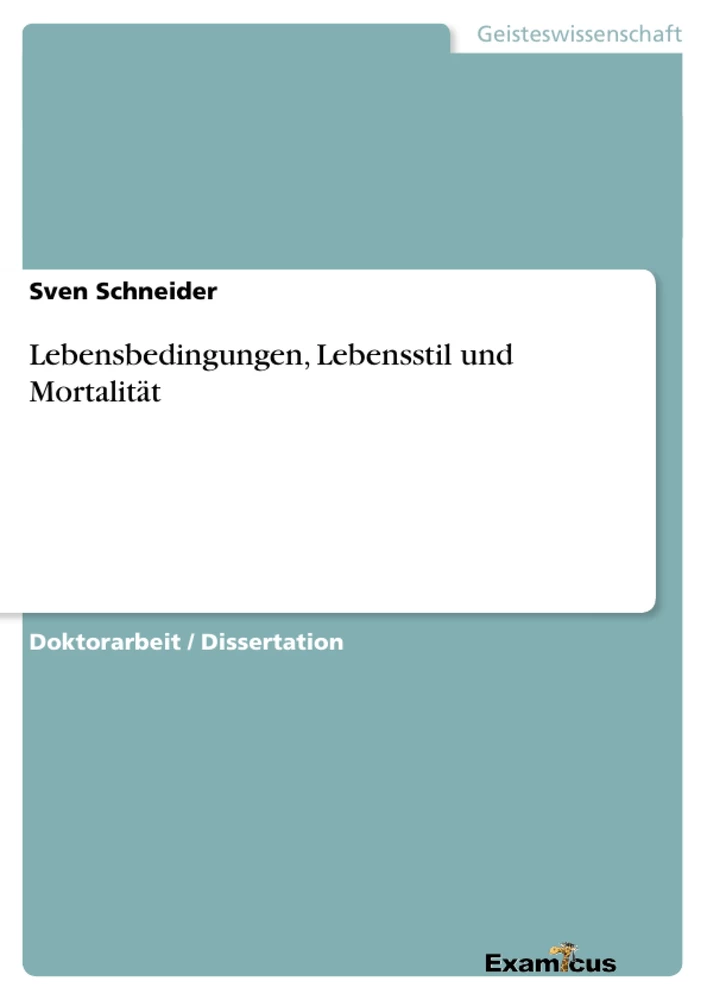Der Schichtgradient der Mortalität bezeichnet das international wohlbekannte Phänomen eines höheren Mortalitätsrisikos unterer sozialer Schichten. Die vorliegende Arbeit diskutiert zum einen unterschiedliche Erklärungsansätze und deren methodische Implikationen. Zum anderen wird mittels aktueller Mortalitätsdaten überprüft werden, ob sich für die unterschiedlichen theoretischen Erklärungsansätze ? auch unter multivariater Modellierung - eine empirische Bestätigung finden lässt. Als Datenbasis dient das bundesdeutsche "MONICA-Projekt Augsburg" mit zwei 1984/85 und 1989/90 im Raum Augsburg durchgeführten Querschnitterhebungen sowie einem Mortalitäts-follow-up aus den Jahren 1997/98. Der Datensatz umfasst insgesamt 7.268 Personen im Alter von 25 bis 74 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die empirischen Analysen stützen die Vermutung, dass der Schichtgradient der Mortalität mehr auf monetärer Deprivation und einem ungesünderen Lebensstil als auf belastende Arbeitsbedingungen zu basieren scheint.
- Quote paper
- Dr. Sven Schneider (Author), 2001, Lebensbedingungen, Lebensstil und Mortalität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186049