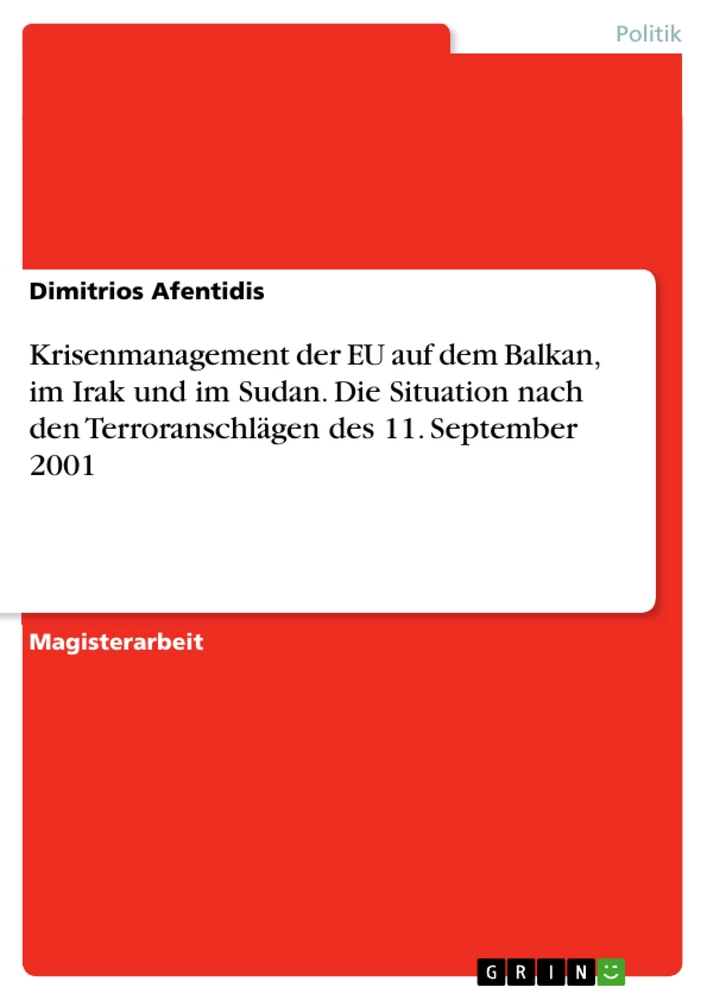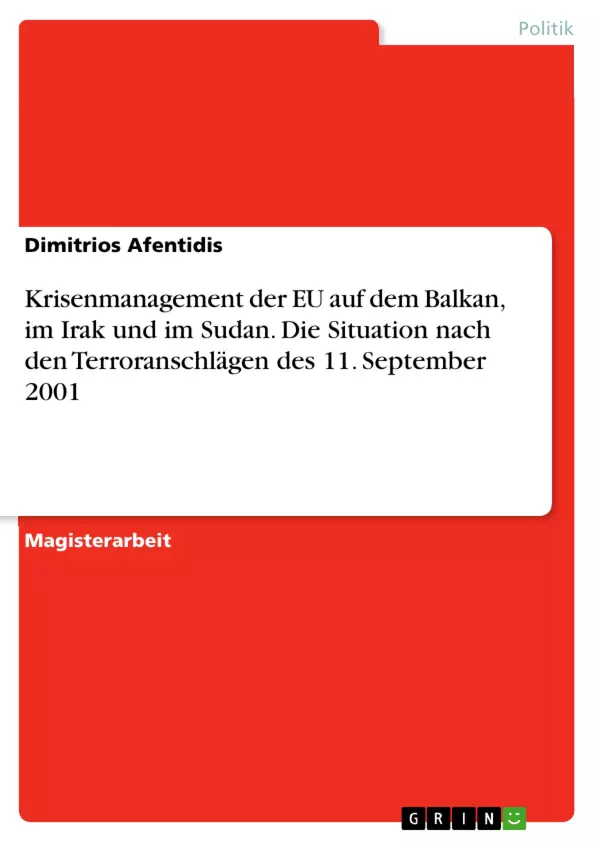Das Verfassen einer Arbeit über das Krisenmanagement der Europäischen Union scheint angesichts der derzeitigen Weltkrisen, die zusätzlich beeinflusst wurden durch die Geschehnisse am 11. September 2001, eine recht interessante Aufgabe.
Von der Aktualität der Ereignisse abgesehen, stellt sich die Frage ziviler und friedlicher Krisenbewältigung ohnehin ständig, da ,,unser" Europa in ,,unserem" Zeitalter von sich behauptet, nach Jahrhunderten der Kriege endlich die nötige Reife zur dauerhaften Einhaltung und Sicherung des Friedens gewonnen zu haben.
Genau diese Erfüllung nach Frieden scheint nach den Terroranschlägen vom 11.09.2001 in den USA auch in weite Ferne gerückt zu sein. Denn der 11. September hat eine neue Form kriegerischer Asymmetrie hervorgerufen, indem der klassische Staatenkrieg zu einem historischen Auslaufmodell geworden zu sein scheint. Um dieser Veränderung entgegentreten zu können, ist es auch für die Europäer notwendig geworden, eine neue Form des Krisenmanagements hervorzubringen. Nicht nur um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus entgegenzuwirken, sondern auch Krisen, die sich vor der eigenen Türe abspielen, entgegenkommen zu können.
Aufgrund dessen hat die EU in den letzten Jahren ein umfassendes Konglomerat von neuen Krisenmanagementinstrumenten entwickelt, die ein angemessenes und kompetentes System für Entscheidungen in Krisengebieten hervorbringen sollen.Doch wie wirkt das Europäische Krisenmanagement tatsächlich in der politischen Praxis? Reichen die neu entwickelten Instrumentarien der Europäischen Union aus, um Krisen zu lindern bzw. wirklich beseitigen zu können?
Die Arbeit versucht diesen Fragen auf die Spur zu gehen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Terminologische Analyse
- 2.1 Konflikt
- 2.2 Krise
- 2.3 Krieg
- 2.4 Frieden
- 2.5 Krisenprävention und Krisenmanagement
- 3 Das Krisenmanagement in den Verträgen und Beschlüssen der Europäischen Union
- Entwicklung eines Systems Europäischen Krisenmanagements
- 3.1 EPZ und Krisenmanagement
- 3.2 Maastrichter Vertrag und Krisenmanagement
- 3.3 Petersberger Erklärung und Krisenmanagement
- 3.4 Amsterdamer Vertrag und Krisenmanagement
- 3.5 Weiterentwicklungen der GASP durch Beschlüsse des Europäischen Rates
- 3.6 Vertrag von Nizza und Krisenmanagement
- 4 Wichtige Krisenorgane der EU
- 4.1 Hoher Vertreter der GASP
- 4.2 Außenminister der Union
- 4.3 Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee (PSK)
- 4.4 Das EU-Militärkomitee (EUMC)
- 4.5 Der EU-Militärstab (EUMS)
- 4.6 Europäisches Amt für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten
- 4.7 Ausschuss für zivile Aspekte des Krisenmanagements (CIVCOM)
- 5 Beteiligungskriterien der EU an internationalen Interventionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Krisenmanagement der Europäischen Union im Kontext der Terroranschläge vom 11. September 2001 und analysiert die Entwicklung und Umsetzung des EU-Krisenmanagements in den Konfliktzonen Balkan, Irak und Sudan. Die Arbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen, die institutionellen Strukturen und die praktischen Herausforderungen des EU-Krisenmanagements in diesen Regionen.
- Entwicklung des EU-Krisenmanagements nach 9/11
- Rechtliche Grundlagen und institutionelle Strukturen des EU-Krisenmanagements
- Praktische Herausforderungen des EU-Krisenmanagements in Konfliktzonen
- Analyse des EU-Krisenmanagements im Balkan, Irak und Sudan
- Bewertung der Wirksamkeit des EU-Krisenmanagements
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz des EU-Krisenmanagements im Kontext der Terroranschläge vom 11. September 2001. Sie definiert die zentralen Begriffe wie Konflikt, Krise, Krieg, Frieden und Krisenmanagement und stellt die Forschungsfrage der Arbeit dar.
Kapitel 2 analysiert die terminologische Grundlage des EU-Krisenmanagements. Es werden die Begriffe Konflikt, Krise, Krieg, Frieden und Krisenmanagement definiert und ihre Bedeutung im Kontext der Arbeit erläutert. Die Analyse beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf diese Begriffe und ihre Relevanz für das Verständnis des EU-Krisenmanagements.
Kapitel 3 untersucht die Entwicklung des EU-Krisenmanagements in den Verträgen und Beschlüssen der Europäischen Union. Es analysiert die Entwicklung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ), des Maastrichter Vertrags, der Petersberger Erklärung, des Amsterdamer Vertrags und der Weiterentwicklungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) durch Beschlüsse des Europäischen Rates. Das Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und institutionellen Strukturen des EU-Krisenmanagements und analysiert die Entwicklung der Kompetenzen der EU in diesem Bereich.
Kapitel 4 stellt die wichtigsten Krisenorgane der EU vor. Es beschreibt die Rolle des Hohen Vertreters der GASP, der Außenminister der Union, des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees (PSK), des EU-Militärkomitees (EUMC), des EU-Militärstabs (EUMS), des Europäischen Amts für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten und des Ausschusses für zivile Aspekte des Krisenmanagements (CIVCOM). Das Kapitel analysiert die Aufgaben und Kompetenzen dieser Organe im Kontext des EU-Krisenmanagements.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Krisenmanagement der Europäischen Union, die Terroranschläge vom 11. September 2001, die Konfliktzonen Balkan, Irak und Sudan, die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die rechtlichen Grundlagen des EU-Krisenmanagements, die institutionellen Strukturen des EU-Krisenmanagements, die praktischen Herausforderungen des EU-Krisenmanagements, die Beteiligungskriterien der EU an internationalen Interventionen und die Bewertung der Wirksamkeit des EU-Krisenmanagements.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte der 11. September das Krisenmanagement der EU?
Der 11.09.2001 führte zu einer neuen Form der kriegerischen Asymmetrie. Die EU musste ihre Instrumente anpassen, um sowohl den internationalen Terrorismus als auch regionale Krisen effektiver zu bekämpfen.
Was sind die Petersberger Aufgaben?
Dies sind Missionen, zu denen sich die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet haben, darunter humanitäre Aufgaben, Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze zur Krisenbewältigung.
Welche Rolle spielt das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK)?
Das PSK beobachtet die internationale Lage, hilft bei der Definition der Politik im Rahmen der GASP und übt die politische Kontrolle über Krisenbewältigungseinsätze aus.
Was ist das Ziel des EU-Militärstabs (EUMS)?
Der EUMS liefert militärisches Fachwissen und ist für die strategische Planung von Einsätzen sowie die Überwachung der militärischen Kapazitäten zuständig.
In welchen Regionen wurde das EU-Krisenmanagement konkret untersucht?
Die Arbeit analysiert die praktische Anwendung der Instrumente auf dem Balkan, im Irak und im Sudan.
- Citation du texte
- Dimitrios Afentidis (Auteur), 2005, Krisenmanagement der EU auf dem Balkan, im Irak und im Sudan. Die Situation nach den Terroranschlägen des 11. September 2001, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186092