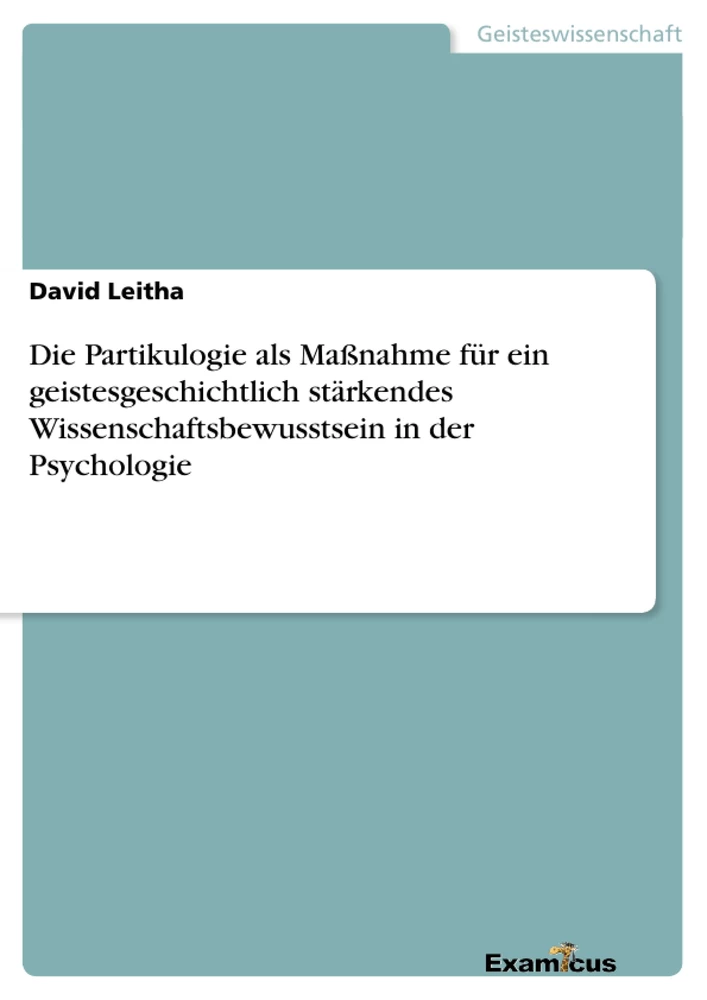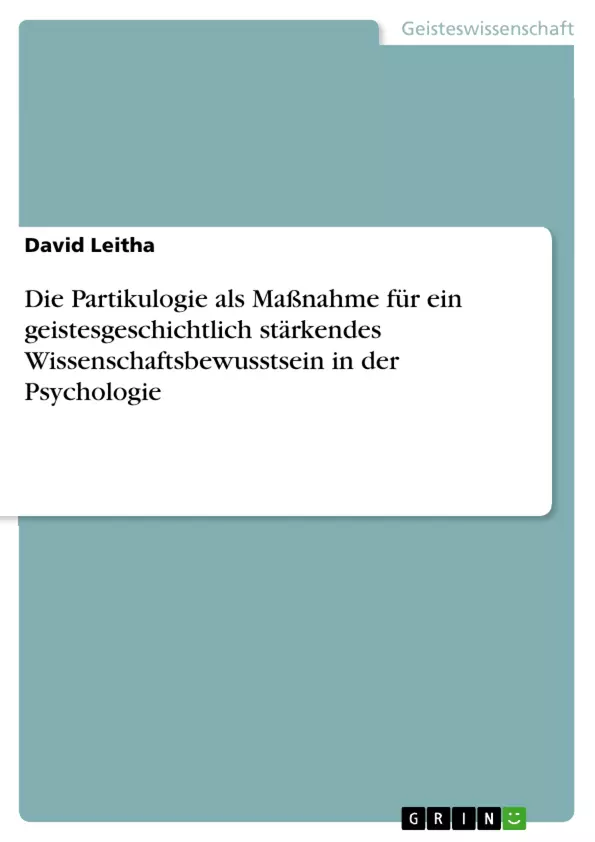Zu Beginn geht es um Geschichtliche Bedingung und kausale Notwendigkeit für eine
Partikulogie in den Wissenschaften vom Menschen, wofür die Methodik ein wichtiges
Ausgangskriterium darstellt.
In der Partikulogie versteht sich das Wort Methode ganz im Sinne der griechischen
Herkunft von "methodos". Keine eigenständige Theorie, sondern die jeweils eigenständige
Gesamtbehandlung, um mit dem Teilnehmer zum Ziel zu gelangen, ist das den
Unterschied erzeugende Moment. So verwendet die Partikulogie niemals den Begriff
"Methode", wenn nur unterschiedliche Strategien mit bestimmten, eigenen Techniken in
der Gesprächsführung angewandt werden. Denn diese (Strategien, Techniken) wurden
entwickelt, um von einer externen Warte aus formulierte Ergebnisse zu erreichen. Bisher
war es üblich, ein "Störungsbild" durch Anwendung verschiedener Methoden reduzieren
oder beseitigen zu wollen.
In der internationalen Forschung wurde jedoch in den letzten Jahren festgestellt, dass es
für jede Sensibilität, die man als "Störungsbild" bezeichnete, nur sehr wenige und bei
exakter Wirkungsmessung oft nur eine einzige Behandlung gibt, um das gewünschte
Ergebnis, nämlich die (beinahe) völlige Beseitigung des Leidenszustandes, zu erreichen.
?Die umfassenden Berner Literaturauswertungen der Psychotherapieforschung
zeigen deutlich, dass die Wirksamkeit dieser Methoden [partikulogisch gesehen,
falscher Begriff. Richtig ist: ?Verfahren?; Anm. des Autors] bei den Störungen, für
die sie entwickelt wurden, besonders gut belegt werden konnte?
(s. Grawe, 1992; Grawe et al., 1994; zit. nach Pauli 1996, S. 90)
Deshalb sah sich die Partikulogie (seit Erscheinen des ersten Bandes von Leitha 2002c)
genötigt, die Verwendung einer "Methode" in der Terminologie der Psychotherapeuten als
eine Etikettierung mit einer Vorgangsweise mit im inhaltlichen stets gleich bleibenden
Strategien und Techniken aufzudecken. Dies hing vielfach mit dem historischen Einfluss
der jeweiligen Psychotherapeutischen Schule auf die Gesellschaft zusammen, in der sich
die potentiellen Konsumenten der jeweiligen Psychotherapie befanden. Somit haftete einer
"Methode" stets die Wertigkeit an, die der
"Geist, der Ursprung und Ziel dieses Weges bestimmt"
(Findeisen 1979, S. 109-110)
ihr verlieh.
Keine Methode war als wertfrei zu verstehen. (nach Leitha 2002c, S. 10)
"Mit der Frage nach der Kompetenz ist aber aufs engste auch die Frage nach der
Methodik verbunden."
(Antholzer 1986, S. 12).
Die Partikulogie achtet dies als falsche Entwicklung und als einen Irrweg, der aufgrund
vorherrschender Meinungen mit einem stark reduktionistischen Weltbild von Psychiatern
und Neurologen der alten Schule gegangen wurde. Sie beruft sich deshalb auf die
ursprüngliche Bedeutung des Begriffs "Methode" und führt ihn erst im konkreten
Zusammenhang mit der - aufgrund von gesammelten Fallbeispielen auf Evidenz
basierender, sowie durch ihre in den Kulturen der Menschheit über Jahrhunderte und
Jahrtausende bewährte, Art - Unterscheidung von grundlegend verschiedenen Wegen der
Reduzierung und Beseitigung von Leidenszuständen aufgrund von verschiedenen ihnen
zuordenbaren Sensibilitäten ein.
Es seien die Methoden des Tanzes, des Malens, des Musizierens und des verbalen
Kommunizierens genannt. Die Methodik der Partikulogie wird im Punkt 3 des Kapitels 2.
Die Sensibilitätenlehre dargelegt.
Im Mittelteil geht es um die Fachbereiche des Studiums der Partikulogie:
Im vierten Jahr seit der Gründung der Partikulogie durch David Leitha ist ?Adaptives
Engagement für hilfebedürftige Menschen? der erste von fünf Fachbereichen. Der erste
Fachbereich umfasst drei Fächer:
1. Gesprächsstrategien in der partikulogischen Beratung
2. Zeichen- und Mal-Techniken sowie Reflexions-Stufen im Drei-Stufen
Modell der partikulogischen Kunsttherapie
3. Die Partikulogie als Grundlage für eine europaweite Psychotherapie
Im Fachbereich ?Berufsbild? gibt es derzeit drei Fächer:
1. Anwendung von psychologischer Befundung für partikulogische
Persönlichkeitsentfaltungsuntersuchungen und -behandlungen
2. Geschichte der wissenschaftlichen Praxis in den Humanwissenschaften vor
der Entstehung der Partikulogie
3. Die Partikulogie als neue Humanwissenschaft, als
Komplementärwissenschaft zur Medizin (die an externe Substanzen und
Geräte gebunden ist) und als Rahmen und Stütze für eine kompetente
Psychologie, sowie die individuell gestaltete
Integration von psychologischen Aspekten in der Berufspraxis des
Partikulogen
Nach heutigem Verständnis der Scientific Community zum Begriff ?Kultur? sind
folgende vier Fächer Bestandteil des Fachbereichs für ?Kulturelle Kompetenzen?:
1. Spirituelle Heilmethoden für Katholiken
2. Kulturell bedingte Lebensweisen auf unterschiedlichen Erdteilen
(am Beispiel Kenia)
3. Obsessionen abschütteln durch afrikanische Tanzrituale
4. Kreatives Potential in fundamentalistisch gesinnten Menschen
Im Fachbereich ?Sensibilitätenlehre? gelangen die gelehrten Inhalte des Fachs Diagnose
der Persönlichkeit als Vorbedingung für eine Behandlung aufgrund des partikulogischen
Grundsatzes, dass eine Diagnose, die nach ausdrücklichem Auftrag und allein im Falle
eines zu stellenden Befundes, vom die Behandlung leitenden Partikulogen ausgestellt
werden darf, und, dass der Teilnehmer einen subjektiven Sinn in der Diagnose sieht, zur
Anwendung. Deshalb ist das genannte Fach unter den folgenden drei Fächern als ein
Nebenfach eingerichtet worden.
1. Fähigkeitsförderung in besonderen Zuständen
2. Rücksichtnahme auf kranke Anteile im teilgesunden Menschen ? "phantom
normalcy"
3. Diagnose der Persönlichkeit als Vorbedingung für eine Behandlung
Der Fachbereich ?Menschenbild? umfasst folgende drei Fächer:
1. Dekonstruktion vom hierarchischen Prinzip in der Fremdbeurteilung
2. Inter-individuelle Unterschiede im Lebenssinn
3. Persönlichkeitsentfaltung als ethische Anforderung, das Unmögliche möglich
werden zu lassen
Zuletzt werden wieder Fallbeispiele berichtet, das am praktischen Leben am meisten orientierte Fallbeispiel wird als letztes berichtet, es stammt aus einer Lehrveranstaltung des Autors, die mit "Ausgezeichnet" absolviert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1- Übersicht über die Partikulogie
- A. Formaler Rahmen für die Partikulogie als lehrbare Wissenschaft
- B. Inhalt der Partikulogie
- II - Rahmenprogramm für die Lehre partikulogisch-wissenschaftlichen Verständnisses und Praktizierung der Lehre in Form eines Studiums mit theoretischen und praktischen Teilen
- 1. Geschichtliche Bedingung und kausale Notwendigkeit für eine Partikulogie in den Wissenschaften vom Menschen
- 2. Die Sensibilitätenlehre
- 2.1. Zum Krankheitsbegriff
- 2.1.a. Das partikulogische Rahmenmodell
- 2.1.b. Bedeutende Aspekte in der geschichtliche Entwicklung, welche anstelle des Umgangs mit verschiedenen auf sozialen Repräsentationen beruhenden Mächten für Europa und den angloamerikanischen Ländern bisher eine „Krankheits“-Lehre erlaubten, bedingten und rechtfertigten
- 2.1.c. Bedingungen für das Diagnostizieren einer psychischen Krankheit
- 2.2. Grundsatz der Sensibilitätenlehre
- Statement zum unangebrachten Universalismus-Gedanke in den, Wissenschaften vom Menschen
- 2.3. Nosologie in der Sensibilitätenlehre
- 2.3.1. Erklärungen
- Assoziationsunkonventionalität
- Beispiel für die Relativität der „Konvention“ in der kognitiven Informationsverarbeitung: Individualisierung und differentielle Arbeitsgestaltung
- 2.3.2. Die Taxonomie der Sensibilitäten
- 2.3.2.1. Kontrollierte Emotionsverweigerungen
- 2.3.2.2. Unkontrollierbare Emotionslastigkeit
- 2.3.2.2.1. Die Sensibilität der unkontrollierbaren Emotionslastigkeit allgemein
- 2.3.2.2.2. Die besonderen Erlebnisse bei den Formen der unkontrollierbaren Emotionslastigkeit
- 2.3.2.2.3. Assoziationsverarbeitungsunkonventionalität als eine Form der unkontrollierbaren Emotionslastigkeit
- 2.3.2.2.4. Assoziationsverarbeitungsunkonventionalität mit Affekthandlungen als eine zweite Form der unkontrollierbaren Emotionslastigkeit
- Exkurs: Gegenüberstellung und Gemeinsamkeitsforschung (bezüglich unkontrollierter Emotionslastigkeit und kontrollierter Emotionsverweigerung und die diagno -stische Erfassung mit den Items „pneumatische Kompression eines bewusstseinsinhaltes“ und „Dichte der bedeutsamen Ereignisse" aus den Persönlichkeitsskalen von Leitha)
- 2.3.2.2.5. Unkontrollierbare Emotionslastigkeit mit Schwermut
- 2.3.2.2.6. Entzug aus der Eigenverantwortung über sein Leben
- 2.3.2.3. Eigenausdrucks- und Selbstwahrnehmungs-verzerrungen
- 2.3.3. Ermächtigung zur Nutzung der Eigenverantwortung über das eigene Leben
- 2.4. Der Umgang zwischen Sensiblen oder: Wenn Ermächtigung zur Eigenverantwortung mehrerer Betroffenen, LO 5 gleichzeitig führt
- 2.4.1. Das Recht des Stärkeren unter zur Eigenverantwortung Ermächtigten
- 2.4.2. Der eigene Umgang mit dem Bewusstsein der Macht
- 2.4.3. Gemaßregelt zu werden als Stärkster unter zur Eigenverantwortung Ermächtigten
- 2.4.4. Vorgang, der das Klima für eine Sublimation gestauter sexueller Kraft zur Verfügung stellt
- 2.5. Methodenlehre
- 5.1. Die vier Methoden
- 5.2. Äthiologie, Epidemiologie und Effektmessung beim Erfolg der Behandlung von zu tanzenden Sensibilitäten
- 3. Fachbereiche am Institut
- 3.1. Erster Fachbereich: Adaptives Engagement für hilfebedürftige Menschen
- 1. Hauptfach: Gesprächsstrategien in der partikulogischen Beratung
- 3.1. Erster Fachbereich: Adaptives Engagement für hilfebedürftige Menschen
- 2.3.1. Erklärungen
- Die historische Entwicklung und die Notwendigkeit der Partikulogie in den Wissenschaften vom Menschen
- Die Sensibilitätenlehre als Kern der Partikulogie
- Die Taxonomie der Sensibilitäten und ihre Auswirkungen auf das menschliche Verhalten
- Die Bedeutung der Eigenverantwortung und des Umgangs zwischen Sensiblen
- Die Anwendung der Partikulogie in der Praxis, insbesondere in der Beratung und Therapie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit stellt eine umfassende Einführung in die Partikulogie dar, eine neue wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Erforschung und Behandlung von Sensibilitäten beschäftigt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Partikulogie als ein Instrument zur Stärkung des Wissenschaftsbewusstseins in der Psychologie zu etablieren und gleichzeitig das Image der Psychologie als Hilfswissenschaft zu verbessern.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet einen Überblick über die Partikulogie als lehrbare Wissenschaft. Es werden die formalen Rahmenbedingungen und der Inhalt der Disziplin vorgestellt. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Rahmenprogramm für die Lehre partikulogisch-wissenschaftlichen Verständnisses und Praktizierung. Es werden die geschichtlichen Bedingungen und die kausale Notwendigkeit für eine Partikulogie in den Wissenschaften vom Menschen erläutert. Ein Schwerpunkt liegt auf der Sensibilitätenlehre, die den Krankheitsbegriff neu definiert und die verschiedenen Formen von Sensibilitäten beschreibt. Das dritte Kapitel stellt die Fachbereiche am Institut für Partikulogie vor, wobei ein besonderer Fokus auf den ersten Fachbereich, dem adaptiven Engagement für hilfebedürftige Menschen, gelegt wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Partikulogie, Sensibilitätenlehre, Wissenschaftsbewusstsein, Psychologie, Hilfswissenschaft, Krankheitsbegriff, Taxonomie der Sensibilitäten, Eigenverantwortung, Umgang zwischen Sensiblen, Beratung, Therapie, adaptives Engagement, Gesprächsstrategien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Partikulogie?
Partikulogie ist eine von David Leitha begründete Humanwissenschaft, die sich als Komplementärwissenschaft zur Medizin versteht und den Fokus auf individuelle "Sensibilitäten" statt auf pauschale Störungsbilder legt.
Wie definiert die Partikulogie den Begriff "Methode"?
Sie beruft sich auf die ursprüngliche Bedeutung ("methodos" – Weg zum Ziel) und lehnt die Verwendung von Methoden als bloße Techniken ab, die von einer externen Warte aus Störungen beseitigen wollen.
Was versteht man unter der "Sensibilitätenlehre"?
Anstelle von Krankheitsdiagnosen klassifiziert die Partikulogie verschiedene Sensibilitäten (z. B. unkontrollierbare Emotionslastigkeit), die individuelle Wege der Behandlung (wie Tanz, Musik oder Gespräch) erfordern.
Was ist das Ziel der partikulogischen Beratung?
Das Ziel ist die Ermächtigung zur Eigenverantwortung über das eigene Leben und die Reduzierung von Leidenszuständen durch adaptive, auf den Teilnehmer zugeschnittene Strategien.
Welche Rolle spielen kulturelle Kompetenzen in der Partikulogie?
Sie sind essenziell, da Lebensweisen und Heilmethoden (z. B. afrikanische Tanzrituale oder spirituelle Wege) stark kulturell bedingt sind und in die Behandlung einfließen sollten.
- 2.1. Zum Krankheitsbegriff
- Quote paper
- David Leitha (Author), 2006, Die Partikulogie als Maßnahme für ein geistesgeschichtlich stärkendes Wissenschaftsbewusstsein in der Psychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186263