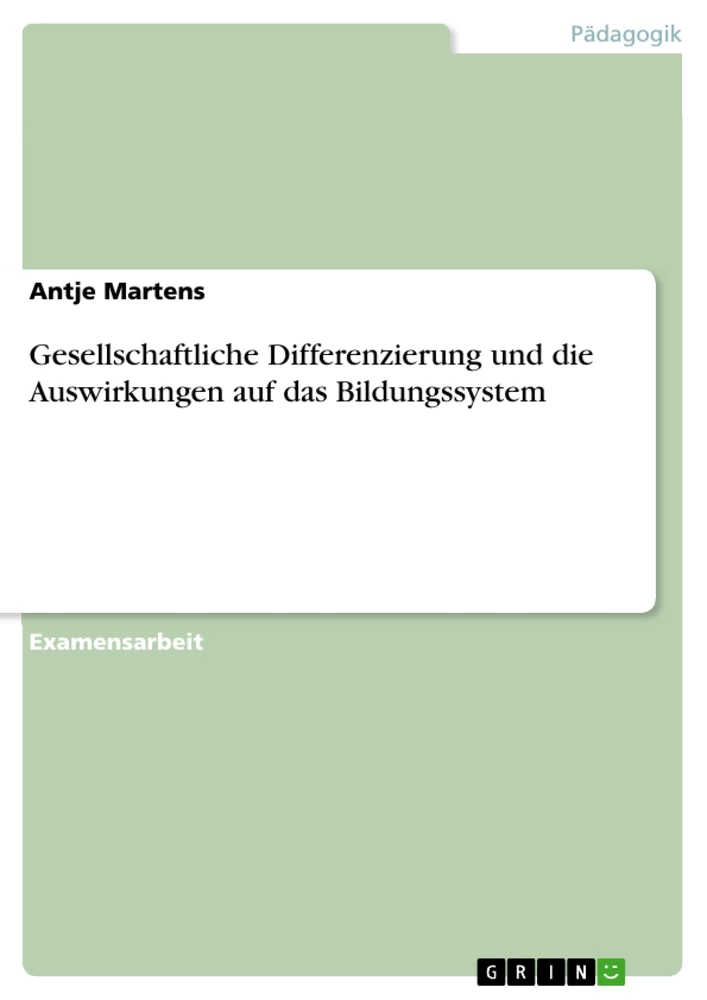Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem der bildungsrelevanten gesellschaftlichen Differenzierung und der Bildungsbeteiligung von Kindern unterschiedlicher gesellschaftlicher Schichtzugehörigkeit unter den jeweils gegebenen gesellschaftspolitischen Verhältnissen. Dass Gesellschaften sich innerlich differenzieren und sich bestimmte Gesellschaftsgruppen durch soziale Merkmale voneinander abgrenzen, ist keine neue Begebenheit. In der Regel sind sozioökonomische Faktoren maßgebend für die Lebensführung eines Menschen. Historisch betrachtet hat der Einzelne heute in unserer modernen Schichtgesellschaft mehr Einfluss denn je auf seine individuelle Lebensgestaltung. Als Schicht wird dabei eine berufsnahe Gruppierung von Menschen verstanden, die ähnlich gleich bewertet und entlohnt wird. Anhand dieser Systematik bilden sich mehrere - graduell und hierarchisch unterscheidbare - soziale Gruppen heraus, die sich in ökonomischer Hinsicht voneinander trennen lassen. Die interne soziale Mobilität in der Schichtgesellschaft ist höher als in der Stände- oder Klassengesellschaft. Im feudalen Ständesystem etwa war die familiäre Herkunft absolut entscheidend, sozialer Aufstieg nur durch Geburt möglich und soziale Mobilität kaum gegeben. Ebenso undurchlässig und dualistisch geprägt war die frühindustrielle Klassengesellschaft, in welcher zwar nicht mehr die Geburt über die Verwirklichungschancen eines Menschen entschied, sondern vielmehr der Besitz von Kapital. Heute sind vor allem die Bildung und die berufliche Qualifikation entscheidend für die soziale Stellung eines Menschen. Damit kommt der Bildung eine zentrale Rolle zu, denn sie erhält gesellschaftlich Schlüsselfunktion. Der soziale Auf- oder Abstieg in derSchichtgesellschaft ist also abhängig von der persönlichen Leistung, die der Einzelne erbringt. Entsprechend wird angenommen, dass die Schichtgesellschaft als ,,offene" Gesellschaft die Übergänge von Schicht zu Schicht ermöglicht und ein leichtes Überschreiten der Schichtgrenzen erlaubt. Die Arbeit setzt sich familiären, institutionellen und politischen Mechanismen auseinander, die Bildungschancen bestimmter sozialer Gruppen vermindern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Betrachtung von Bildungszugängen und gesellschaftlichen Strukturen in Deutschland
- Preußen zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- Die neuhumanistische Bildungsidee und ihre Realisierungschancen zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- Die Auseinanderentwicklung des niederen und des höheren Schulwesens
- Die Weimarer Republik
- Konflikte und Kompromisse bei der Umgestaltung der Volksschule
- Die Umsetzung der beschlossen Schulartikel und ihre Wirkung
- Die Schule nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten
- Die Grundprinzipien der nationalsozialistischen Politik
- Selektion in der nationalsozialistischen Schule
- Die schulpolitische rassistische Gesinnung
- Der Zugang zur Bildung heute
- Soziale Ungleichheit und Benachteiligung
- Armut - eine extreme Dimension sozialer Ungleichheit
- Armutsgefährdete Risikogruppen
- Alleinerziehende
- Kinder und Jugendliche
- Menschen mit Migrationshintergrund
- Auswirkungen einer benachteiligten Lebenslage auf ausgewählte Lebensbereiche
- Allgemeiner Gesundheitszustand sozial benachteiligter Kinder
- Übergewicht und Adipositas
- Entwicklungsstörungen
- Die sozialräumliche Konzentration von sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen
- Räumliche Segregation/soziale Polarisierung am Beispiel Berlins
- Die soziale Infrastruktur der Berliner Bezirke mit einem niedrigen Sozialindex
- Der familiäre Umgang mit der sozialen Benachteiligung
- Bewältigungsmuster von Kindern
- Allgemeiner Gesundheitszustand sozial benachteiligter Kinder
- Soziale Mechanismen beeinflussen die Bildungschancen
- Faktoren innerhalb der Familie
- Schichtspezifischer Sprachgebrauch
- Boudons Ansatz zur Erklärung schichtspezifischer Bildungsungleichheiten
- Faktoren innerhalb der Familie
- Überkommene Mechanismen im deutschen Schulsystem verstärken die ungleichen Bildungschancen
- Exkurs: Bildungssituation von Kindern mit Migrationshintergrund
- Population der Kinder mit Migrationshintergrund
- Bildungsbeteiligung
- Mangelnde sprachliche Kompetenz bei Kindern mit Migrationshintergrund
- Sprachliche Frühförderung in Deutschland - Der Umgang mit Migrationshintergründen an deutschen Kindertagesstätten und Schulen
- Integrations- und sprachfördernde Konzepte anderer Länder
- Sprachfördernde Projekte in der Bundesrepublik
- Kriterien der Übergangsempfehlungen – und fragliche Prognosefähigkeit
- Die Rolle des Lehrers
- Exkurs: Bildungssituation von Kindern mit Migrationshintergrund
- Konsequenzen für das Bildungssystem
- Zu frühe Selektion im Bildungssystem und die Schwierigkeit der hierarchischen Dreigliedrigkeit
- Die Wertminderung der Schulabschlüsse
- Der vorschulische Bereich
- Sekundarstufe I und II
- Politik
- Anhänge
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Problematik der gesellschaftlichen Differenzierung und deren Auswirkungen auf das deutsche Bildungssystem. Sie analysiert, wie soziale Ungleichheit und Benachteiligung die Bildungsbeteiligung von Kindern unterschiedlicher gesellschaftlicher Schichtzugehörigkeit beeinflussen. Die Arbeit untersucht dabei die historischen Entwicklungen des Bildungssystems, die Auswirkungen sozialer Benachteiligung auf verschiedene Lebensbereiche und die Mechanismen, die zu ungleichen Bildungschancen führen.
- Historische Entwicklung des deutschen Bildungssystems und die Rolle von Selektion und sozialer Differenzierung
- Auswirkungen sozialer Benachteiligung auf den Gesundheitszustand, die räumliche Konzentration und den familiären Umgang von Kindern
- Einfluss von Faktoren innerhalb der Familie und des Bildungssystems auf die Bildungschancen
- Die Bildungssituation von Kindern mit Migrationshintergrund und die Bedeutung von Sprachförderung
- Kritik an der Selektivität des deutschen Bildungssystems und die Forderung nach einer gerechteren Bildungslandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der gesellschaftlichen Differenzierung und deren Auswirkungen auf das Bildungssystem ein. Sie stellt die Relevanz des Themas dar und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das erste Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des deutschen Bildungssystems. Es werden die wichtigsten Etappen und Ereignisse der schulgeschichtlichen Entwicklung dargestellt, um die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, ihre Ergebnisse und Auswirkungen sowie die politische Funktionalisierung von schulischer Bildung und Selektion in bestimmten Zeitabschnitten aufzuzeigen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen von sozialer Benachteiligung auf verschiedene Lebensbereiche. Es werden die Folgen von Armut, sozialer Segregation und familiärer Benachteiligung für den Gesundheitszustand, die räumliche Konzentration und den familiären Umgang von Kindern untersucht.
Das dritte Kapitel analysiert die sozialen Mechanismen, die die Bildungschancen von Kindern beeinflussen. Es werden Faktoren innerhalb der Familie, wie der schichtspezifische Sprachgebrauch und Boudons Ansatz zur Erklärung schichtspezifischer Bildungsungleichheiten, betrachtet.
Das vierte Kapitel untersucht die Rolle des deutschen Bildungssystems bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit. Es werden die Kriterien der Übergangsempfehlungen, die Rolle des Lehrers und die Bedeutung von Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund beleuchtet.
Das fünfte Kapitel diskutiert die Konsequenzen für das Bildungssystem. Es werden die Kritik an der zu frühen Selektion, die Wertminderung der Schulabschlüsse und die Notwendigkeit einer gerechteren Bildungslandschaft thematisiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die gesellschaftliche Differenzierung, soziale Ungleichheit, Bildungsbeteiligung, Bildungssystem, Selektion, soziale Benachteiligung, Armut, Migrationshintergrund, Sprachförderung, Inklusion und Schulentwicklung.
Häufig gestellte Fragen zu gesellschaftlicher Differenzierung und Bildung
Wie beeinflusst die soziale Schichtzugehörigkeit die Bildungschancen?
Trotz der theoretischen Offenheit unserer Schichtgesellschaft hängen Bildungserfolge stark von sozioökonomischen Faktoren ab. Kinder aus privilegierten Schichten erhalten oft mehr Unterstützung, was zu ungleichen Startbedingungen führt.
Was ist der "schichtspezifische Sprachgebrauch"?
Dieser Begriff beschreibt Unterschiede in der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit je nach sozialer Herkunft. Da Schulen oft einen elaborierten Sprachcode voraussetzen, haben Kinder aus bildungsfernen Schichten häufiger Schwierigkeiten, dem Unterricht zu folgen.
Warum wird die frühe Selektion im deutschen Schulsystem kritisiert?
Die Aufteilung nach der vierten Klasse auf verschiedene Schulformen festigt soziale Ungleichheiten. Zu diesem frühen Zeitpunkt hängen die Empfehlungen oft mehr vom familiären Hintergrund als vom tatsächlichen Potenzial des Kindes ab.
Welche Rolle spielt die Armut für den Bildungsweg?
Armut führt oft zu einer Kumulation von Nachteilen: schlechterer Gesundheitszustand, räumliche Segregation in Bezirken mit niedrigem Sozialindex und weniger kulturelle Ressourcen im Elternhaus erschweren den Bildungserfolg massiv.
Wie wirkt sich ein Migrationshintergrund auf die Bildungsbeteiligung aus?
Kinder mit Migrationshintergrund stehen oft vor der zusätzlichen Hürde mangelnder sprachlicher Frühförderung. Wenn das Schulsystem diese Defizite nicht auffängt, führt dies zu einer geringeren Beteiligung an höheren Bildungsabschlüssen.
Was besagt Boudons Ansatz zur Bildungsungleichheit?
Boudon unterscheidet zwischen primären Herkunftseffekten (Leistungsunterschiede durch das Elternhaus) und sekundären Herkunftseffekten (Bildungsentscheidungen der Eltern trotz gleicher Leistung). Letztere führen dazu, dass Arbeiterkinder bei gleicher Note seltener ein Gymnasium besuchen.
- Quote paper
- Antje Martens (Author), 2006, Gesellschaftliche Differenzierung und die Auswirkungen auf das Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186320