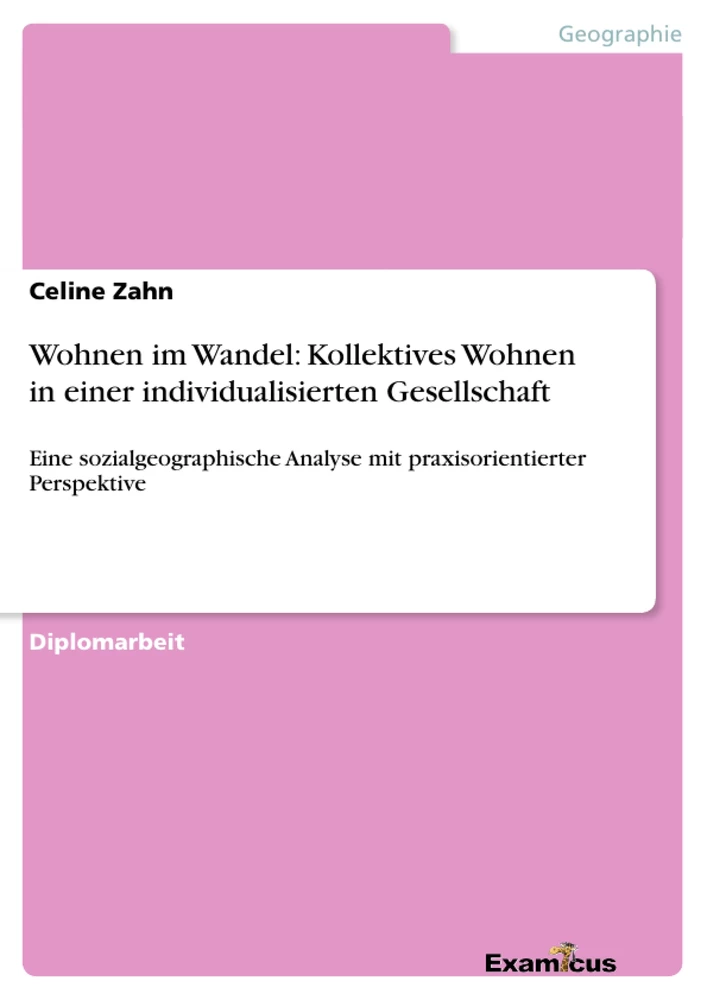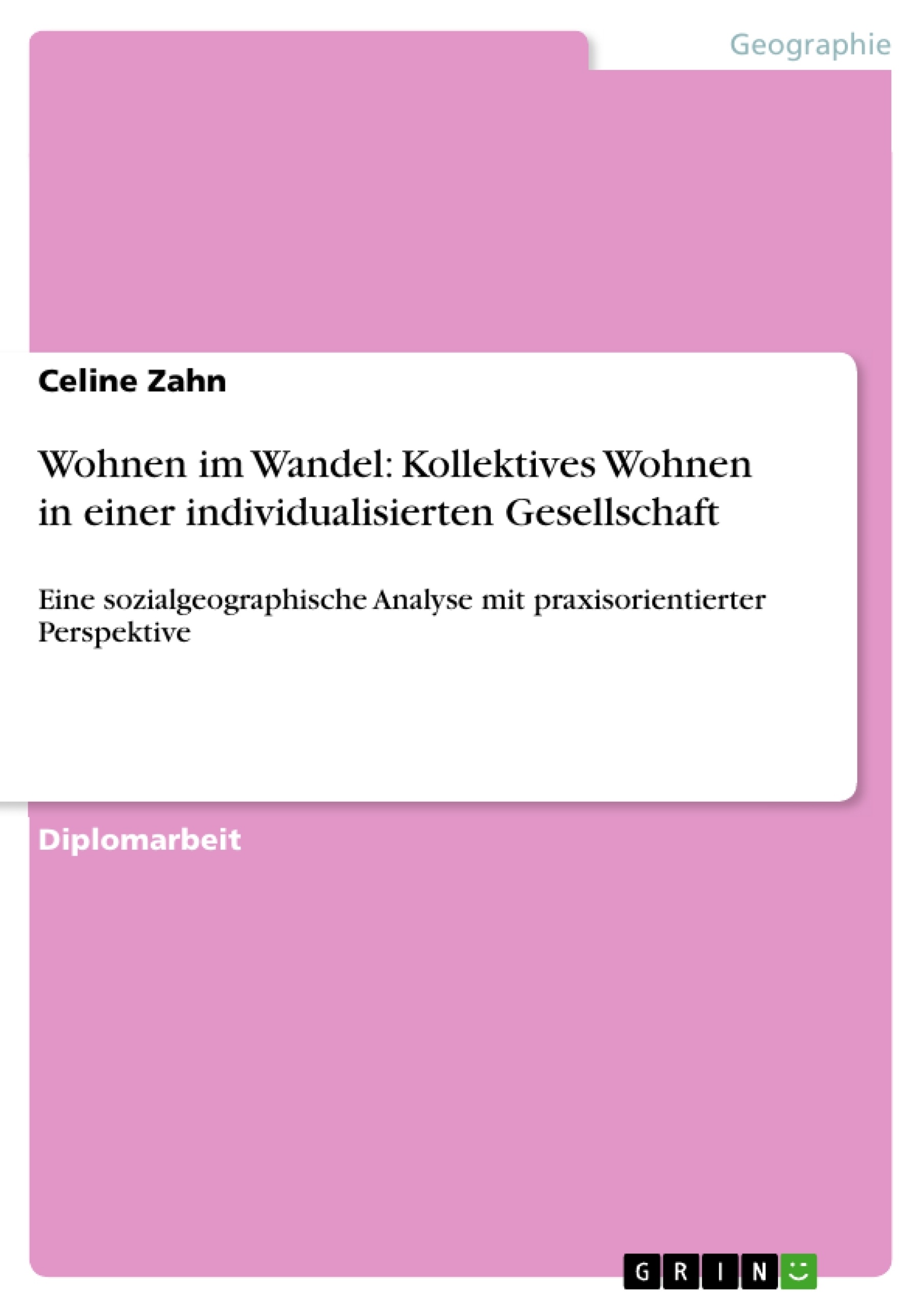Thema
Der Werte- und Normenwandel vergangener Jahrzehnte hat zu einer Ausbildung neuer Lebensstile und Lebensformen geführt.
Gleichzeitig wird eine zunehmende soziale und infrastrukturelle Isolierung und ökonomische Destabilisierung einzelner Bevölkerungsteile und Räume prognostiziert.
Die Folgen dieses demographischen und gesellschaftlichen Wandels stellen vor allem berufstätige Eltern, aber auch den steigenden Anteil an Senioren, vor strukturelle Probleme. Daneben kommt es zu einer Ausdifferenzierung von Wohnwünschen, die nicht alle in traditionellen Wohnformen umgesetzt werden können. Kollektive Wohnformen werden in diesem Zusammenhang als zukunftsfähige Wohnformen erachtet und erleben aktuell einen Nachfrageboom.
Ziel
Das Ziel dieser Untersuchung war eine Bewertung, inwieweit Mehrgenerationenwohnprojekte als eine Form kollektiver Wohnformen den veränderten Wünschen und Anforderungen der Bewohner in Deutschland gerecht werden können und welche Lösungen sie für die strukturellen Probleme der Gesellschaft bieten. Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für praxisorientierte Hinweise für Praktiker.
Methode
Die Grundlage dieser qualitativen Untersuchung bildet ein handlungstheoretisches Konzept. Neben einer Betrachtung der gesellschaftlichen Hintergründe wurden individuelle Hand-lungshintergründe und Folgen der Wohnraumwahl untersucht. Mittels einer Sekundäranalyse von Wohnprojekten in Nachbarländer wurden nähere Hinweise auf die langfristige Entwicklung der Wohnformen ermittelt. Die Befragungsdaten verschiedener Personengruppen (Experten, Bewohner kollektiver und herkömmlicher Wohnformen) aus verschiedenen Ländern und Jahrzehnten und die Kombination verschiedener Methoden (Einzel-, Experten und Gruppeninterviews, Sekundäranalyse) gewährleistet eine hohe Validität der Ergebnisse. Gewinner des Dr. Prill-Preis 2007
Gesellschaft für Erdkunde Köln
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Eine sozialgeographische Betrachtung von kollektivem Wohnen
- 2.1 Die Wohnungsmarktforschung in der Sozialgeographie
- 2.2 Der Fokuswechsel von der Raum- zur Handlungswissenschaft
- 2.3 Kritische Betrachtung des handlungstheoretischen Ansatzes nach Benno WERLEN
- 2.4 Kollektives Wohnen aus einer handlungstheoretischen Perspektive
- 3 Veränderte Wohnanforderungen einer individualisierten Gesellschaft
- 3.1 Ein Konzept der individualisierten Gesellschaft
- 3.2 Demographische Veränderungen in Deutschland
- 3.3 Die Entwicklung neuer Lebens- und Haushaltsformen
- 3.4 Exkurs: Das Lebensstilkonzept in der Wohnungsmarktforschung
- 3.5 Auswirkungen der gesellschaftlichen und demografischen Veränderungen auf die Wohnbedürfnisse
- 4 Kollektive Wohnformen als Reaktion auf eine veränderte Gesellschaft
- 4.1 Die Entwicklung kollektiver Wohnformen
- 4.2 Heutige kollektive Wohnformen in Deutschland
- 4.3 Der erwartete Nutzen kollektiver Wohnformen in einer individualisierten Gesellschaft
- 5 Die Untersuchung generationsübergreifender Wohnprojekte
- 5.1 Generationsübergreifende Wohnprojekte als Untersuchungsgegenstand
- 5.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfragen
- 6 Forschungsdesign
- 6.1 Methodische Vorgehensweise
- 6.2 Auswahl der Interviewpartner
- 6.3 Datenerhebung: qualitative, leitfadengestützte Interviews
- 6.4 Datenanalyse: Inhaltsanalyse mit thematischer Kodierung
- 6.5 Methodendiskussion
- 7 Generationsübergreifende Wohnformen in deutschen Nachbarländern
- 7.1 Soziodemographischer Hintergrund der untersuchten Nachbarländer
- 7.2 Entwicklung und Gestaltung kollektiver Wohnformen in Dänemark, Schweden und den Niederlanden
- 7.3 Bewohnerzusammensetzung
- 7.4 Motive für die Wahl kollektiver Wohnformen
- 7.5 Entwicklung generationsübergreifender Wohnformen
- 7.6 Die Bewertung des gemeinschaftlichen Wohnalltags
- 7.7 Zwischenfazit: Chancen und Grenzen kollektiver und generationsübergreifender Wohnformen in deutschen Nachbarländern
- 8 Empirische Ergebnisse generationsübergreifender Wohnformen in Deutschland
- 8.1 Untersuchte Wohnprojekte
- 8.2 Charakterisierung des Interessenten und Bewohner generationsübergreifende Wohnprojekte
- 8.3 Motive für die Wahl generationsübergreifender Wohnformen
- 8.4 Wohnwünsche der Bewohner traditioneller Wohnformen und ihre Vorstellungen von generationsübergreifenden Wohnprojekten
- 8.5 Das generationsübergreifende Wohnprojekt in der Praxis
- 8.6 Die Bewertung generationsübergreifender Wohnformen aus Sicht der Bewohner und Experten
- 8.7 Empfehlungen der Bewohner und Experten für zukünftige Wohnprojekte
- 8.8 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse
- 9 Chancen und Grenzen generationsübergreifender Wohnformen
- 9.1 Der individuelle und gesellschaftliche Wert generationsübergreifender Wohnformen
- 9.2 Praxisorientierte Handreichung zur Förderung generationsübergreifender Wohnformen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kollektives Wohnen im Kontext einer individualisierten Gesellschaft. Ziel ist es, die Entwicklung und Akzeptanz kollektiver Wohnformen, insbesondere generationsübergreifender Projekte, zu analysieren und deren Potenzial für zukünftige Wohnlösungen zu bewerten.
- Sozialgeographische Betrachtung des kollektiven Wohnens
- Veränderte Wohnbedürfnisse in einer individualisierten Gesellschaft
- Generationsübergreifende Wohnprojekte als Lösungsansatz
- Empirische Untersuchung von Wohnprojekten in Deutschland und Nachbarländern
- Chancen und Grenzen kollektiver Wohnformen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema kollektives Wohnen ein und beschreibt die Relevanz der sozialgeographischen Perspektive. Sie skizziert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit.
2 Eine sozialgeographische Betrachtung von kollektivem Wohnen: Dieses Kapitel analysiert den Forschungsstand zum Thema kollektives Wohnen aus sozialgeographischer Sicht. Es beleuchtet den Wandel von der Raum- zur Handlungswissenschaft und kritisch den handlungstheoretischen Ansatz nach Benno Werlen. Es entwickelt schließlich eine handlungstheoretische Perspektive auf kollektives Wohnen.
3 Veränderte Wohnanforderungen einer individualisierten Gesellschaft: Hier wird das Konzept der individualisierten Gesellschaft erläutert und die demographischen Veränderungen in Deutschland untersucht. Die Entwicklung neuer Lebens- und Haushaltsformen und ihre Auswirkungen auf Wohnbedürfnisse werden detailliert dargestellt, unter Einbezug des Lebensstilkonzepts der Wohnungsmarktforschung.
4 Kollektive Wohnformen als Reaktion auf eine veränderte Gesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung und die heutigen Formen des kollektiven Wohnens in Deutschland. Es analysiert den erwarteten Nutzen dieser Wohnformen in einer individualisierten Gesellschaft.
5 Die Untersuchung generationsübergreifender Wohnprojekte: Das Kapitel definiert generationsübergreifende Wohnprojekte als Untersuchungsgegenstand und entwickelt die zentralen empirischen Forschungsfragen der Arbeit.
6 Forschungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der empirischen Untersuchung, die Auswahl der Interviewpartner und die Methoden der Datenerhebung und -analyse (qualitative, leitfadengestützte Interviews; Inhaltsanalyse mit thematischer Kodierung). Es schließt mit einer Methodendiskussion.
7 Generationsübergreifende Wohnformen in deutschen Nachbarländern: Der Vergleich mit Dänemark, Schweden und den Niederlanden liefert einen internationalen Kontext und beleuchtet soziodemographische Hintergründe, Entwicklungen und Gestaltungsformen kollektiven Wohnens in diesen Ländern. Die Motive für die Wahl kollektiver Wohnformen, deren Bewohnerzusammensetzung und die Bewertung des gemeinschaftlichen Alltags werden verglichen.
8 Empirische Ergebnisse generationsübergreifender Wohnformen in Deutschland: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung generationsübergreifender Wohnprojekte in Deutschland. Es charakterisiert die Bewohner und deren Motive, untersucht Wohnwünsche und Vorstellungen, den Alltag in den Projekten und die Bewertung dieser Wohnform durch Bewohner und Experten. Es schließt mit Empfehlungen für zukünftige Projekte.
9 Chancen und Grenzen generationsübergreifender Wohnformen: Das Kapitel bewertet den individuellen und gesellschaftlichen Wert generationsübergreifender Wohnformen und gibt praxisorientierte Handreichungen zu deren Förderung.
Schlüsselwörter
Kollektives Wohnen, Individualisierung, Sozialgeographie, Handlungstheorie, Generationsübergreifende Wohnprojekte, Wohnungsmarktforschung, Demographischer Wandel, Qualitative Forschung, Empirische Untersuchung, Deutschland, Nachbarländer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sozialgeographische Analyse generationsübergreifender Wohnprojekte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht kollektives Wohnen, insbesondere generationsübergreifende Wohnprojekte, im Kontext einer individualisierten Gesellschaft. Der Fokus liegt auf der Analyse der Entwicklung und Akzeptanz solcher Wohnformen und der Bewertung ihres Potenzials für zukünftige Wohnlösungen.
Welche sozialgeographischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert den Forschungsstand zum kollektiven Wohnen aus sozialgeographischer Sicht, beleuchtet den Wandel von der Raum- zur Handlungswissenschaft und kritisch den handlungstheoretischen Ansatz nach Benno Werlen. Es wird eine handlungstheoretische Perspektive auf kollektives Wohnen entwickelt.
Wie werden veränderte Wohnbedürfnisse in einer individualisierten Gesellschaft berücksichtigt?
Die Arbeit erläutert das Konzept der individualisierten Gesellschaft und untersucht die demografischen Veränderungen in Deutschland. Die Entwicklung neuer Lebens- und Haushaltsformen und deren Auswirkungen auf Wohnbedürfnisse werden detailliert dargestellt, unter Einbezug des Lebensstilkonzepts der Wohnungsmarktforschung.
Welche Rolle spielen generationsübergreifende Wohnprojekte?
Generationsübergreifende Wohnprojekte werden als Lösungsansatz für veränderte Wohnbedürfnisse betrachtet. Die Arbeit untersucht diese Projekte empirisch in Deutschland und vergleicht sie mit ähnlichen Projekten in den Nachbarländern Dänemark, Schweden und den Niederlanden.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf qualitativen, leitfadengestützten Interviews. Die Datenanalyse erfolgt mittels Inhaltsanalyse mit thematischer Kodierung. Die Arbeit beschreibt detailliert die methodische Vorgehensweise, die Auswahl der Interviewpartner und die Methodendiskussion.
Welche Länder werden im Vergleich herangezogen?
Neben Deutschland werden Dänemark, Schweden und die Niederlande im Vergleich herangezogen, um soziodemographische Hintergründe, Entwicklungen und Gestaltungsformen kollektiven Wohnens in diesen Ländern zu beleuchten. Der Vergleich umfasst Motive für die Wahl kollektiver Wohnformen, Bewohnerzusammensetzung und die Bewertung des gemeinschaftlichen Alltags.
Welche Ergebnisse wurden in der empirischen Untersuchung erzielt?
Die empirische Untersuchung in Deutschland charakterisiert die Bewohner generationsübergreifender Wohnprojekte und deren Motive. Sie untersucht Wohnwünsche und Vorstellungen, den Alltag in den Projekten und die Bewertung dieser Wohnform durch Bewohner und Experten. Die Ergebnisse münden in Empfehlungen für zukünftige Projekte.
Welche Chancen und Grenzen generationsübergreifender Wohnformen werden aufgezeigt?
Die Arbeit bewertet den individuellen und gesellschaftlichen Wert generationsübergreifender Wohnformen und gibt praxisorientierte Handreichungen zu deren Förderung. Chancen und Grenzen dieser Wohnform werden umfassend diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Kollektives Wohnen, Individualisierung, Sozialgeographie, Handlungstheorie, Generationsübergreifende Wohnprojekte, Wohnungsmarktforschung, Demographischer Wandel, Qualitative Forschung, Empirische Untersuchung, Deutschland, Nachbarländer.
Wo finde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und listet alle Kapitel und Unterkapitel detailliert auf.
- Arbeit zitieren
- Celine Zahn (Autor:in), 2006, Wohnen im Wandel: Kollektives Wohnen in einer individualisierten Gesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186361