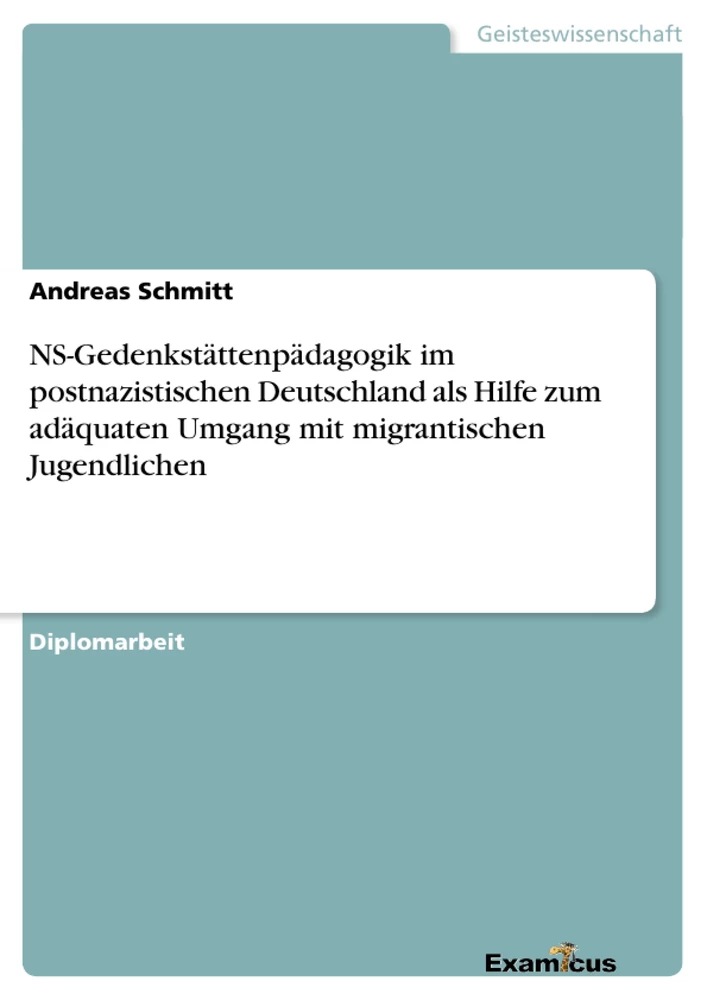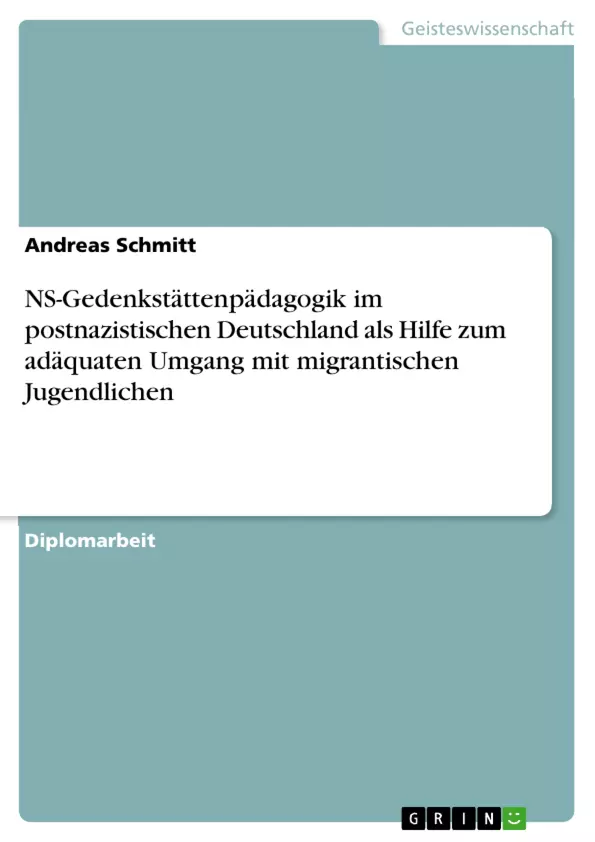Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Einwanderungsland. Diese Tatsache erkennen mittlerweile auch jene Parteien an, die sich lange Zeit gegen diese Einsicht gesträubt haben. Mit dieser Erkenntnis sind aber zahlreiche weitergehende Fragen verknüpft. Wie verändert sich eine Gesellschaft angesichts der Veränderungen in der Zusammensetzung ihrer Bevölkerung und wie sieht das Verhältnis zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft aus? Wo bestehen Unterschiede und wo die Gemeinsamkeiten? Dies sind Fragen die mittlerweile auf der Agenda der aktuellen Regierung stehen. Allerdings sind diese Fragen auch nicht neu und die deutsche Gesellschaft ist auch nicht erst seit Kurzem von Migrationsbewegungen geprägt. Im Gegenteil: Es muss sogar von einer weit zurückgehenden Migrationsgeschichte gesprochen werden. Allerdings erfährt diese bisher keinerlei Würdigung in der Gesellschaft.
Anders sieht es aus mit dem Themenkomplex "Nationalsozialismus und Holocaust". Die Auseinandersetzung mit diesem, ist seit der Gründung der BRD und der DDR fester Bestandteil deutscher Geschichte. Dabei bietet die Thematik immer wieder Stoff zu gesellschaftlichen Debatten von ungeheurer Sprengkraft. So kann in diesem Zusammenhang von einer eigenen Geschichtsgeschichte gesprochen werden.
Zu der Frage, wie die Thematik des Holocaust und des Nationalsozialismus Jugendlichen zu vermitteln ist wurde bereits viel geforscht und veröffentlicht. Ebenso ist das Thema "Bildung und Migration" nicht völlig neu in der wissenschaftlichen Debatte.
Allerdings wurden beide Themen bisher nur selten miteinander verknüpft gedacht, obwohl eine solche Verknüpfung im Grunde genommen sehr nahe liegt. Denn bei Fragen der Integration muss selbstverständlich die Befindlichkeit der Aufnahmegesellschaft zu einem Ausgangspunkt der Überlegungen gemacht werden. Und die ist in der BRD eng verknüpft mit der Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust. Zahlreiche ehemalige Stätten des Terrors erinnern heute daran.
Ich werde in vorliegender Arbeit nun der Frage nachgehen, inwiefern die NS-Gedenkstättenpädagogik im postnazistischen Deutschland als Hilfe zu einem adäquaten Umgang mit migrantischen Jugendlichen dienlich sein kann.
Dazu habe ich mich entschlossen eine theoretische Arbeit vorzulegen, in der ich den aktuellen Stand der Diskussion darstellen und kommentieren werde.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Teil I. Aufarbeitung der Vergangenheit im postnazistischen Deutschland. Die Überlegungen von Theodor W. Adorno und ein historischer Überblick.
- 1. Theodor W. Adornos „, Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit?“ und „Erziehung nach Auschwitz"
- 1.1. „Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit"
- 1.2.,,Erziehung nach Auschwitz"
- 2. Der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit im postnazistischen Deutschland (Ost und West)
- 2.1. Entnazifizierungen
- 2.2. Erstes (Nicht-) Gedenken
- 2.3.,,Wiedergutmachung" und Kontinuitäten
- 2.4. Erster Wandel
- 2.5. Das befreite Deutschland und seine Identitätskrise
- 2.6. Historikerstreit
- 2.7. Veränderte Einstellung
- 2.8. Zusammenfassung Kriegsende bis 1989
- 2.9. Wende und Wiedervereinigung
- 2.10. Die Debatten gehen weiter
- 2.10.1. Die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-44"
- 2,2.10.2. Debatte über die Entschädigung ehemaliger Sklaven- und Zwangsarbeiter
- Teil II. Der lange Weg von „Deutschland" zum Einwanderungsland BRD
- 1. Definition Migration
- 2. Historischer Abriss
- 2.1. Migration vor dem Zweiten Weltkrieg
- 2.2. Migration unter nationalsozialistischer Herrschaft
- 2.3. Migration im unmittelbaren Nachkriegsdeutschland
- 2.4. Migration im Zeichen des Wirtschaftswunders
- 2.5. Familienzusammenführung und Strukturwandel
- 2.6. Widersprüchliche Tendenzen in den 80ern
- 2.7. Migration in der DDR
- 2.8. Migration im wiedervereinigten Deutschland
- 2.9. Die BRD wird auch staatsoffiziell zum Einwanderungsland
- 2.10. Die aktuelle Phase
- Teil III. NS-Gedenkstättenpädagogik mit jungen Migranten
- 1. Jugend, Geschichte und Identität
- 1.1. Definition: Jugend
- 1.2. Definition: Identität
- 1.3. Dimensionen historischer Identität
- 1.4. Historische Identitäten im Migrationskontext
- 1.5. Geschichtsbewusstsein und historische Sinnbildung
- 2. Viola B. Georgis „Entliehene Erinnerung"
- 2.1. Vorstellung der Ausgangsthesen
- 2.2. Typenbildung nach Viola B. Georgi
- 3,3. Holocaust und Nationalsozialismus als exemplarische Lernfelder
- 4. NS-Gedenkstättenpädagogik im postnazistischen Deutschland als Hilfe zum adäquaten Umgang mit migrantischen Jugendlichen
- 4. 1. Erprobte Konzepte im Haus der Wannsee-Konferenz
- 4.2. Menschenrechtsbildung in Gedenkstätten
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Erklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der NS-Gedenkstättenpädagogik im postnazistischen Deutschland und deren Bedeutung für den Umgang mit migrantischen Jugendlichen. Ziel ist es, die Notwendigkeit einer spezifischen Gedenkstättenpädagogik für diese Zielgruppe aufzuzeigen und die Herausforderungen und Chancen dieser Arbeit zu beleuchten.
- Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit im postnazistischen Deutschland
- Die Entwicklung des Einwanderungslandes BRD
- Die Bedeutung von Geschichte und Identität für junge Migranten
- Die Rolle von Gedenkstätten in der Bildungsarbeit
- Die Herausforderungen und Chancen der NS-Gedenkstättenpädagogik mit migrantischen Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Auseinandersetzung mit der Aufarbeitung der Vergangenheit im postnazistischen Deutschland. Dabei werden die Überlegungen von Theodor W. Adorno zu „Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit?“ und „Erziehung nach Auschwitz“ vorgestellt. Anschließend wird ein historischer Überblick über den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in Ost- und Westdeutschland gegeben, der von den Entnazifizierungen bis zu den aktuellen Debatten reicht.
Im zweiten Teil der Arbeit wird der lange Weg von „Deutschland" zum Einwanderungsland BRD beleuchtet. Es wird ein historischer Abriss der Migration nach Deutschland gegeben, der von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bis zur aktuellen Phase reicht. Dabei werden die verschiedenen Phasen der Migration, die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Herausforderungen und Chancen der Integration beleuchtet.
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der NS-Gedenkstättenpädagogik mit jungen Migranten. Es werden die Begriffe Jugend, Geschichte und Identität definiert und die Bedeutung von historischer Identität im Migrationskontext erläutert. Anschließend wird das Konzept der „Entliehenen Erinnerung" von Viola B. Georgi vorgestellt und die Bedeutung des Holocaust und des Nationalsozialismus als exemplarische Lernfelder für die Gedenkstättenpädagogik mit jungen Migranten herausgestellt. Abschließend werden erprobte Konzepte der NS-Gedenkstättenpädagogik im Haus der Wannsee-Konferenz und die Bedeutung der Menschenrechtsbildung in Gedenkstätten beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die NS-Gedenkstättenpädagogik, den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, die Migration, die Integration, die Jugend, die Identität, die historische Identität, das Geschichtsbewusstsein, die Menschenrechtsbildung und die Bildungsarbeit mit jungen Migranten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der NS-Gedenkstättenpädagogik für migrantische Jugendliche?
Sie soll helfen, Jugendlichen mit Migrationshintergrund einen adäquaten Zugang zur deutschen Geschichte des Nationalsozialismus zu ermöglichen und historische Identitätsbildung zu fördern.
Welche Rolle spielen Adornos Thesen in dieser Arbeit?
Theodor W. Adornos Überlegungen zur „Aufarbeitung der Vergangenheit“ und „Erziehung nach Auschwitz“ bilden die theoretische Grundlage für die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit.
Was versteht Viola B. Georgi unter „Entliehener Erinnerung“?
Dieser Begriff beschreibt, wie Jugendliche mit Migrationshintergrund die deutsche Geschichte des Holocaust in ihr eigenes Geschichtsbewusstsein integrieren, obwohl es nicht ihre eigene Familiengeschichte ist.
Wie hat sich Deutschland zum Einwanderungsland entwickelt?
Die Arbeit zeigt einen historischen Abriss der Migration von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg über die Gastarbeiter-Phase bis hin zur staatsoffiziellen Anerkennung als Einwanderungsland.
Gibt es spezielle pädagogische Konzepte für diese Zielgruppe?
Ja, die Arbeit beleuchtet unter anderem erprobte Konzepte aus dem Haus der Wannsee-Konferenz und Ansätze der Menschenrechtsbildung in Gedenkstätten.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Sozialpädagoge Andreas Schmitt (Autor:in), 2007, NS-Gedenkstättenpädagogik im postnazistischen Deutschland als Hilfe zum adäquaten Umgang mit migrantischen Jugendlichen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186395