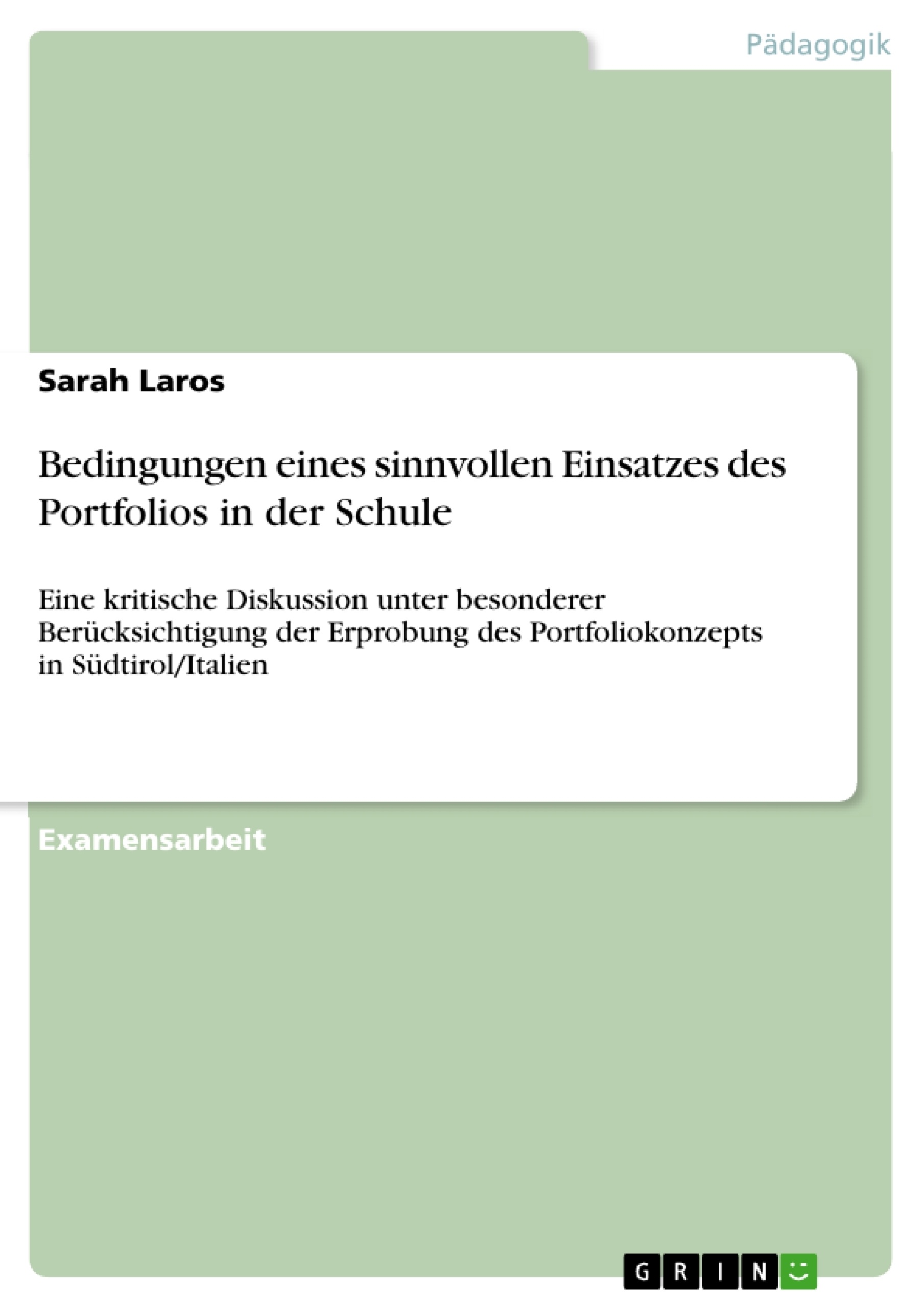Im wissenschaftlichen Diskurs wird das Portfolio nicht immer eindeutig definiert, deshalb wird im Rahmen dieser Arbeit versucht, das Portfolio-Konzept genauer zu konkretisieren. Dazu werden verschiedene Formen dieses Instruments aufgezeigt, Rahmenbedingungen verdeutlicht und Bedingungen für den sinnvollen Einsatz des Portfolios in der Schule aufgeführt.
Am Beispiel der Erprobung des Portfolios in Südtirol werden Erfahrungswerte sichtbar, die ein Jahr nach einer flächendeckenden, gesetzlichen Verordnung aufgetreten sind.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Inhalt der Arbeit
- 1.3 Schwerpunktsetzung
- 2. PROBLEMATIK DER LEISTUNGSBEURTEILUNG
- 2.1 Historische Entwicklung der Leistungsbeurteilung
- 2.2 Definition Leistung und Leistungsmessung
- 2.3 Derzeitige Problematik der Leistungsbeurteilung
- 2.4 Möglichkeiten und Grenzen der Leistungsbeurteilung
- 2.5 Formen der effektiven Leistungsbeurteilung
- 3. KONKRETISIERUNG DER PORTFOLIO-ARBEIT
- 3.1 Definiton des Portfolio-Begriffs
- 3.2 Europäisches Sprachenportfolio
- 3.3 Rahmenbedingungen für die Arbeit mit dem Portfolio
- 3.4 Bedingungen eines sinnvollen Einsatzes des Portfolios in der Schule
- 4. KRITISCHE DISKUSSION AM BEISPIEL SÜDTIROL
- 4.1 Standortbeschreibung Südtirol
- 4.2 Schul- und Bildungssystem in Italien
- 4.3 Reformen
- 4.4 Portfolio der Kompetenzen
- 5. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
- 5.1 Aufbau der Fragebögen
- 5.2 Qualitative Teile der Fragebögen
- 5.3 Semi-strukturierte Interviews
- 5.4 Stichprobe/Untersuchungsgruppe der Fragebögen
- 5.5 Datenaufbereitung
- 5.5.1 Quantitative Datenaufbereitung
- 5.5.2 Qualitative Datenaufbereitung
- 5.5.3 Quantitative Analyse
- 5.5.4 Qualitative Analyse
- 5.6 Zusammenfassung
- 5.7 Interpretation der Daten
- 6. FAZIT
- NACHWORT
- LITERATURVERZEICHNIS
- ANHANG
- Fragebogenauswertung
- Quantitative Daten
- Rohdaten 1
- Rohdaten 2
- Fragebögen deutsch
- Fragebögen italienisch
- Darstellung der Auswertung der Fragebögen
- Paraphrasierung offener Fragen
- Transkription der Interviews
- Fotos
- Historische Entwicklung der Leistungsbeurteilung
- Definition und Anwendung des Portfolio-Begriffs
- Rahmenbedingungen für den Einsatz des Portfolios in der Schule
- Kritische Analyse des Portfolios im Vergleich zu anderen Formen der Leistungsbeurteilung
- Empirische Untersuchung des Portfoliokonzepts in Südtirol/Italien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der kritischen Diskussion des Portfolios als Instrument der Leistungsbeurteilung im schulischen Kontext. Ziel ist es, die Bedingungen für einen sinnvollen Einsatz des Portfolios in der Schule zu erforschen und zu analysieren, wobei der Fokus auf der Erprobung des Portfoliokonzepts in Südtirol/Italien liegt. Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung der Leistungsbeurteilung, definiert den Portfolio-Begriff und analysiert die Rahmenbedingungen für die Arbeit mit dem Portfolio. Darüber hinaus werden die Möglichkeiten und Grenzen des Portfolios im Vergleich zu anderen Formen der Leistungsbeurteilung beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und erläutert die Zielsetzung, den Inhalt und die Schwerpunktsetzung der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Problematik der Leistungsbeurteilung, indem es die historische Entwicklung, die Definition von Leistung und Leistungsmessung sowie die derzeitige Problematik der Leistungsbeurteilung analysiert. Es werden Möglichkeiten und Grenzen der Leistungsbeurteilung diskutiert und verschiedene Formen der effektiven Leistungsbeurteilung vorgestellt. Kapitel 3 konkretisiert den Portfolio-Begriff, beschreibt das Europäische Sprachenportfolio und analysiert die Rahmenbedingungen für die Arbeit mit dem Portfolio. Es werden die Bedingungen eines sinnvollen Einsatzes des Portfolios in der Schule erörtert. Kapitel 4 widmet sich der kritischen Diskussion des Portfolios am Beispiel Südtirols. Es werden die Standortbeschreibung Südtirols, das Schul- und Bildungssystem in Italien sowie die Reformen im Bildungssystem beleuchtet. Darüber hinaus wird das Portfolio der Kompetenzen in Südtirol vorgestellt. Kapitel 5 präsentiert die empirische Untersuchung des Portfolios in Südtirol. Es werden der Aufbau der Fragebögen, die qualitative und quantitative Datenaufbereitung sowie die Analyse der Daten beschrieben. Die Zusammenfassung und Interpretation der Daten werden ebenfalls dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Leistungsbeurteilung, das Portfolio, die Erprobung des Portfoliokonzepts in Südtirol/Italien, die historische Entwicklung der Leistungsbeurteilung, die Definition des Portfolio-Begriffs, die Rahmenbedingungen für die Arbeit mit dem Portfolio, die Bedingungen eines sinnvollen Einsatzes des Portfolios in der Schule, die Möglichkeiten und Grenzen des Portfolios im Vergleich zu anderen Formen der Leistungsbeurteilung, die empirische Untersuchung des Portfoliokonzepts in Südtirol/Italien, die Analyse der Daten und die Interpretation der Ergebnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Portfolio im schulischen Kontext?
Ein Portfolio ist eine gezielte Sammlung von Schülerarbeiten, die Lernfortschritte und Kompetenzen über einen längeren Zeitraum dokumentiert und reflektiert.
Welche Vorteile bietet die Portfolio-Arbeit gegenüber Noten?
Sie ermöglicht eine individuelle Leistungsbeurteilung, fördert die Selbstreflexion der Schüler und macht Lernprozesse statt nur Endergebnisse sichtbar.
Was sind die Bedingungen für einen sinnvollen Portfolio-Einsatz?
Notwendig sind klare Zielsetzungen, Zeitressourcen für die Reflexion sowie eine entsprechende pädagogische Haltung der Lehrkräfte.
Was zeigt das Beispiel Südtirol bei der Portfolio-Einführung?
Das Beispiel verdeutlicht die Herausforderungen bei einer flächendeckenden gesetzlichen Verordnung und die Bedeutung der Akzeptanz durch Lehrer und Eltern.
Was ist das Europäische Sprachenportfolio?
Ein spezielles Instrument zur Dokumentation von Sprachkenntnissen und interkulturellen Erfahrungen, basierend auf gemeinsamen europäischen Standards.
- Quote paper
- Sarah Laros (Author), 2007, Bedingungen eines sinnvollen Einsatzes des Portfolios in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186435