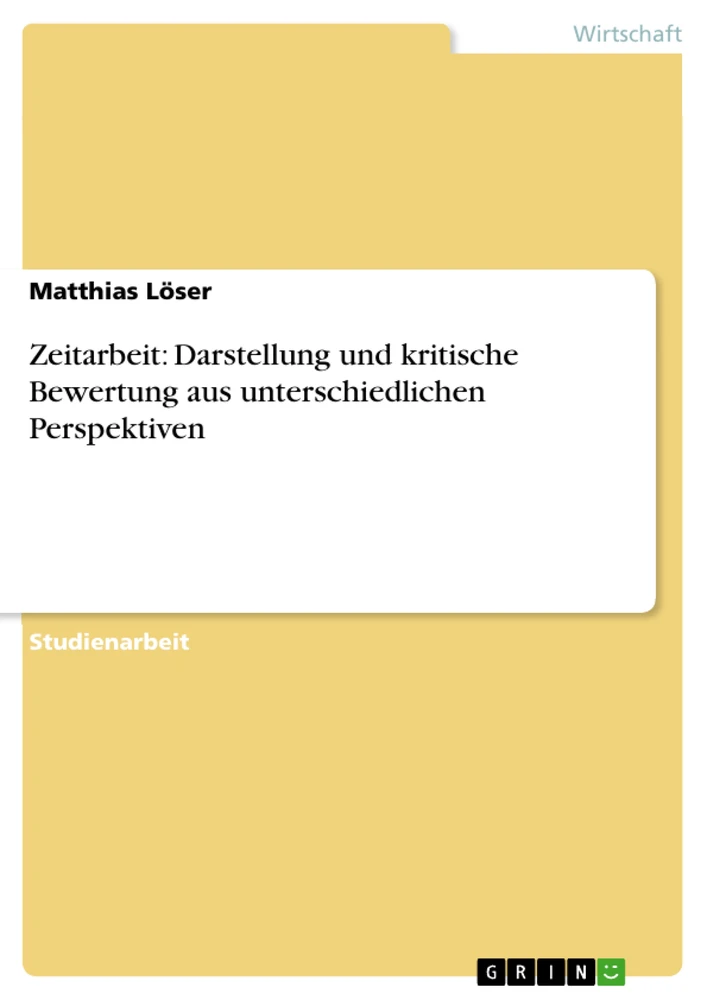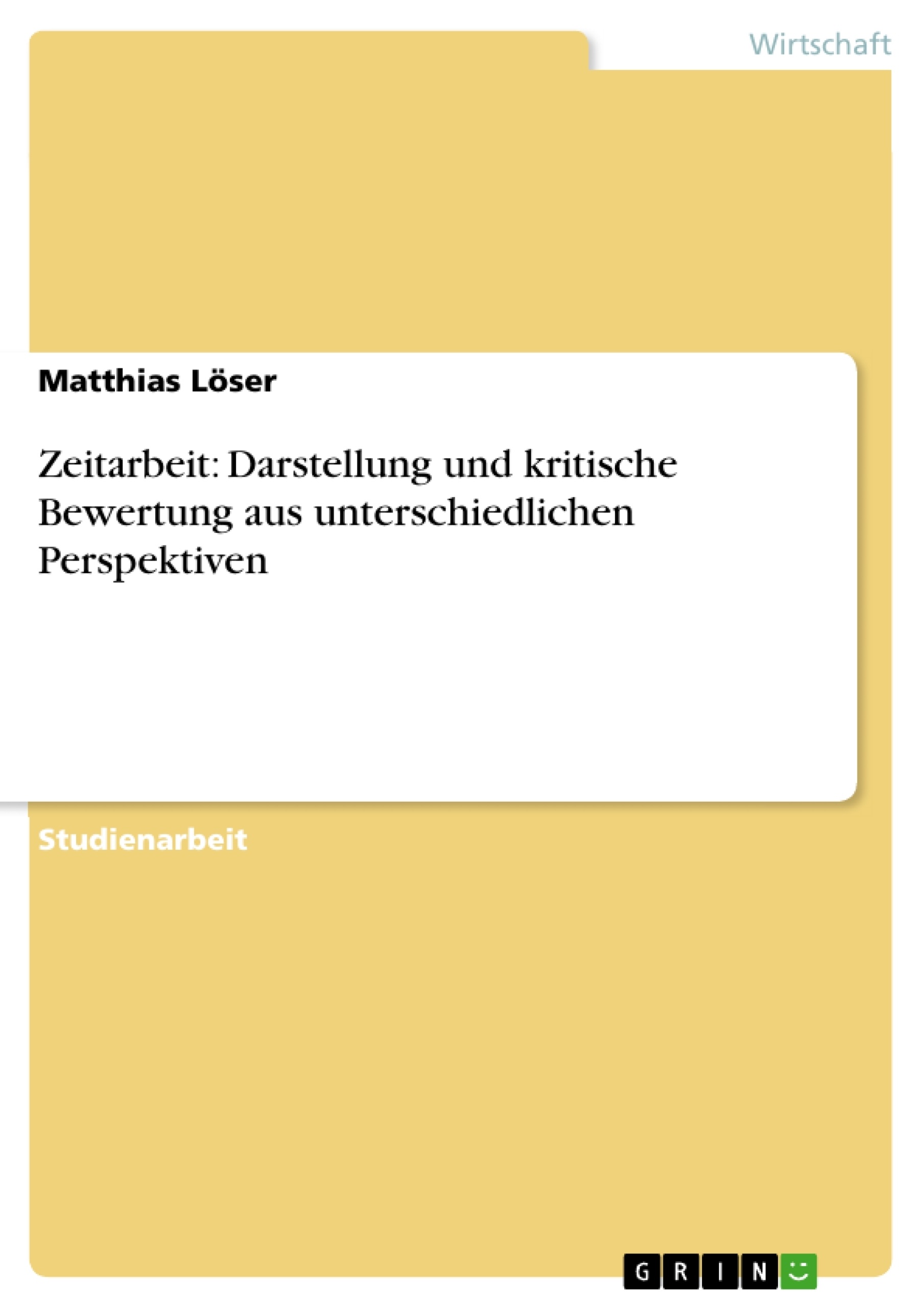Ziel der Arbeit ist zunächst eine Erläuterung der Zeitarbeit mit anschließender Betrachtung aus Sicht der in der Praxis Beteiligten. Ebenfalls soll eine Würdigung aus der Perspektive der Gesamtgesellschaft erfolgen. Dabei soll insbesondere auf die Beweggründe der Beteiligten für den Einsatz von Zeitarbeit aber auch auf Nachteile im Rahmen des Zeitarbeitsverhältnisses eingegangen werden. Die Darstellung der Auffassung des Verfassers erfolgt im Rahmen der Abhandlung der einzelnen Bearbeitungskomplexe und insbesondere im Abschnitt zur gesamtgesellschaftlichen Betrachtung.
Zunächst erfolgt eine überblicksmäßige Darstellung zur aktuellen Situation der Zeitarbeit. Anschließend findet eine Begriffsdefinition, eine Abgrenzung zu anderen Vertragsgestaltungen und Personaldienstleistungen sowie eine Erläuterung der rechtlichen Grundlagen statt. Darauf folgend wird auf die Dreiecksbeziehung zwischen den Vertragsparteien näher eingegangen. Den Hauptteil der Arbeit bildet die Darstellung der Vor-und Nachteile des Zeitarbeitsverhältnisses aus Sicht des Entleihunternehmens, des Zeitarbeitnehmers und der Gesamtgesellschaft. Gerade in Bezug auf die in der öffentlichen Auseinandersetzung häufig kontrovers und z.T. ideologisiert geführte Diskussion über Zeitarbeit kann der Hauptteil der Arbeit dazu beitragen die Debatte wieder auf eine sachliche Grundlage zurückzuführen. Zum Abschluss erfolgt eine zusammenfassende Würdigung sowie ein Ausblick zur zukünftigen Entwicklung der Zeitarbeit als Instrument in der Personalwirtschaft.
Im Rahmen der Arbeit wird vorwiegend auf die Zeitarbeit in Deutschland eingegangen. Eine europaweite bzw. globale Abhandlung ist angesichts unterschiedlichster rechtlicher Rahmenbedingungen und regionalspezifischer Eigenheiten nicht möglich und würde umfangmäßig den Rahmen für eine eigenständige Arbeit auf diesem Gebiet bieten. Eine detaillierte Analyse der psychologischen Auswirkungen beim Zeitarbeitnehmer und eine umfassende soziologische Gesamtbetrachtung sind ebenfalls nicht Gegenstand der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlegung
- 1.1 Einführung
- 1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
- 2 Zeitarbeit in Deutschland
- 3 Grundlagen zur Zeitarbeit
- 3.1 Definition und Begriffsabgrenzung
- 3.2 Konstellation des Zeitarbeitsverhältnisses
- 4 Zeitarbeit aus Sicht aller Beteiligten
- 4.1 Entleiherperspektive
- 4.1.1 Vorteile des Entleihers
- 4.1.2 Nachteile des Entleihers
- 4.2 Zeitarbeitnehmerperspektive
- 4.2.1 Vorteile des Zeitarbeitnehmers
- 4.2.2 Nachteile des Zeitarbeitnehmers
- 4.3 Gesellschaftliche Betrachtung
- 4.3.1 Gewerkschaftsperspektive
- 4.3.2 Equal Treatment und Equal Pay
- 4.3.3 Gesamtgesellschaftsperspektive
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Phänomen der Zeitarbeit und bietet eine umfassende Darstellung und kritische Bewertung aus unterschiedlichen Perspektiven. Ziel ist es, die Funktionsweise, Vor- und Nachteile sowie gesellschaftliche Implikationen der Zeitarbeit zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung der Zeitarbeit
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Zeitarbeit
- Perspektiven der beteiligten Akteure (Entleiher, Zeitarbeitnehmer)
- Gesellschaftliche Auswirkungen und Diskussionen
- Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dient der grundlegenden Einführung in das Thema Zeitarbeit. Es wird die Relevanz der Zeitarbeit im Kontext eines sich wandelnden Arbeitsmarktes erläutert. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung und den aktuellen Stand der Zeitarbeit in Deutschland. Das dritte Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen der Zeitarbeit und definiert die wichtigsten Begriffe. In Kapitel 4 werden die Perspektiven der beteiligten Akteure, sowohl des Entleihers als auch des Zeitarbeitnehmers, sowie die gesellschaftlichen Auswirkungen der Zeitarbeit untersucht.
Schlüsselwörter
Zeitarbeit, Entleiher, Zeitarbeitnehmer, Arbeitnehmerüberlassung, Arbeitsmarkt, Flexibilität, Kosten, Qualifikation, Gesellschaftliche Auswirkungen, Gewerkschaftsperspektive, Equal Treatment, Equal Pay.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernmerkmal der Zeitarbeit?
Das Kernmerkmal ist die Dreiecksbeziehung: Der Zeitarbeitnehmer ist bei einem Verleiher angestellt, erbringt seine Arbeitsleistung aber bei einem Entleiherunternehmen.
Welche Vorteile bietet Zeitarbeit für Unternehmen?
Unternehmen gewinnen an Flexibilität bei Auftragsspitzen, sparen Rekrutierungskosten und können Personalbedarf kurzfristig decken.
Was bedeuten „Equal Treatment“ und „Equal Pay“?
Diese Grundsätze besagen, dass Zeitarbeitnehmer für die gleiche Arbeit grundsätzlich die gleiche Vergütung und die gleichen Arbeitsbedingungen erhalten sollten wie die Stammbelegschaft.
Welche Nachteile können für Zeitarbeitnehmer entstehen?
Nachteile können eine geringere soziale Integration im Entleihbetrieb, häufige Arbeitsplatzwechsel und teilweise niedrigere Löhne trotz Equal-Pay-Regelungen sein.
Wie wird Zeitarbeit gesellschaftlich bewertet?
Die Diskussion ist oft ideologisiert; Befürworter sehen sie als Brücke in den Arbeitsmarkt, Kritiker befürchten eine Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse.
- Quote paper
- Matthias Löser (Author), 2009, Zeitarbeit: Darstellung und kritische Bewertung aus unterschiedlichen Perspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186573