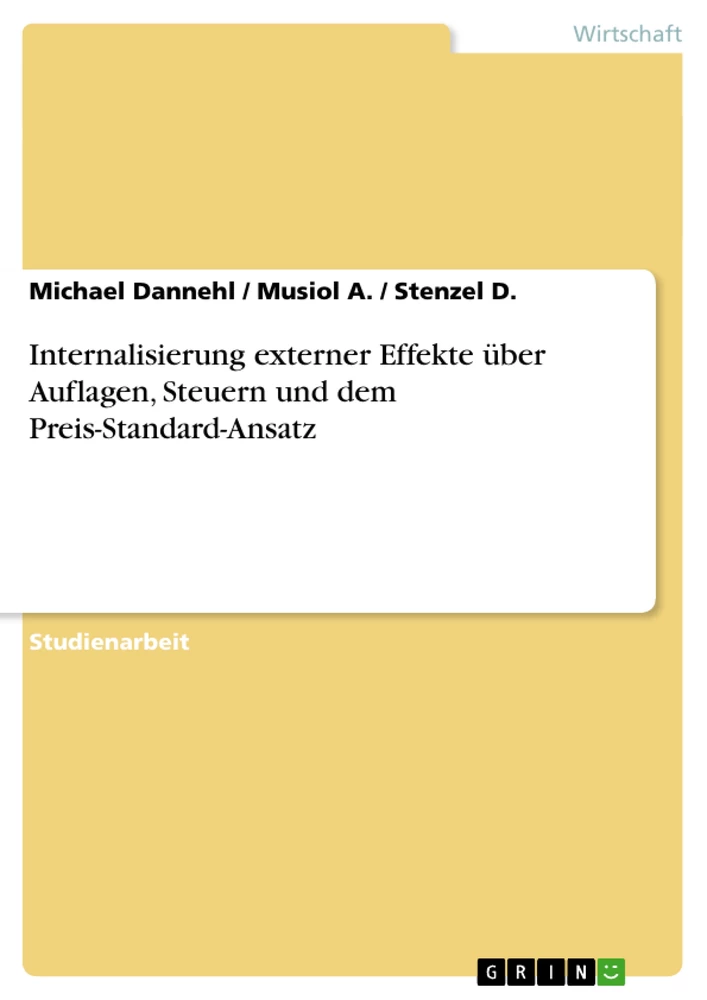Inhalt des Textes ist es, einen genaueren Blick auf die Gründe und Auswirkungen externer Effekte zu werfen, um damit die Nötigkeit ihrer Internalisierung zu begründen, deren Wirkungsweise zu beleuchten und zu zeigen, wie man mit diesen Maßnahmen die Wohlfahrt einer Volkswirtschaft maximiert.
Hierzu werden die theoretischen Grundlagen externer Effekte, ihre Ausprägungen und die Wirkungsrichtung an diversen Beispielen - auch visuell - unterlegt, um die Gründe für eine Einbeziehung sozialer Zusatzkosten- bzw. Nutzen plausibel zu machen. Daraufhin werden die einzelnen Internalisierungsmethoden Auflagen, Steuern sowie der Preis-Standard-Ansatz näher inspiziert Auflagen, welche in Form von Ge- und Verboten auch als das „klassische“ umweltpolitische Internalisierungsinstrument bezeichnet werden kann, werden bei allen Produktionsschritten angewandt. Die gesamten Bandbreite des Produktionsprozesses, also Inputs, Prozessen, Emissionen sowie Outputs dienen somit als Basis. Diese Faktoren sind ebenso Grundlage für die Internalisierungsmethoden Steuern und Abgaben. Der Anwendung der „Pigou-Steuer“ als pareto-optimalen Ansatz, steht in der Realität allerdings ein Informationsmangel entgegen.
Der von der Pigou-Steuer abgeleitete Preis-Standard-Ansatz ist eher praktikabel, da er auf dem Ergebnis eines politischen Suchprozesses aufbaut. Am Beispiel wir auch dieser diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Marktversagen
- Definition
- Gründe für Marktversagen
- Externe Effekte / Externalitäten
- Definitionen
- Klassifizierung von externe Effekten
- Technologische externe Effekte
- Pekuniäre externe Effekte
- Psychologische externe Effekte
- Negative und positive externe Effekte
- Negative externe Effekte
- Positive externe Effekte
- Beispiele externer Effekte
- Beispiele positiver externer Effekte
- Beispiele negativer externer Effekte
- Auswirkungen von Externalitäten anhand von Beispielen
- Marktversagen durch negative externe Effekte am Beispiel der Aluminiumproduktion
- Marktversagen durch positive externe Effekte am Beispiel der Computerproduktion
- Marktversagen durch negative externe Effekte am Beispiel des Alkoholkonsums
- Marktversagen durch positive externe Effekte am Beispiel der Bildung
- Internalisierung externer Effekte
- Definitionen
- Internalisierung durch Auflagen und Abgaben/Steuern
- Auflagen von Produktionsverfahren
- Umweltauflagen
- Emissionsauflagen
- Input-Auflagen
- Prozessnormen
- Produktionsauflagen
- Vor- und Nachteile von Umweltauflagen
- Steuern / Abgaben
- Pigou-Steuer
- Arten und Umsetzung von Steuern / Abgaben
- Preis-Standard-Ansatz
- Beschreibung
- Internalisierung negativer externer Effekte durch Subventionen und daraus resultierende Probleme
- Internalisierung negativer externer Effekte durch Abgaben und daraus resultierende Probleme
- Internalisierung positiver externer Effekte durch Subventionen
- Beispiel der praxisrelevanten Abgabenvariante
- Umsetzung in der Praxis
- Auswirkung der Abgabenvariante auf den Konsumpreis
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat befasst sich mit den Gründen und Auswirkungen externer Effekte. Ziel ist es, die Notwendigkeit ihrer Internalisierung zu begründen, deren Wirkungsweise zu beleuchten und zu zeigen, wie man mit diesen Maßnahmen die Wohlfahrt einer Volkswirtschaft maximiert.
- Marktversagen durch externe Effekte
- Klassifizierung und Beispiele externer Effekte
- Internalisierung von externen Effekten durch Auflagen, Steuern und den Preis-Standard-Ansatz
- Bewertung der Internalisierungsmöglichkeiten
- Praxisrelevante Beispiele und Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Referat beginnt mit einer Einführung in das Thema Marktversagen und erläutert die Gründe dafür, insbesondere die Rolle externer Effekte. Anschließend werden externe Effekte definiert und in verschiedene Kategorien klassifiziert, wobei sowohl positive als auch negative Effekte betrachtet werden. Anhand von Beispielen wird demonstriert, wie externe Effekte die Wohlfahrt der Volkswirtschaft beeinflussen können. Der Fokus liegt dabei auf dem Marktversagen durch negative externe Effekte am Beispiel der Aluminiumproduktion, des Alkoholkonsums und auf positive Effekte am Beispiel der Computerproduktion und Bildung.
Im weiteren Verlauf des Referats werden verschiedene Methoden der Internalisierung von externen Effekten beleuchtet, darunter Auflagen, Steuern und der Preis-Standard-Ansatz. Die Vor- und Nachteile von Umweltauflagen werden diskutiert und verschiedene Arten von Steuern und Abgaben vorgestellt. Der Preis-Standard-Ansatz wird als Instrument zur Internalisierung negativer externer Effekte näher betrachtet, wobei die Probleme bei der Internalisierung sowohl durch Subventionen als auch Abgaben beleuchtet werden.
Zum Abschluss des Referats wird ein Resümee gezogen und die Umsetzung der Internalisierungsmaßnahmen in der Praxis betrachtet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Auswirkung der Abgabenvariante auf den Konsumpreis.
Schlüsselwörter
Externe Effekte, Externalitäten, Marktversagen, Internalisierung, Auflagen, Steuern, Pigou-Steuer, Preis-Standard-Ansatz, Wohlfahrt, Volkswirtschaft, Umwelt, Konsumpreis, Subventionen, Abgaben.
Häufig gestellte Fragen
Was sind externe Effekte in einer Volkswirtschaft?
Externe Effekte sind Kosten oder Nutzen, die bei der Produktion oder dem Konsum entstehen und nicht über den Marktpreis abgegolten werden, was zu Marktversagen führt.
Wie funktioniert die Internalisierung durch die Pigou-Steuer?
Die Pigou-Steuer ist ein pareto-optimaler Ansatz, der darauf abzielt, die sozialen Zusatzkosten direkt in den Preis zu integrieren, scheitert in der Praxis jedoch oft an Informationsmangel.
Was ist der Preis-Standard-Ansatz?
Dies ist ein praktikablerer Ansatz, der auf politischen Suchprozessen basiert, um Umweltziele durch Abgaben oder Subventionen zu erreichen.
Warum sind Umweltauflagen ein klassisches Instrument?
Auflagen in Form von Ge- und Verboten greifen direkt in Produktionsprozesse, Emissionen oder Inputs ein, um negative externe Effekte zu begrenzen.
Welche Beispiele für positive externe Effekte werden genannt?
Beispiele sind die Computerproduktion oder Bildung, bei denen der gesellschaftliche Nutzen höher ist als der private Ertrag.
- Arbeit zitieren
- Michael Dannehl (Autor:in), Musiol A. (Autor:in), Stenzel D. (Autor:in), 2003, Internalisierung externer Effekte über Auflagen, Steuern und dem Preis-Standard-Ansatz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18661