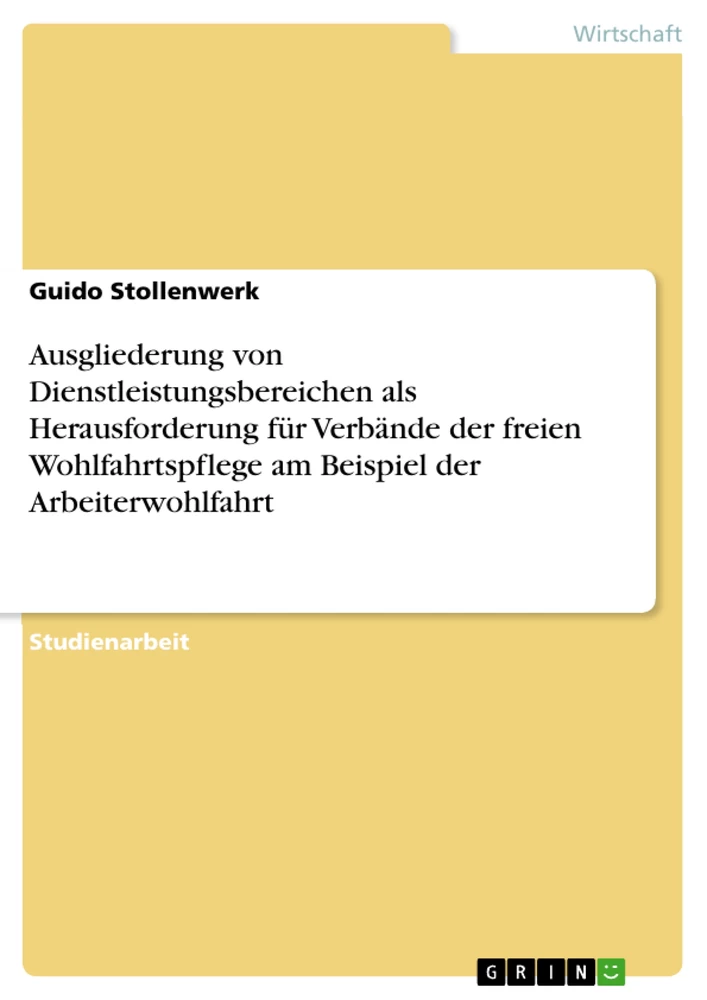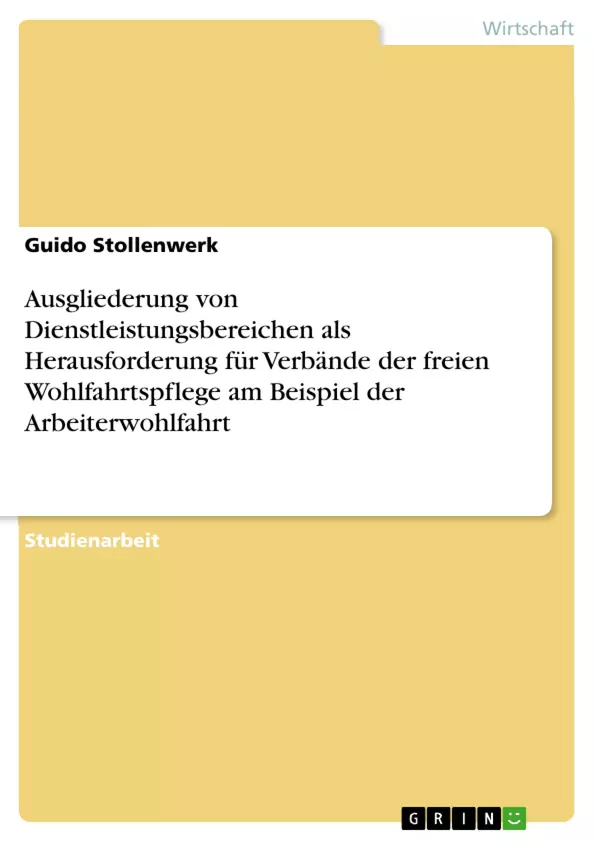In allen Wohlfahrtsverbänden wird derzeit die Diskussion um Reformen der Verbandsstrukturen geführt. Hintergrund dieser Diskussionen sind veränderte sozialstaatliche Rahmenbedingungen, die eine Neupositionierung der Wohlfahrtsverbände hinsichtlich ihrer gesellschaftspolitischen Funktion als Non-Government-Organisationen und ihrer Rolle im Markt der Sozialwirtschaft notwendig machen.
Häufig sind gravierende Managementfehler die Ursache für Krisen von Wohlfahrtsorganisationen. Ehrenamtliche Vorstände, die bislang die Verantwortung in den Verbänden für das Management trugen und auch noch tragen, sind häufig überfordert mit der Verantwortung für millionenschwere Haushalte. Alleine die üblicherweise langen Intervalle zwischen und die zeitliche Dauer von Vorstandsitzungen geben Anlass zu bezweifeln, dass Managemententscheidungen in der gebotenen Geschwindigkeit und mit der erforderlichen Gründlichkeit getroffen werden können.
So unterschiedlich die Diskussionen um geeignetere Verbandsstrukturen auch geführt werden, so gibt es doch einen roten Faden, der sich durch fast alle Verbandsdiskussionen zieht: Die Entflechtung von Mitgliederverband und den Dienstleistungsunternehmen wird in allen Verbänden als eine mögliche Lösung propagiert.
Entflechtung in diesem Sinne heißt Ausgliederung der Dienstleistungsbetriebe in eigenständige GmbHs oder auf andere Rechtsträger. Auf diese Art und Weise geht die unternehmenspolitische Verantwortung auf die Geschäftsführung der GmbH(s) über. Die verbandspolitische Verantwortung bleibt beim Vorstand des e.V. Dieser Weg wird seit Jahren von den Verbänden beschritten, lange auch schon vor dem Beginn der Reformdiskussion. Die gewünschten Effekte stellten sich manchmal ein, häufig blieben sie allerdings auch aus. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, welche Rahmenbedingungen für Ausgliederungen in GmbHs eher Erfolg versprechen und welche als Lösung für die aktuellen Herausforderungen nicht geeignet scheinen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Gründe für Ausgliederungen
- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Rechtsformen
- 3 Risiken bei der Ausgliederung
- 3.1 Verlust der Gemeinnützigkeit des e.V.
- 3.2 Ideologische Entfernung vom „Mutterverband“
- 4 Rechtliche Aspekte
- 4.1 Allgemeinrechtliche Aspekte
- 4.2 Steuerrechtliche Aspekte
- 5 Organisation der Ausgliederung in der AWO am Beispiel der GmbH
- 5.1 Sparten GmbHs
- 5.2 „Konzern“ GmbH
- 5.3 Management Service GmbH
- 5.4 Größenordnungen der GmbHs
- 5.5 Sicherung der Werteorientierung durch AWO-Tandem-QM
- 5.6 Gemeinsames Handeln der unterschiedlichen Verbandsebenen
- 5.7 Größe der GmbH versus kommunalpolitische Verankerung
- 5.8 Eigenverantwortliche / professionelle Führung der GmbHs
- 5.9 Besetzung des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ausgliederung von Dienstleistungsbereichen in Wohlfahrtsverbänden, insbesondere in der Arbeiterwohlfahrt (AWO), als Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen und die Herausforderungen der Ökonomisierung sozialer Arbeit. Sie analysiert die Gründe für Ausgliederungen, mögliche Rechtsformen, Risiken und rechtliche Aspekte. Der Fokus liegt auf der Organisationsentwicklung und der strategischen Unternehmensführung im Kontext dieser Prozesse.
- Gründe für die Ausgliederung von Dienstleistungsbereichen
- Mögliche Rechtsformen und deren Vor- und Nachteile
- Risiken im Zusammenhang mit Ausgliederungen (z.B. Verlust der Gemeinnützigkeit)
- Rechtliche Rahmenbedingungen (allgemein- und steuerrechtliche Aspekte)
- Organisationsformen und -strukturen in der AWO nach Ausgliederung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext der Reformdiskussionen in Wohlfahrtsverbänden. Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Gründe für Ausgliederungen, darunter die Öffnung des Marktes für soziale Dienstleistungen, die persönliche Haftung von Vorstandsmitgliedern und die Möglichkeit, aus bestehenden Tarifsystemen auszusteigen. Kapitel 3 befasst sich mit potenziellen Risiken wie dem Verlust der Gemeinnützigkeit und der ideologischen Distanz zum Mutterverband. Kapitel 4 behandelt allgemein- und steuerrechtliche Aspekte, die bei Ausgliederungen berücksichtigt werden müssen. Kapitel 5 analysiert verschiedene Organisationsmodelle von Ausgliederungen in GmbHs innerhalb der AWO, einschließlich Grösse, Werteorientierung und Gremienbesetzung.
Schlüsselwörter
Ausgliederung, Dienstleistungsbereiche, Wohlfahrtsverbände, Arbeiterwohlfahrt (AWO), GmbH, Gemeinnützigkeit, Rechtsformen, Haftungsrisiko, Organisationsentwicklung, Unternehmensführung, Tarifverträge, Ökonomisierung sozialer Arbeit, Reformdiskussionen.
Häufig gestellte Fragen
Warum gliedern Wohlfahrtsverbände wie die AWO ihre Dienstleistungsbereiche aus?
Gründe sind veränderte sozialstaatliche Rahmenbedingungen, die Notwendigkeit professionellerer Managementstrukturen, Haftungsrisiken für ehrenamtliche Vorstände und der Wettbewerbsdruck in der Sozialwirtschaft.
Welche Rechtsform wird bei Ausgliederungen bevorzugt?
Häufig werden Dienstleistungsbetriebe in eigenständige GmbHs überführt, um die unternehmenspolitische Verantwortung vom ideellen Mitgliederverband (e.V.) zu trennen.
Was sind die größten Risiken einer Ausgliederung?
Zu den Risiken zählen der mögliche Verlust der Gemeinnützigkeit des Mutterverbandes sowie eine ideologische Entfremdung zwischen dem Dienstleistungsunternehmen und dem Verband.
Wie sichert die AWO ihre Werte nach einer Ausgliederung?
Die AWO nutzt Instrumente wie das „AWO-Tandem-QM“, um die Werteorientierung auch in den ausgegliederten GmbH-Strukturen aufrechtzuerhalten.
Welche Rolle spielt das Management in der Reformdiskussion?
Die Arbeit zeigt, dass professionelle Geschäftsführungen notwendig sind, da ehrenamtliche Vorstände oft mit der Verwaltung millionenschwerer Haushalte überfordert sind.
- Quote paper
- Guido Stollenwerk (Author), 2006, Ausgliederung von Dienstleistungsbereichen als Herausforderung für Verbände der freien Wohlfahrtspflege am Beispiel der Arbeiterwohlfahrt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186756