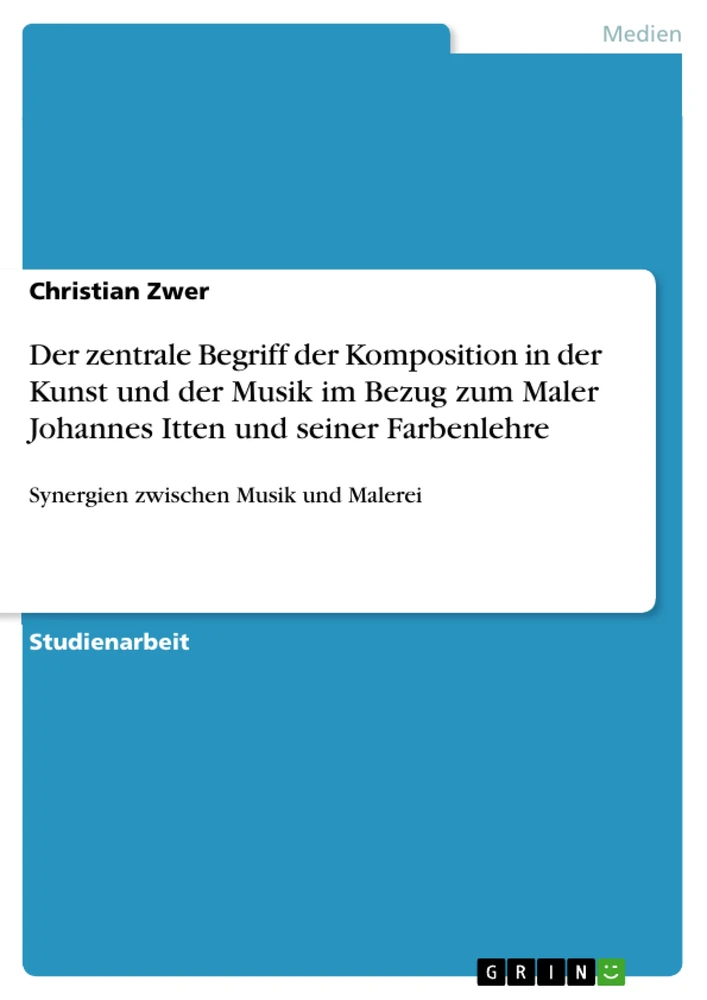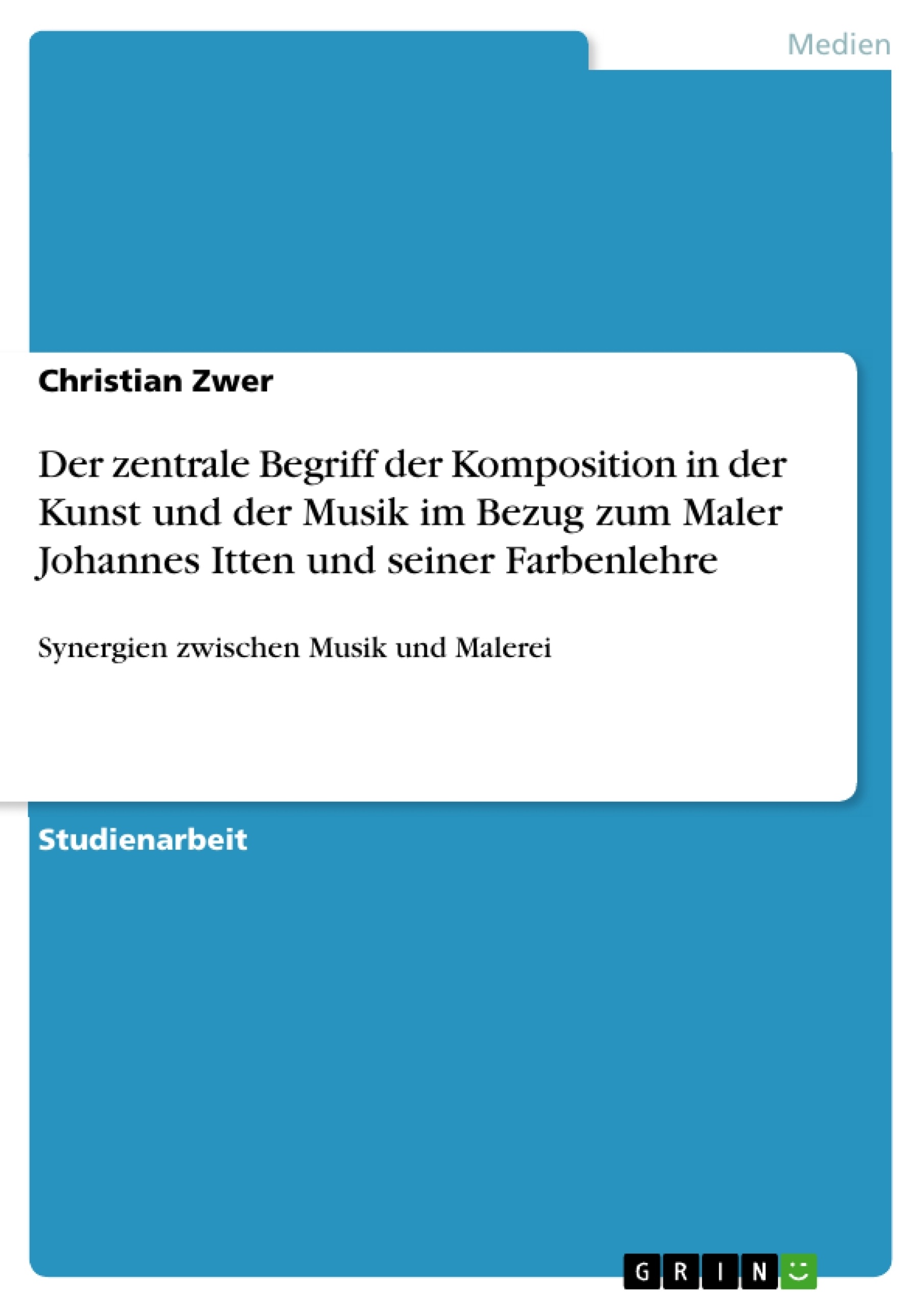Die Hausarbeit soll am Beispiel von Johannes Itten die enge Verwandtschaft zwischen der Malerei und der Musik zeigen.
Ähnlichkeiten beim Gebrauch der Fachtermini und den Vorgehensweisen im Schaffensprozess eines Werkes sind sehr faszinierend und verweisen auf Potenzen der Künste Musik und Malerei, die in ihrem Zusammenspiel zu Synergieeffekten führen können.
Die Arbeit schließt an einen Vortrag an und versucht sich den Synergien und Übereinstimmungen aus der Perspektive des Künstlers zu nähern. Dies geschieht beispielhaft an Hand der Person Johannes Ittens. Eine Gegenperspektive wurde von meinem Kommilitonen durch eine Hausarbeit über Josef Matthias Hauer geschaffen.
Die Arbeit bezieht sich in weiten Teilen auf Johannes Ittens Hauptwerk ?Die Kunst der Farbe?. Dem Begriff der Komposition wird dabei eine wesentliche Rolle zuteil.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der Komposition in der Malerei und Musik
- Johannes Itten: Der Weg zur Malerei
- Die Farbenlehre von Johannes Itten
- Grundlagen, Einflüsse, Entwicklungsphasen
- Vorstellung und Deutung der Farbenlehre
- Auswirkungen der Farbenlehre auf die Bildkomposition Iittens und deren Bezüge zur Musik
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die enge Verbindung zwischen Malerei und Musik am Beispiel des Malers Johannes Itten und seiner Farbenlehre. Das zentrale Thema ist der Begriff der Komposition und dessen Bedeutung für den Schaffensprozess in beiden Kunstformen.
- Der Begriff der Komposition in der Malerei und Musik
- Johannes Ittens Weg zur Malerei
- Die Farbenlehre von Johannes Itten und ihre Auswirkungen auf die Bildkomposition
- Parallelen zwischen Ittens Bildkomposition und Kompositionsprinzipien in der Musik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung nach der Verbindung von Malerei und Musik im Werk von Johannes Itten vor.
- Der Begriff der Komposition in der Malerei und Musik: Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung des Begriffs „Komposition“ sowohl in der Malerei als auch in der Musik. Dabei wird die etymologische Entwicklung des Wortes und seine Bedeutung im Kontext des künstlerischen Schaffens beleuchtet.
- Johannes Itten: Der Weg zur Malerei: Dieser Abschnitt stellt Johannes Itten als Person und Künstler vor und beleuchtet seinen Werdegang in Bezug auf seine künstlerische Entwicklung und die Entstehung seiner Theorien zur Farbenlehre.
- Die Farbenlehre von Johannes Itten: Dieser Abschnitt widmet sich der detaillierten Vorstellung und Deutung von Johannes Ittens Farbenlehre. Dabei werden die Grundlagen, Einflüsse, Entwicklungsphasen und die Auswirkungen der Farbenlehre auf die Bildkomposition Iittens beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Komposition, Malerei, Musik, Johannes Itten, Farbenlehre, Bildkomposition, und Synergieeffekte. Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen diesen Begriffen im Kontext der künstlerischen Praxis von Johannes Itten und stellt Verbindungen zu Kompositionsprinzipien in der Musik her.
Häufig gestellte Fragen
Welche Verbindung besteht zwischen Johannes Itten und der Musik?
Die Arbeit zeigt auf, dass es enge Verwandtschaften zwischen Malerei und Musik gibt, insbesondere bei Fachtermini und im Schaffensprozess. Itten nutzte Kompositionsprinzipien, die Parallelen zur Musik aufweisen.
Was ist der zentrale Begriff dieser Untersuchung?
Der zentrale Begriff ist die "Komposition". Er wird sowohl in der Kunst als auch in der Musik als strukturgebendes Element des Werkes analysiert.
Welches Hauptwerk von Johannes Itten wird herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich maßgeblich auf Ittens Hauptwerk "Die Kunst der Farbe", in dem er seine einflussreiche Farbenlehre darlegt.
Wie beeinflusst Ittens Farbenlehre die Bildkomposition?
Ittens Lehre definiert Kontraste und Harmonien, die wie Töne in einer musikalischen Komposition eingesetzt werden, um eine bestimmte Wirkung und Struktur im Bild zu erzeugen.
Wer wird als Gegenperspektive zu Itten in der Arbeit erwähnt?
In einem verwandten Kontext wird Josef Matthias Hauer genannt, um Synergien und Übereinstimmungen zwischen den Künsten aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
- Quote paper
- Christian Zwer (Author), 2010, Der zentrale Begriff der Komposition in der Kunst und der Musik im Bezug zum Maler Johannes Itten und seiner Farbenlehre , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186831