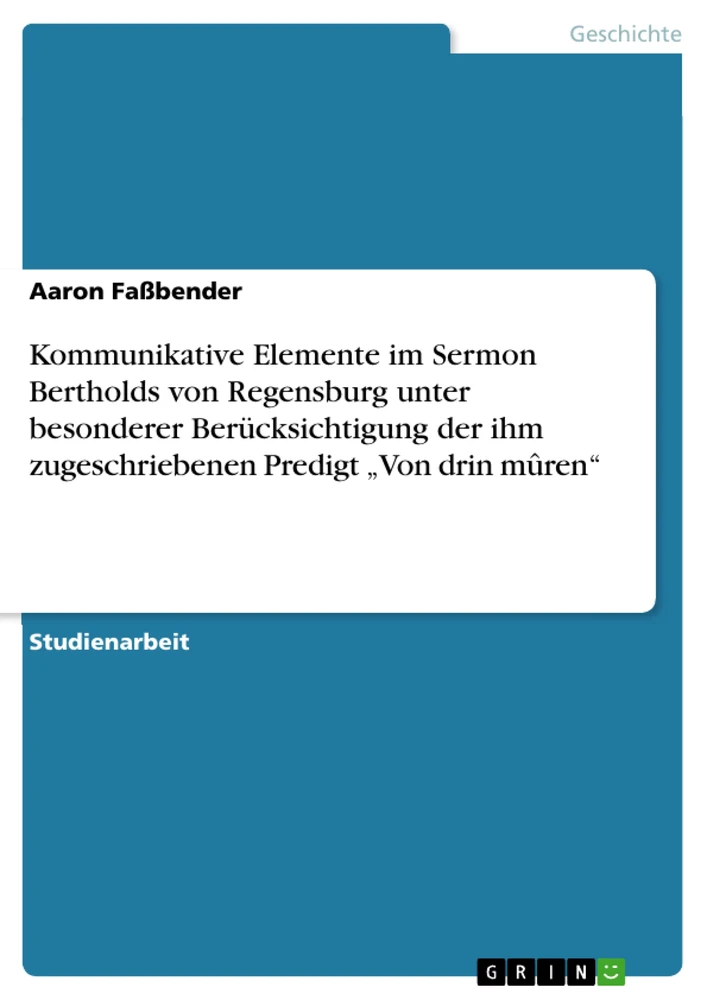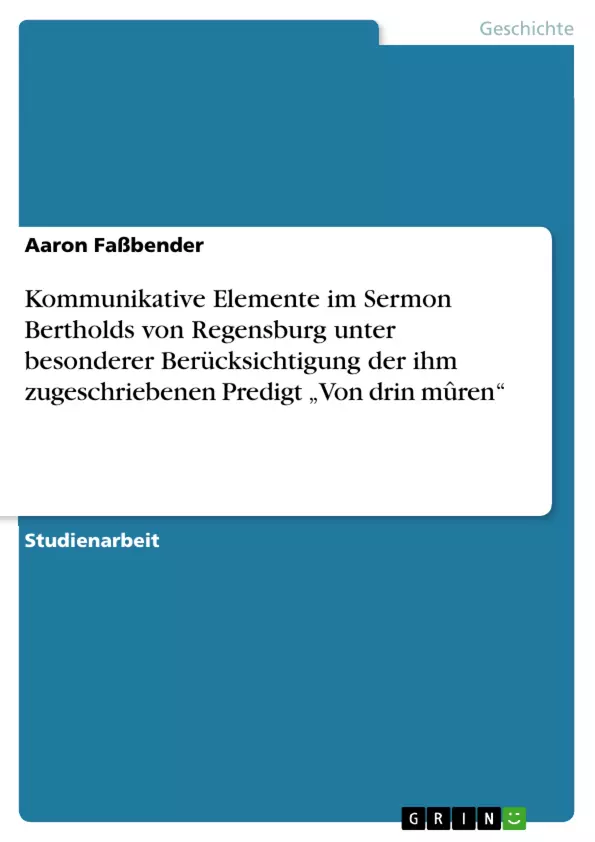Rudolf Cruel beschrieb 1879 Berthold von Regensburg als einen Elias seiner Zeit, dessen Wort wie ein scharfes Schwert und eine brennende Fackel gewesen sei. Dieses, auf der unkritischen Übernahme zeitgenössischer Darstellungen basierende, Bild des Wanderpredigers entspricht dem romantisierten Verständnis des Mit-telalters während des 19. Jahrhunderts. Erst durch die Studien Anton E. Schönbachs wurde die Person Bertholds „entzaubert“. Schönbachs objektive Untersuchungen stellten unter anderem heraus, dass es sich bei den überlieferten Schriften keineswegs um Mitschriften des Sermons handeln konnte. In der Folge ließ das Interesse an der Person Bertholds deutlich nach, obwohl die eigentliche wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem bedeutenden Wanderprediger gerade erst begonnen hatte.
Versucht man die Ursachen für den enormen Zulauf des Predigers zu analysieren, genügt es nicht, sein literarisches Erbe zu betrachten. Vielmehr müssen auch äußere Faktoren, wie auch rhetorische und kommunikative Elemente hinterfragt werden. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich daher auf die Funktion Bertholds als mittelalterlichen Kommunikationsträger. Andere Aspekte, wie eine zum Beispiel die inhaltliche Analyse oder die Biographie Bertholds werden hingegen unbeachtet ge-lassen bleiben – ohne den grundsätzlichen Stellenwert dieser Erkenntnisse in der historischen Beurteilung Bertholds in Frage zu stellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenlage
- Die Überlieferung der Person Bertholds von Regensburg
- Die Überlieferung der Berthold zugeschriebenen, deutschsprachigen Predigten
- Die Funktion Bertholds von Regensburg als Volksprediger
- Die Wirkung der Predigten Bertholds
- Betrachtungen zu Bertholds Sermon am Beispiel „Von drin mûren“
- Inhalt der Predigt „Von drin mûren“
- enumeratio und repetitio als bestimmende Gliederungsfaktoren
- Stilistische Merkmale
- Das dialogische Prinzip in Bertholds Predigt
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion Bertholds von Regensburg als mittelalterlicher Kommunikationsträger, indem sie die kommunikativen Elemente in seinen Predigten, insbesondere in der Predigt „Von drin mûren“, analysiert. Die biographischen Aspekte und die rein inhaltliche Analyse der Predigten bleiben dabei außer Betracht.
- Die Quellenlage und die Authentizität der Berthold zugeschriebenen Predigten
- Die Wirkung und Popularität der Predigten Bertholds
- Rhetorische und kommunikative Strategien in Bertholds Predigten
- Die Struktur und Stilistik der Predigt „Von drin mûren“
- Das dialogische Prinzip in Bertholds Predigt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Figur Bertholds von Regensburg, von der romantisierten Darstellung des 19. Jahrhunderts bis hin zu den objektiveren Studien Schönbachs, die die Authentizität der überlieferten Predigten in Frage stellten. Die Arbeit konzentriert sich auf die kommunikativen Aspekte von Bertholds Wirken als Prediger, wobei andere Aspekte wie die inhaltliche Analyse oder seine Biographie ausgeklammert werden.
Quellenlage: Dieses Kapitel befasst sich mit der Überlieferung der Person Bertholds und seiner Predigten. Die biographischen Informationen über Berthold sind lückenhaft und enthalten viele Übertreibungen und Legenden, die seine Wirkung als Prediger hervorheben sollten. Die deutschen Predigten, die Berthold zugeschrieben werden, sind nicht authentisch und stammen von einem Kreis Augsburger Franziskaner. Die Datierung dieser Predigten ist umstritten, wobei verschiedene Meinungen bezüglich der Entstehungszeit existieren.
Die Funktion Bertholds von Regensburg als Volksprediger: Dieses Kapitel analysiert die Wirkung der Predigten Bertholds und untersucht am Beispiel der Predigt „Von drin mûren“ deren kommunikative Elemente. Es werden die Gliederungsfaktoren, stilistische Merkmale und das dialogische Prinzip in Bertholds Predigtmethode untersucht. Die Kapitel behandeln äußere Faktoren, die zu dem großen Zulauf zu seinen Predigten beigetragen haben könnten, sowie rhetorische und kommunikative Mittel.
Schlüsselwörter
Berthold von Regensburg, Volksprediger, Mittelalter, Predigt, „Von drin mûren“, Kommunikation, Rhetorik, Quellenkritik, Authentizität, Kommunikative Elemente, Stilistik, Dialogizität.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über Berthold von Regensburg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Funktion Bertholds von Regensburg als mittelalterlicher Kommunikationsträger. Der Fokus liegt auf der Analyse der kommunikativen Elemente in seinen Predigten, insbesondere der Predigt „Von drin mûren“. Biografische Aspekte und die rein inhaltliche Analyse der Predigten werden hingegen ausgeklammert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Quellenlage und Authentizität der Berthold zugeschriebenen Predigten, die Wirkung und Popularität seiner Predigten, rhetorische und kommunikative Strategien in seinen Predigten, die Struktur und Stilistik der Predigt „Von drin mûren“, sowie das dialogische Prinzip in Bertholds Predigt.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit befasst sich mit der Überlieferung der Person Bertholds und seiner Predigten. Dabei wird die Problematik der lückenhaften und legendären Biografien sowie die umstrittene Authentizität der ihm zugeschriebenen deutschen Predigten, die vermutlich von Augsburger Franziskanern stammen, thematisiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Quellenlage, ein Kapitel zur Funktion Bertholds als Volksprediger (mit einer detaillierten Analyse der Predigt „Von drin mûren“), und einen Schluss. Die Einleitung beschreibt unterschiedliche Betrachtungsweisen der Figur Bertholds von Regensburg, von romantisierten Darstellungen bis zu objektiveren Studien.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse der Predigt „Von drin mûren“?
Die Analyse der Predigt „Von drin mûren“ untersucht Gliederungsfaktoren (wie enumeratio und repetitio), stilistische Merkmale und das dialogische Prinzip als kommunikative Elemente. Es werden auch äußere Faktoren betrachtet, die zum großen Zulauf zu seinen Predigten beigetragen haben könnten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf die kommunikativen Aspekte von Bertholds Wirken als Prediger. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Quellenkritik bei der Beurteilung der Authentizität seiner Predigten und analysiert die rhetorischen und kommunikativen Strategien, die zu seiner Wirkung als Volksprediger beitrugen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Berthold von Regensburg, Volksprediger, Mittelalter, Predigt, „Von drin mûren“, Kommunikation, Rhetorik, Quellenkritik, Authentizität, Kommunikative Elemente, Stilistik, Dialogizität.
- Quote paper
- M. A. Aaron Faßbender (Author), 2005, Kommunikative Elemente im Sermon Bertholds von Regensburg unter besonderer Berücksichtigung der ihm zugeschriebenen Predigt „Von drin mûren“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186847