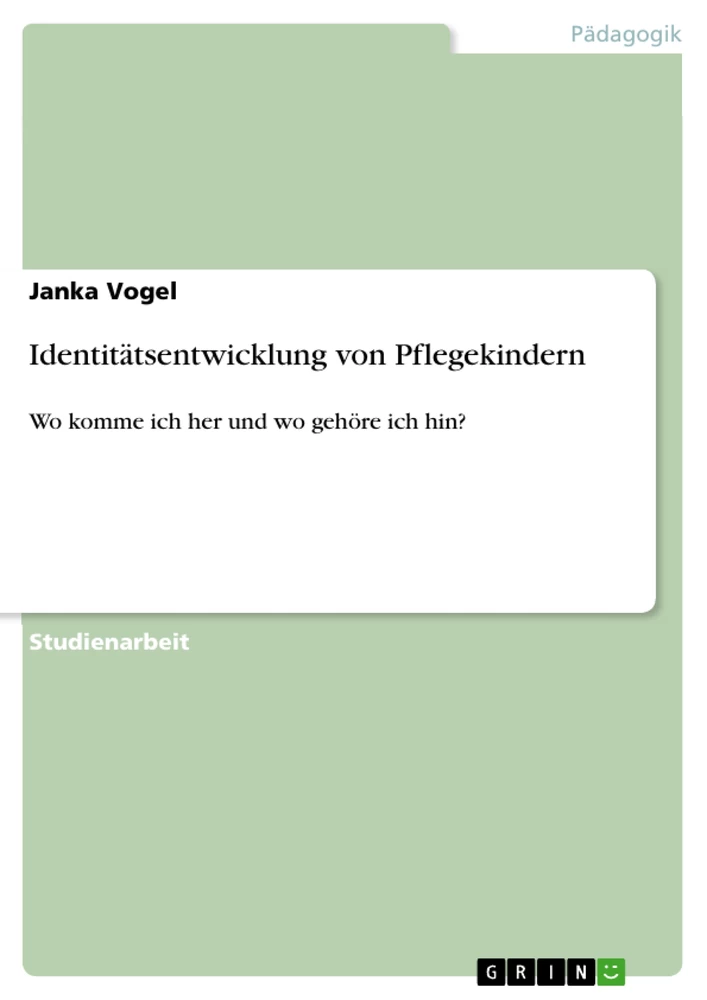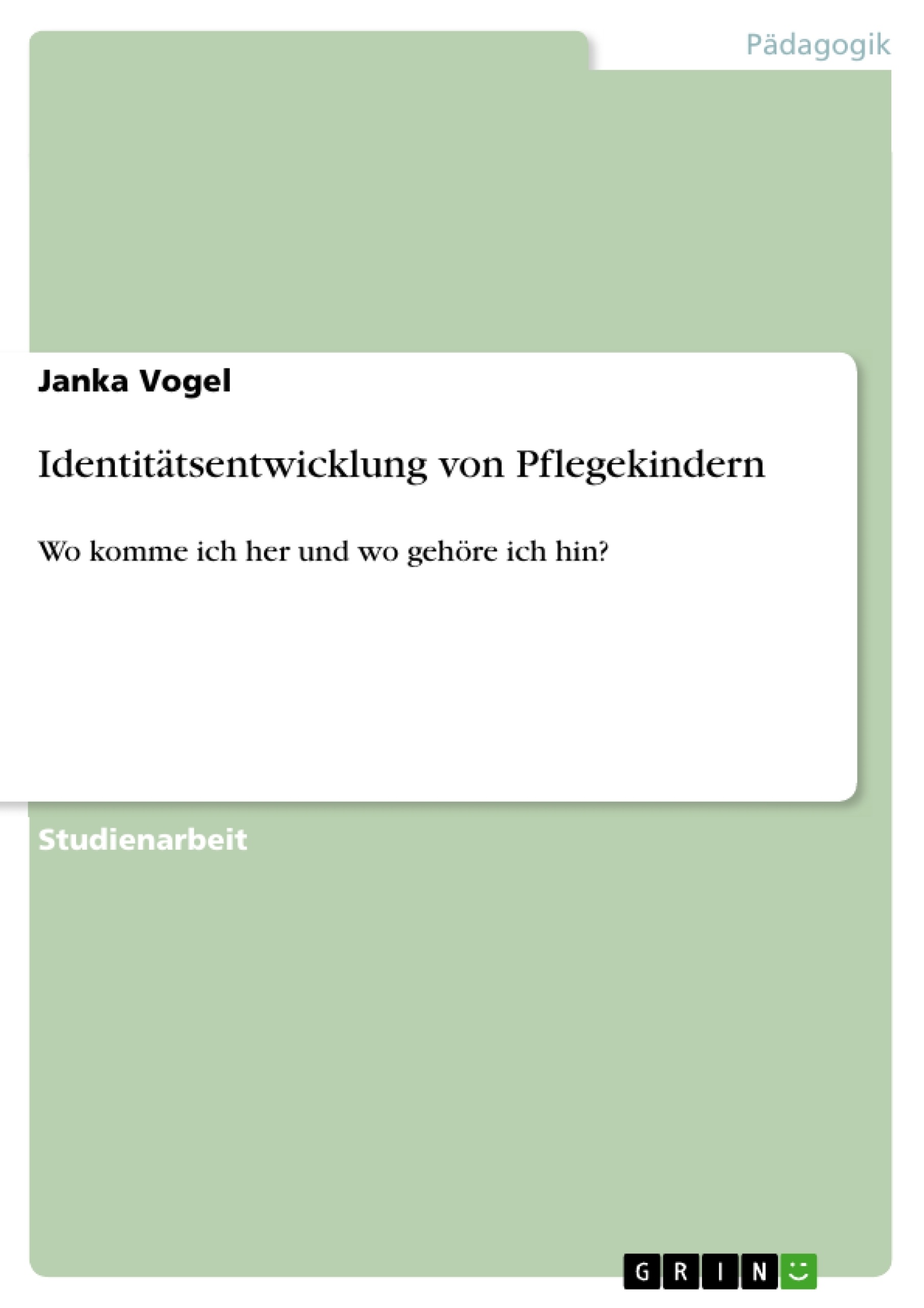Die Suche nach Identität ist ein zutiefst menschlicher Prozess. Wo komme ich her? Wo gehöre ich hin? Diesen Fragen implizit, so die Vermutung an dieser Stelle, ist die Suche nach einem Platz im Leben. Das Bedürfnis nach Sinn drückt sich in der Suche nach Zugehörigkeit aus. Um das Morgen zu wagen, muss der Mensch sein Gestern kennen.
Die Geschichte der Menschheit gibt Zeugnis von dieser Suche nach Identität, die sich auch auf einer höheren Strukturebene in den jeweils individuellen Riten der Völker zeigt. Beispielhaft sei die biblische Urgeschichte, genauer die Schöpfungserzählungen, genannt. Diese Texte sind Zeugnisse für die Identitätssuche des Volkes Israel, welche dahingehend endet, dass sich dieses Volk als von Jahweh erschaffen und berufen versteht.
Im Kontext dieser Arbeit soll die Suche nach Identität im speziellen Fall von Pflegeverhältnissen thematisiert werden. Unter der Maßgabe, dass jedem Menschen diese Suche nach dem Kern seiner Persönlichkeit innewohnt – ja, geradezu ein Grundbedürfnis genannt werden kann – sollen besonders dauerhafte Pflegebeziehungen mit den ihnen eigenen Herausforderungen ernst genommen werden. Die Frage „Wer bin ich?“ wird sich früher oder später jedes/r in Pflege genommene Kind/ Jugendliche stellen. Es wird zu fragen sein, welche Bedingungen günstig und welche Maßnahmen notwendig sind, damit die Möglichkeit eröffnet wird, diese Frage zufriedenstellend zu beantworten.
Jeder Mensch ist (zum Teil auch sich selbst) Geheimnis. Er gehört niemandem. Der eingangs zitierte Poet vermittelt ein Gefühl dafür, mit welch notwendiger Distanz man dem anvertrauten Kind/ Jugendlichen begegnen sollte, bzw. wo die nicht hintergehbaren Grenzen zu seiner Persönlichkeit liegen. In Bezug auf die Problematik eines Pflegeverhältnisses geschieht in den zitierten Ausführungen eine wichtige Sensibilisierung für die Individualität jedes Kindes. Obwohl im Gedicht leibliche Eltern angesprochen scheinen, kann es auch als Apell an Pflege(und Adoptiv-)eltern verstanden werden. Erwachsene, die die Verantwortung für ein Kind/ einen Jugendlichen (übernommen) haben, sind aufgefordert, ihre Macht- und Einflussmöglichkeiten relativiert wahrzunehmen.
Das Vordringen zu seinem Geheimnis – die Suche nach seiner Identität - wird jedem Kind/ Jugendlichen selbst überlassen bleiben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie es zu einem Pflegeverhältnis kommt
- Die sogenannte Herkunftsfamilie
- Elternrecht und Kindeswohl
- Traumatische Vorerfahrungen als Ausgangsbedingung eines Pflegeverhältnisses
- Vorerfahrungen mit Institutionen der Jugendhilfe
- Wie ein Pflegeverhältnis gelingen kann
- Beweggründe der Pflegeeltern
- Das Ersatzfamilienkonzept
- Das Ergänzungsfamilienkonzept
- Pflegefamiliale Konstellationen und Gestaltungsmöglichkeiten
- Tagespflegefamilie
- Dauerpflegefamilie
- Geschwisterbeziehungen in Pflegeverhältnissen
- Wie ein gesunder Identitätsbildungsprozess des Pflegekindes möglich wird
- Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie
- Die Rolle des verwandtschaftlichen Systems
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Identitätsentwicklung von Pflegekindern und beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten eines gelingenden Pflegeverhältnisses. Sie befasst sich mit den Faktoren, die zur Entstehung eines Pflegeverhältnisses beitragen, und analysiert die Bedeutung von Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie sowie die Rolle des verwandtschaftlichen Systems für den Identitätsbildungsprozess des Kindes.
- Die Entstehung von Pflegeverhältnissen und deren Hintergründe
- Die Bedeutung der Herkunftsfamilie und traumatische Vorerfahrungen
- Günstige Bedingungen und notwendige Maßnahmen für einen erfolgreichen Identitätsbildungsprozess
- Verschiedene Pflegefamilienmodelle und deren Auswirkungen
- Die Rolle von Geschwisterbeziehungen in Pflegefamilien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Identitätsfindung ein und beschreibt die zentrale Fragestellung der Arbeit im Kontext von Pflegeverhältnissen. Das Kapitel "Wie es zu einem Pflegeverhältnis kommt" beleuchtet verschiedene Faktoren, die zur Entstehung eines Pflegeverhältnisses beitragen, darunter die Situation der Herkunftsfamilie, rechtliche Aspekte und die Rolle traumatischer Vorerfahrungen. Das Kapitel "Wie ein Pflegeverhältnis gelingen kann" diskutiert verschiedene Modelle der Pflegefamilie und die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie. Das Kapitel über Geschwisterbeziehungen in Pflegeverhältnissen beleuchtet die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten in diesen Konstellationen. Das Kapitel zu einem gesunden Identitätsbildungsprozess skizziert Bedingungen und Maßnahmen, die eine positive Identitätsentwicklung fördern.
Schlüsselwörter
Identitätsentwicklung, Pflegekinder, Pflegefamilie, Herkunftsfamilie, Traumatisierung, Jugendhilfe, Ersatzfamilie, Ergänzungsfamilie, Geschwisterbeziehungen, Identitätsbildungsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Welche zentralen Fragen stellen sich Pflegekinder bei der Identitätssuche?
Pflegekinder stellen sich oft die existenziellen Fragen: „Wo komme ich her?“, „Wo gehöre ich hin?“ und letztlich „Wer bin ich?“, um ihren Platz im Leben zu finden.
Was ist der Unterschied zwischen Ersatzfamilien- und Ergänzungsfamilienkonzept?
Das Ersatzfamilienkonzept sieht die Pflegefamilie als vollständigen Ersatz für die Herkunftsfamilie, während das Ergänzungsfamilienkonzept beide Familiensysteme als wichtig für das Kind anerkennt.
Wie beeinflussen traumatische Vorerfahrungen die Identitätsbildung?
Traumata in der Herkunftsfamilie oder Erfahrungen mit der Jugendhilfe sind oft Ausgangsbedingungen, die den Aufbau von Vertrauen und eines stabilen Selbstbildes erschweren.
Welche Rolle spielt die Herkunftsfamilie in einem Pflegeverhältnis?
Die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie ist oft entscheidend, damit das Kind sein „Gestern“ kennenlernen und integrieren kann, um eine gesunde Identität zu entwickeln.
Was sollten Pflegeeltern bei der Erziehung beachten?
Pflegeeltern sollten dem Kind mit notwendiger Distanz begegnen, seine Individualität respektieren und ihre Macht- und Einflussmöglichkeiten relativiert wahrnehmen.
- Quote paper
- Janka Vogel (Author), 2011, Identitätsentwicklung von Pflegekindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186898