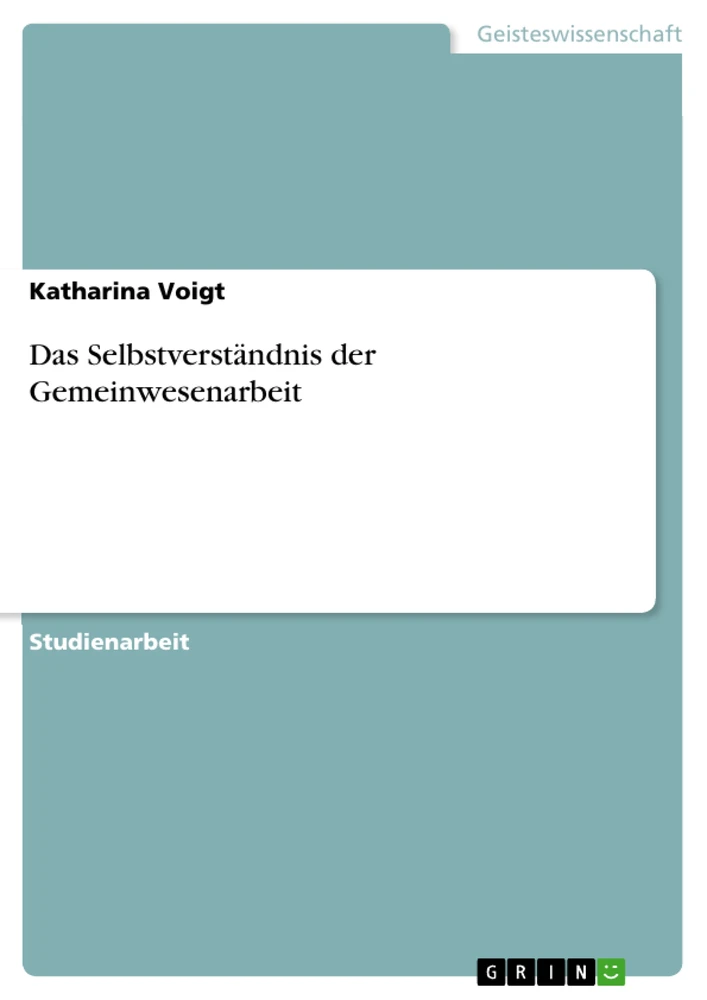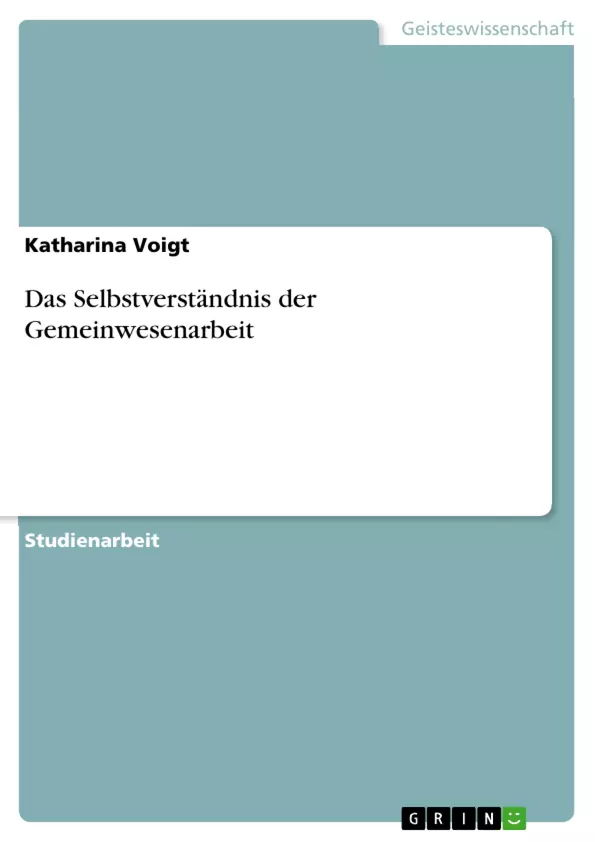In vielen größeren Städten entstehen soziale Brennpunkte. Diese Entwicklung macht vielerorts eine Gemeinwesenarbeit notwendig, gar unverzichtbar. Doch besteht nur selten Klarheit darüber, was sich hinter dem „Wunder GWA“ wirklich verbirgt. Genau hiermit - mit dem Selbstverständnis der Gemeinwesenarbeit - möchte ich mich in dieser Hausarbeit genauer befassen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung Gemeinwesenarbeit
- Definition Gemeinwesenarbeit
- Zentrale Merkmale der Gemeinwesenarbeit nach Oelschlägel
- Das Anliegen der Gemeinwesenarbeit
- Konzepte in der Gemeinwesenarbeit
- Bürger und Gemeinwesenarbeiter
- Ein Beispiel aus der Praxis: Gemeinwesenarbeit im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Selbstverständnis der Gemeinwesenarbeit (GWA) und beleuchtet verschiedene Aspekte dieser wichtigen Methode der Sozialen Arbeit. Ziel ist es, einen Überblick über die Definition, die zentralen Merkmale, das Anliegen und die Konzepte der GWA zu geben. Darüber hinaus wird ein Praxisbeispiel aus Magdeburg vorgestellt.
- Definition der Gemeinwesenarbeit
- Zentrale Merkmale der Gemeinwesenarbeit
- Anliegen und Ziele der Gemeinwesenarbeit
- Konzepte und Ansätze in der Gemeinwesenarbeit
- Rolle von Bürgern und Gemeinwesenarbeitern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Gemeinwesenarbeit ein und erläutert den Fokus der Hausarbeit auf das Selbstverständnis dieser Methode. Im zweiten Kapitel wird eine Definition der Gemeinwesenarbeit erarbeitet, die aus verschiedenen Quellen zusammengetragen und erweitert wird. Zudem werden zentrale Merkmale der GWA nach Oelschlägel dargestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Anliegen der Gemeinwesenarbeit und beleuchtet deren Aufgaben und Ziele. Im vierten Kapitel werden klassische und aktuelle Konzepte der GWA vorgestellt, die sich mit verschiedenen Ansätzen und Besonderheiten auseinandersetzen. Der fünfte Teil beschäftigt sich mit der Abgrenzung zwischen der Rolle von Bürgern und Gemeinwesenarbeitern innerhalb eines Prozesses der Gemeinwesenarbeit.
Das sechste Kapitel präsentiert ein Praxisbeispiel aus Magdeburg, welches die Gemeinwesenarbeit in einem Stadtteil greifbarer macht. Dieses Beispiel basiert auf einem Interview mit der Quartiersmanagerin im vorgestellten Stadtteil.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: Gemeinwesenarbeit, GWA, Definition, Merkmale, Anliegen, Konzepte, Bürgerbeteiligung, Praxisbeispiel, Magdeburg, Stadtteil, Quartiersmanagement, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Gemeinwesenarbeit (GWA)?
GWA ist eine Methode der Sozialen Arbeit, die darauf abzielt, die Lebensbedingungen in einem bestimmten Stadtteil oder Sozialraum gemeinsam mit den Bewohnern zu verbessern.
Was sind die zentralen Merkmale der GWA nach Oelschlägel?
Dazu gehören unter anderem die Stadtteilorientierung, die Bewohneraktivierung, die Ressourcenbündelung und die politische Interessenvertretung.
Welches Praxisbeispiel wird in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit analysiert die Gemeinwesenarbeit im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld, basierend auf einem Interview mit der Quartiersmanagerin.
Was ist das Ziel von Quartiersmanagement?
Es dient der Stabilisierung sozialer Brennpunkte durch Vernetzung der Akteure vor Ort und Förderung bürgerschaftlichen Engagements.
Wie unterscheiden sich Bürger und Gemeinwesenarbeiter?
Während Bürger die Experten ihres Alltags sind, fungieren Gemeinwesenarbeiter als professionelle Begleiter, Moderatoren und Vernetzer im Prozess.
- Quote paper
- Katharina Voigt (Author), 2009, Das Selbstverständnis der Gemeinwesenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187031