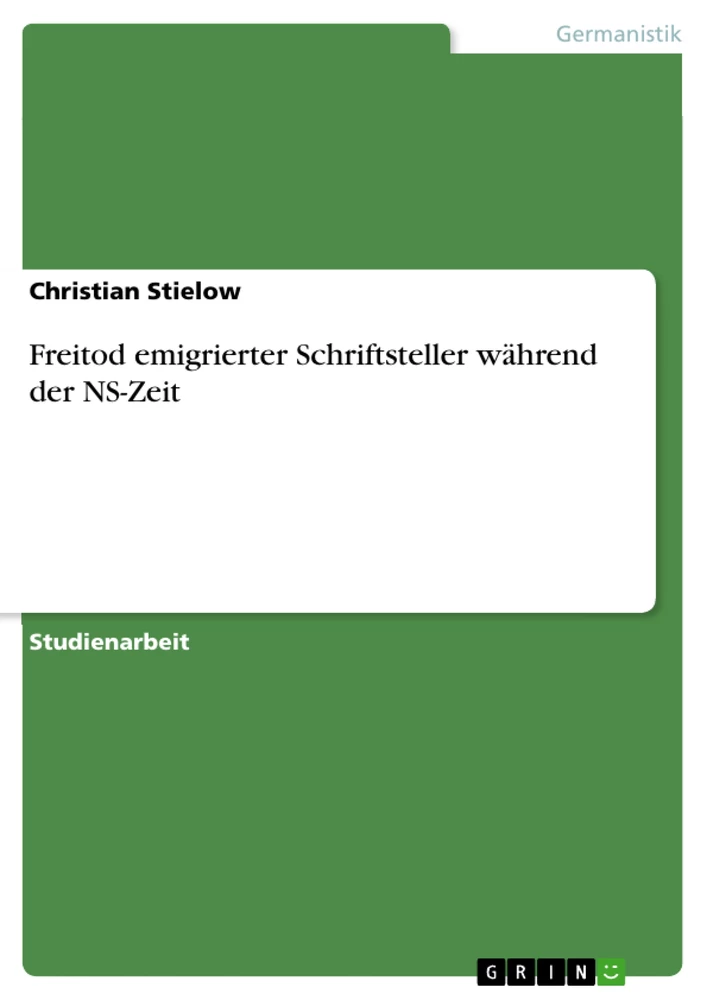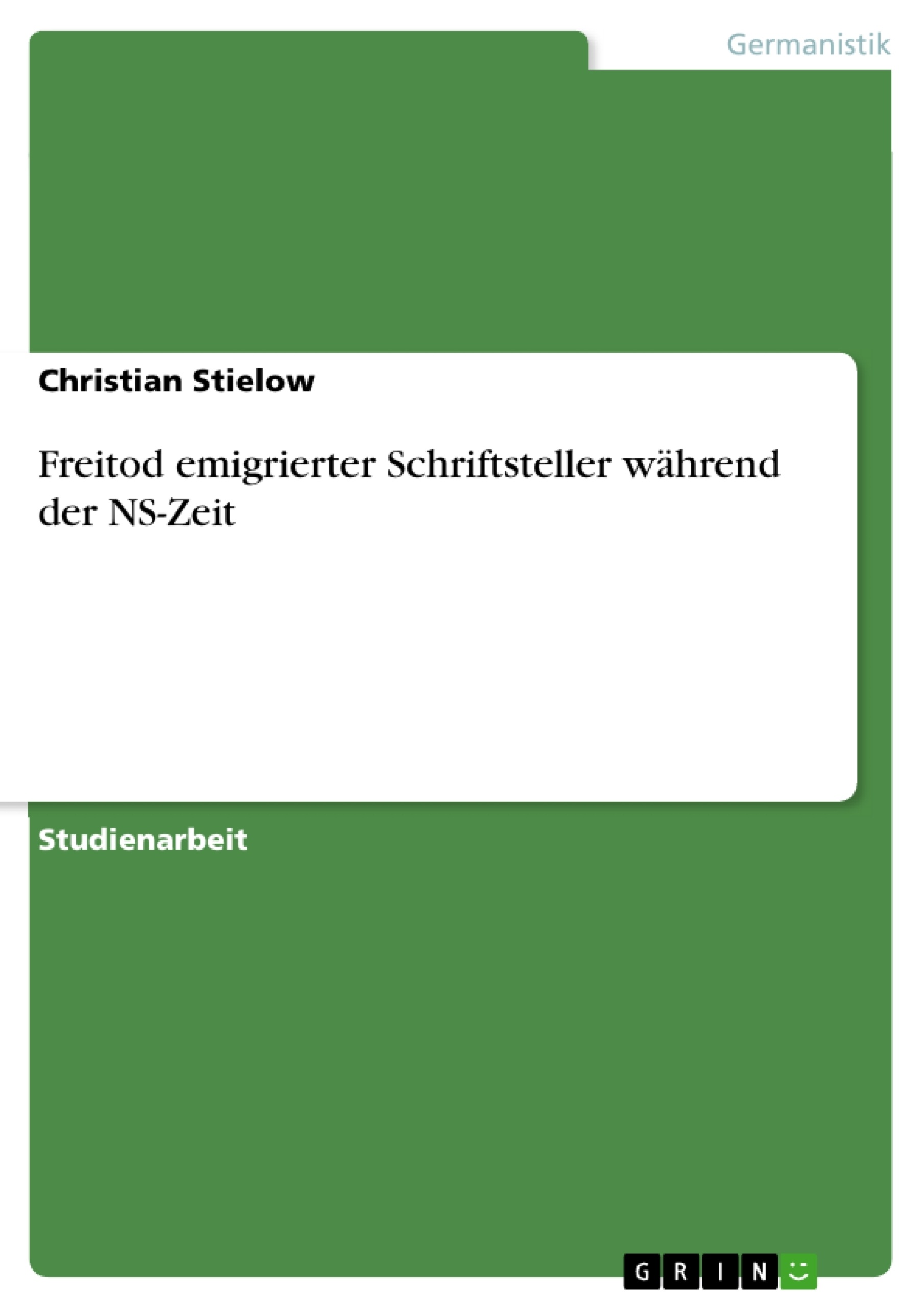Nie zuvor emigrierten so viele Autoren aus einem Land wie zur Zeit des Nationalsozialismus aus Deutschland. Etwa 2500 Schriftsteller verließen aus Angst vor einer Verfolgung aus rassistischen oder politischen Gründen das Land, viele von ihnen direkt nach der Machtübernahme Hitlers, weitere nach dem Reichstagsbrand sowie der Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933.1 So heterogen die Masse der Vertriebenen war, so unterschiedlich kamen die einzelnen Exilanten mit dem Leben im Exil zurecht. Während ein geringer Teil der exilierten Schriftsteller sich weitestgehend ohne große Probleme an die neue Situation anpasste, litt der überwiegende Teil an verschiedenen Verlusterfahrungen. Diese aufzuzeigen, ist der erste Teil meiner vorliegenden Arbeit. Für manche Autoren wogen die Verlusterfahrungen so schwer, dass ein Weiterleben für sie nicht mehr in Frage kam, sie begingen Suizid. Was die einzelnen Beweggründe dafür waren, erläutere ich im zweiten Teil meiner Arbeit. Exemplarisch werde ich es an drei Schriftstellern – Kurt Tucholsky, Ernst Toller, Stefan Zweig – untersuchen. Wichtig bei der Auswahl war mir, dass sie den Selbstmord aus „freien Stücken“ vollzogen, ihr Leben also nicht in unmittelbarer Gefahr war, wie etwa bei Walter Hasenclever,2 denn nur in diesem Fall lässt sich der Einfluss der Verlusterfahrungen des Exils ausreichend analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verlusterfahrungen im Exil
- Kurt Tucholsky
- Ernst Toller
- Stefan Zweig
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verlusterfahrungen deutschsprachiger Schriftsteller im Exil während des Nationalsozialismus und deren Einfluss auf die Entscheidung zum Suizid. Der Fokus liegt auf der Analyse der individuellen Umstände und der jeweiligen Bedeutung der erlebten Verluste.
- Verlust der kulturellen und sprachlichen Heimat
- Materieller Verlust und finanzielle Schwierigkeiten
- Verlust der schriftstellerischen Aufgabe und Kreativität
- Politische Enttäuschung und Resignation
- Psychische Belastung und Depressionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den Kontext des Exils deutscher Schriftsteller während des Nationalsozialismus und die Heterogenität der Erfahrungen. Kapitel 1 beleuchtet die verschiedenen Verlusterfahrungen der Exilanten, darunter der Verlust der kulturellen und sprachlichen Heimat, materielle Verluste und der Verlust der schriftstellerischen Aufgabe. Kapitel 2.1 analysiert Kurt Tucholskys Exilerfahrungen, seine zunehmende Resignation und die vielschichtigen Gründe für seinen Suizid. Kapitel 2.2 untersucht Ernst Tollers Weg ins Exil, seine politischen Enttäuschungen und den Einfluss des Verlusts seiner Muttersprache auf seine psychische Verfassung und seinen Selbstmord. Kapitel 2.3 beschreibt Stefan Zweigs Exilerfahrungen, seinen Umgang mit dem Verlust der Heimat und die Faktoren, die zu seinem Suizid führten.
Schlüsselwörter
Exil, deutschsprachige Schriftsteller, Nationalsozialismus, Verlusterfahrungen, Suizid, Kurt Tucholsky, Ernst Toller, Stefan Zweig, kultureller Verlust, sprachlicher Verlust, materieller Verlust, politische Enttäuschung, Depressionen, psychische Belastung, Selbstmord.
Häufig gestellte Fragen
Warum begingen viele Schriftsteller im Exil Suizid?
Viele litten unter dem Verlust der Heimat, der Sprache, materieller Not und der Resignation angesichts der politischen Lage in Europa.
Welche Verlusterfahrungen waren im Exil zentral?
Neben dem kulturellen Verlust wog oft der Verlust der schriftstellerischen Aufgabe und der Kreativität schwer, da das Publikum im Heimatland fehlte.
Warum wählte Stefan Zweig den Freitod?
Zweig litt extrem unter dem Untergang seiner geistigen Heimat Europa und sah im Exil keine Perspektive für ein Weiterleben in Würde und schöpferischer Kraft.
Welche Rolle spielte der Sprachverlust für Ernst Toller?
Für Toller war die deutsche Sprache sein wichtigstes Werkzeug; der Verlust des muttersprachlichen Umfelds trug maßgeblich zu seiner psychischen Belastung bei.
Wie viele Autoren verließen Deutschland während der NS-Zeit?
Etwa 2.500 Schriftsteller emigrierten aus Angst vor rassistischer oder politischer Verfolgung aus dem nationalsozialistischen Deutschland.
- Quote paper
- Christian Stielow (Author), 2011, Freitod emigrierter Schriftsteller während der NS-Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187110