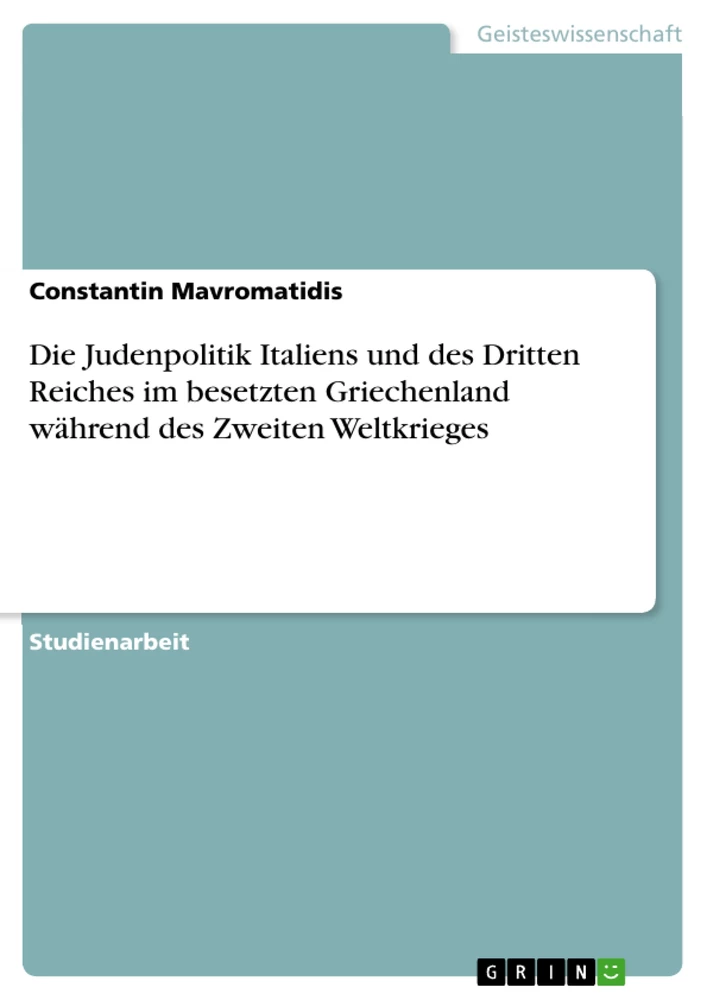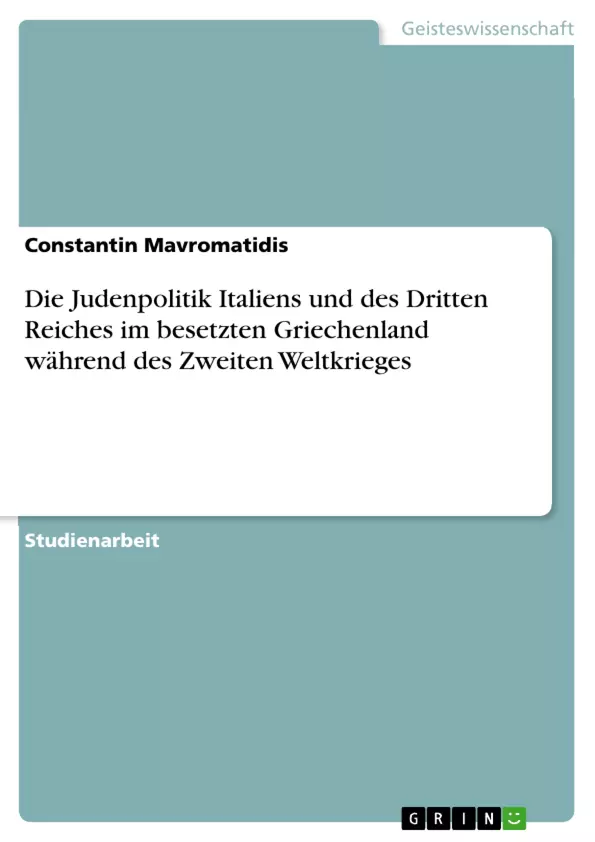1.Einleitung
Der Holocaust markiert die katastrophale Zuspitzung der antisemitischen Exzesse in Europa. Diese ist in diesem Ausmaß und Qualität eine Zäsur in der Menschheitsgeschichte. Die Auswirkungen dieses Genozids sind noch heute spürbar und bestimmen den politischen Alltag. Eine grundlegende Voraussetzung für die Durchführung eines derartigen Verbrechens, war der 2. Weltkrieg. Erst die Wirren des Krieges und die damit einhergehende staatlich gelenkte Willkür, der ausgelebte Rassenhass, sowie die Revision der bis dahin in Europa geltenden humanistischen Errungenschaften, ermöglichten es dem 3. Reich die Juden Europas gnadenlos zu verfolgen und nahezu ausmerzen zu können. Um die angestrebten Ziele zu verwirklichen, benötigte das 3. Reich Verbündete und Ressourcen. Der Hauptverbündete in Europa war das faschistische Italien, dessen Führer Mussolini es vordergründig auf imperiale Größe abgesehen hatte.
In welchem Einvernehmen sich die jeweiligen Vorstellungen und Interessen der beiden Achsenmächte miteinander, im Bezug auf die sogenannte Judenfrage kombinieren lassen und wie sich infolge dessen, die gegenseitigen Beziehungen zwischen ihnen entwickelten wird abrissartig dargestellt.
Hierbei eröffnet sich die Frage, ob, und wenn ja, weshalb sich die Judenpolitik der italienischen und der deutschen Besatzer im besetzten Griechenland voneinander unterschieden, wie sich etwaige Unstimmigkeiten in der Vorgehensweise und der Zielsetzung in welcher Form geäußert haben?
Da sich diese Geschichte zur gleichen Zeit und im gleichen Land zugetragen hat, bietet sich ein methodischer Vergleich an. Um diese Gegenüberstellung anstellen zu können, ist es sinnvoll die geistigen Strömungen in den Bevölkerungen, die rechtlichen Voraussetzungen und die gesellschaftliche Stellung der Juden zu dieser Zeit in den jeweiligen Heimatländern der Okkupanten, Italien und Deutschland zu beleuchten.
Wich die Judenpolitik in der Heimat von der politischen Gangart im besetzten Griechenland ab?
Um dieser Frage nachgehen zu können, ist es unumgänglich die Lage der jüdischen Bevölkerung im besetzten Griechenland und ihre gesellschaftliche Stellung im historischen Kontext im Ansatz zu beleuchten.
Wie war das Verhältnis zwischen Juden und Christen im okkupierten Land zu sehen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Judenpolitik der Faschisten in Italien während ihrer Regierungszeit
- Die gesellschaftliche Stellung der Juden im Allgemeinen
- Die Juden und der Faschismus
- Die Judenpolitik der Nationalsozialisten nach ihrer Machtergreifung in Deutschland
- Griechenland
- Historischer Abriss der jüdischen Präsenz in Griechenland bis zum Holocaust
- Das Verhältnis der christlichen Griechen zur jüdischen Bevölkerung bis zur Besetzung durch die Achsenmächte
- Die Beziehung der Diktatur Metaxas' zur jüdischen Bevölkerungsgruppe
- Kurzer Überblick des Kriegsverlaufs der zur Besetzung Griechenlands führte
- Überblick 1941-1944
- Die Besatzungskonstellation und die Bevölkerungszahlen der Juden
- Die deutsche Besatzungszone und die Juden bis zur Kapitulation Italiens
- Die italienische Besatzungszone bis zum 8. September 1943
- Die Reaktion und das Verhalten der griechischen Bevölkerung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Judenpolitik Italiens und des Dritten Reiches im besetzten Griechenland während des Zweiten Weltkriegs. Ziel ist ein Vergleich der jeweiligen Vorgehensweisen und Zielsetzungen beider Besatzungsmächte. Dabei werden die gesellschaftliche Stellung der Juden in Italien und Deutschland vor dem Krieg sowie die Beziehungen zwischen der jüdischen Bevölkerung und der christlichen Bevölkerung Griechenlands beleuchtet.
- Vergleich der Judenpolitik Italiens und des Deutschen Reiches im besetzten Griechenland.
- Gesellschaftliche Stellung der Juden in Italien und Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg.
- Das Verhältnis zwischen jüdischer und christlicher Bevölkerung in Griechenland.
- Einfluss der vorherrschenden politischen und gesellschaftlichen Strömungen auf die Judenpolitik.
- Analyse der Unterschiede in der Vorgehensweise und Zielsetzung der Besatzungsmächte.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Holocausts und die Rolle des Zweiten Weltkriegs ein, wobei die Zusammenarbeit zwischen Italien und dem Deutschen Reich im Hinblick auf die "Judenfrage" im Mittelpunkt steht. Kapitel 2 beleuchtet die gesellschaftliche Stellung der Juden in Italien und deren Verhältnis zum Faschismus, welches durch Integration und Assimilation geprägt war, jedoch auch von punktuellem Antisemitismus begleitet wurde. Kapitel 3 skizziert die Judenpolitik der Nationalsozialisten in Deutschland nach der Machtergreifung. Kapitel 4 bietet einen historischen Überblick über die jüdische Präsenz in Griechenland, die Beziehungen zwischen jüdischen und christlichen Griechen sowie die Politik der Metaxas-Diktatur. Kapitel 5 gibt einen Überblick über die Besatzungszeit 1941-1943, unterteilt in die deutsche und die italienische Besatzungszone, einschließlich der Reaktionen der griechischen Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Judenpolitik, Italien, Drittes Reich, Besetztes Griechenland, Zweiter Weltkrieg, Faschismus, Nationalsozialismus, Antisemitismus, Holocaust, jüdische Bevölkerung, christliche Bevölkerung, Besatzungspolitik, gesellschaftliche Stellung, Integration, Assimilation.
- Quote paper
- Constantin Mavromatidis (Author), 2010, Die Judenpolitik Italiens und des Dritten Reiches im besetzten Griechenland während des Zweiten Weltkrieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187122