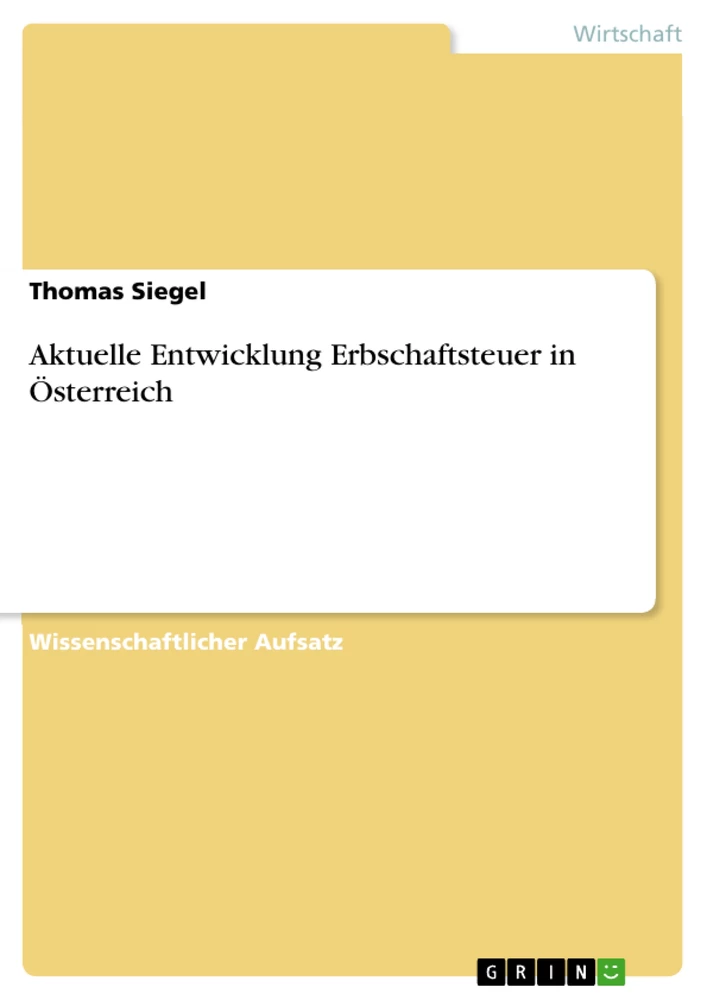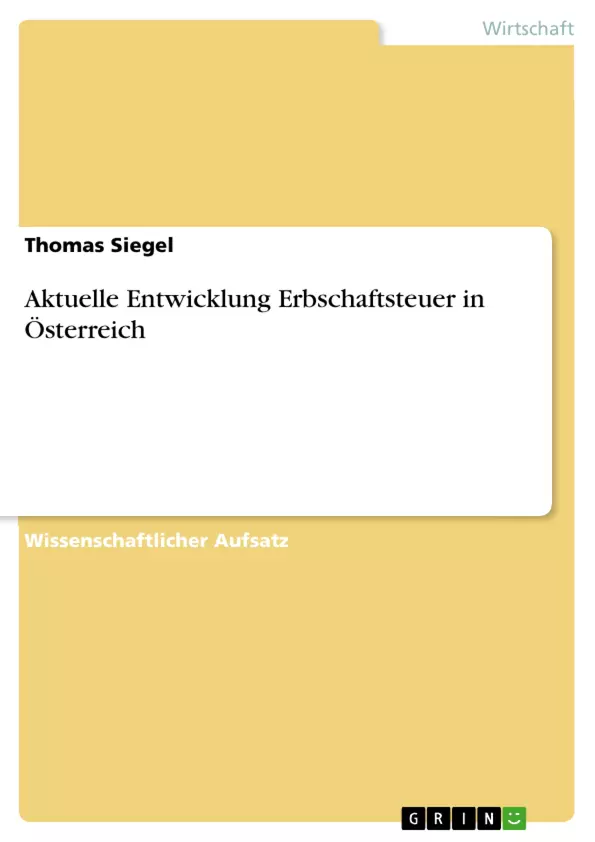Österreich hatte lange Jahre ein dem deutschen angelehntes Erbschafts-steuerrecht. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass der öster-reichische Verfassungsgerichtshof zeitnah zum deutschen Bundesver-fassungsgericht eine diese Steuer betreffende Entscheidung gefällt hat.
Sowohl in Österreich als auch in Deutschland war und ist die Erbschafts-steuer eine Steuer mit einem relativ geringen Aufkommen. In Österreich betrug das Aufkommen zuletzt rund EUR 150 Mio. jährlich. In Deutschland im Vergleichsjahr 2007 rund EUR 4 Mrd. Gleichwohl sind die Gesetzgeber der beiden Staaten nach den Verfassungsgerichtsentscheidungen unter-schiedliche Wege gegangen. Den österreichischen Weg darzustellen ist der Zweck des vorliegenden Beitrags.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes
- Gesetzgeberische Konsequenzen aus der Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes
- Ausdehnung der Grunderwerbsteuerpflicht
- Einführung einer Meldeverpflichtung von Schenkungen
- Auswirkung auf internationale Fälle der Erbschaft bzw. Schenkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag beschreibt die Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer in Österreich im Jahr 2008. Er analysiert die Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, die gesetzgeberischen Konsequenzen und die darauf folgenden Maßnahmen, wie die Ausdehnung der Grunderwerbsteuerpflicht und die Einführung von Meldepflichten.
- Die Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes zur Verfassungswidrigkeit der Erbschafts- und Schenkungssteuer
- Die gesetzgeberischen Reaktionen auf die Gerichtsentscheidung, insbesondere die Debatte um Abschaffung vs. Reform
- Die Auswirkungen der Abschaffung auf die Steuerlandschaft Österreichs
- Die Einführung neuer Regelungen zur Grunderwerbsteuer und Meldepflichten
- Die Auswirkungen auf internationale Erbschafts- und Schenkungsfälle
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung: Der Text beschreibt die Entwicklungen im österreichischen Erbschaftsteuerrecht, insbesondere die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs und die daraus resultierende Abschaffung der Steuer. Er vergleicht kurz die Situation mit der in Deutschland und hebt die relativ geringen Steuereinnahmen in Österreich hervor, welche trotz des hohen Verwaltungsaufwands die Abschaffung begünstigten.
Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes: Der österreichische Verfassungsgerichtshof erklärte die Erbschafts- und Schenkungssteuer 2007 für verfassungswidrig. Die Bemessungsgrundlage, basierend auf veralteten Einheitswerten aus dem Jahr 1973, wurde als nicht verfassungsgemäß kritisiert, da sie den aktuellen Marktwert nicht widerspiegelte und somit eine ungerechte Besteuerung darstellte. Der Gerichtshof gab dem Gesetzgeber eine Frist zur Reformierung des Gesetzes.
Gesetzgeberische Konsequenzen aus der Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes: Der österreichische Gesetzgeber diskutierte nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs die Möglichkeiten einer Reform oder Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Trotz Kritik von Teilen der SPÖ und der Grünen, welche eine Benachteiligung von Arbeitseinkommen und eine Privilegierung der Vermögenden befürchteten, setzte sich die Mehrheit für die Abschaffung durch. Die geringen Steuereinnahmen und der hohe Verwaltungsaufwand wurden als Hauptargumente genannt.
Ausdehnung der Grunderwerbsteuerpflicht: Nach der Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer wurde die Grunderwerbsteuerpflicht erweitert, und es wurden Meldepflichten für unentgeltliche Vermögensübertragungen eingeführt. Dies deutet auf einen Versuch hin, die durch die Abschaffung entstandene Einnahme-Lücke zumindest teilweise zu kompensieren und die Transparenz im Bereich der Vermögensübertragungen zu erhöhen.
Schlüsselwörter
Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer, Österreich, Verfassungsgerichtshof, Gesetzgebung, Grunderwerbsteuer, Meldepflicht, Vermögensübertragung, Steuerreform, Steuereinnahmen, Verwaltungsaufwand.
Häufig gestellte Fragen zur Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer in Österreich
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text beschreibt die Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer in Österreich im Jahr 2008. Er analysiert die Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, die darauf folgenden gesetzgeberischen Konsequenzen und die eingeführten Maßnahmen wie die Ausdehnung der Grunderwerbsteuerpflicht und die Einführung von Meldepflichten für Schenkungen.
Welche Rolle spielte der österreichische Verfassungsgerichtshof?
Der österreichische Verfassungsgerichtshof erklärte im Jahr 2007 die Erbschafts- und Schenkungssteuer für verfassungswidrig. Die Bemessungsgrundlage, basierend auf veralteten Einheitswerten, wurde als ungerecht kritisiert, da sie den aktuellen Marktwert nicht widerspiegelte. Diese Entscheidung zwang den Gesetzgeber zur Reaktion.
Welche gesetzgeberischen Konsequenzen ergaben sich aus der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes?
Der Gesetzgeber diskutierte nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes eine Reform oder Abschaffung der Steuer. Letztendlich wurde die Steuer abgeschafft, trotz Kritik von Seiten der SPÖ und der Grünen, die eine Benachteiligung von Arbeitseinkommen befürchteten. Die geringen Steuereinnahmen und der hohe Verwaltungsaufwand waren Hauptargumente für die Abschaffung.
Wie wurde die Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer kompensiert?
Um die durch die Abschaffung entstandene Einnahme-Lücke zumindest teilweise zu schließen und die Transparenz zu erhöhen, wurde die Grunderwerbsteuerpflicht erweitert und eine Meldepflicht für unentgeltliche Vermögensübertragungen eingeführt.
Welche Auswirkungen hatte die Abschaffung auf internationale Erbschafts- und Schenkungsfälle?
Der Text erwähnt die Auswirkungen auf internationale Fälle, geht aber nicht im Detail darauf ein. Weitere Informationen hierzu wären in weiterführender Literatur zu finden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Textes?
Schlüsselwörter sind: Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer, Österreich, Verfassungsgerichtshof, Gesetzgebung, Grunderwerbsteuer, Meldepflicht, Vermögensübertragung, Steuerreform, Steuereinnahmen, Verwaltungsaufwand.
Gibt es einen Vergleich mit anderen Ländern?
Der Text vergleicht die Situation in Österreich kurz mit der in Deutschland und hebt die relativ geringen Steuereinnahmen in Österreich trotz hohen Verwaltungsaufwands hervor, welche die Abschaffung begünstigten.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst die Kapitel Vorbemerkung, Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, Gesetzgeberische Konsequenzen aus der Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, Ausdehnung der Grunderwerbsteuerpflicht, Einführung einer Meldeverpflichtung von Schenkungen und Auswirkung auf internationale Fälle der Erbschaft bzw. Schenkung.
- Arbeit zitieren
- Thomas Siegel (Autor:in), 2012, Aktuelle Entwicklung Erbschaftsteuer in Österreich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187132