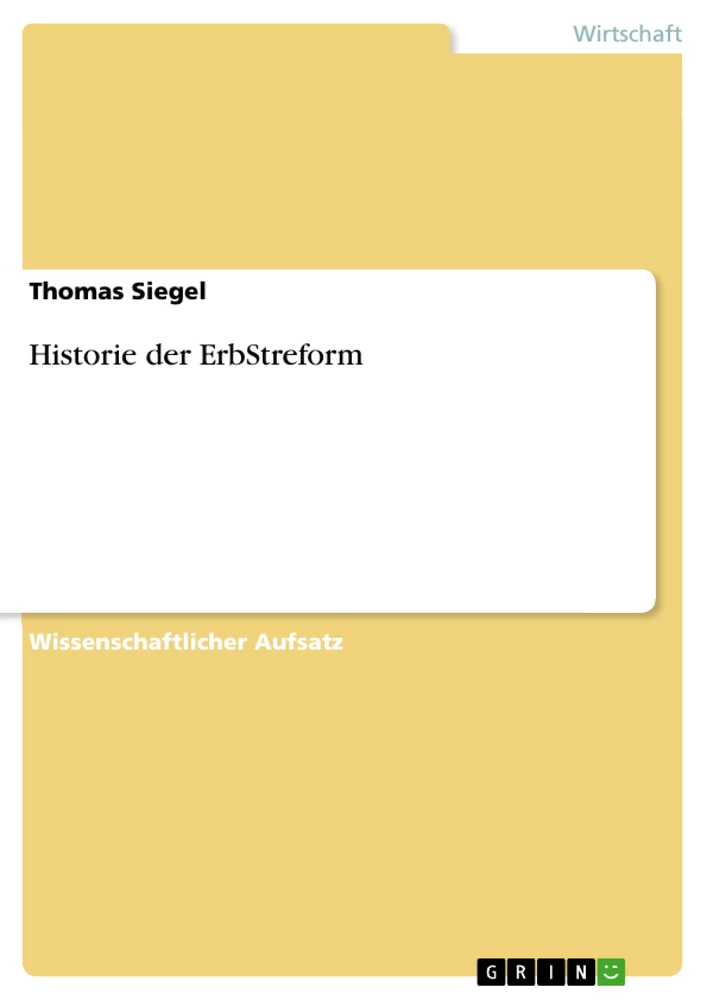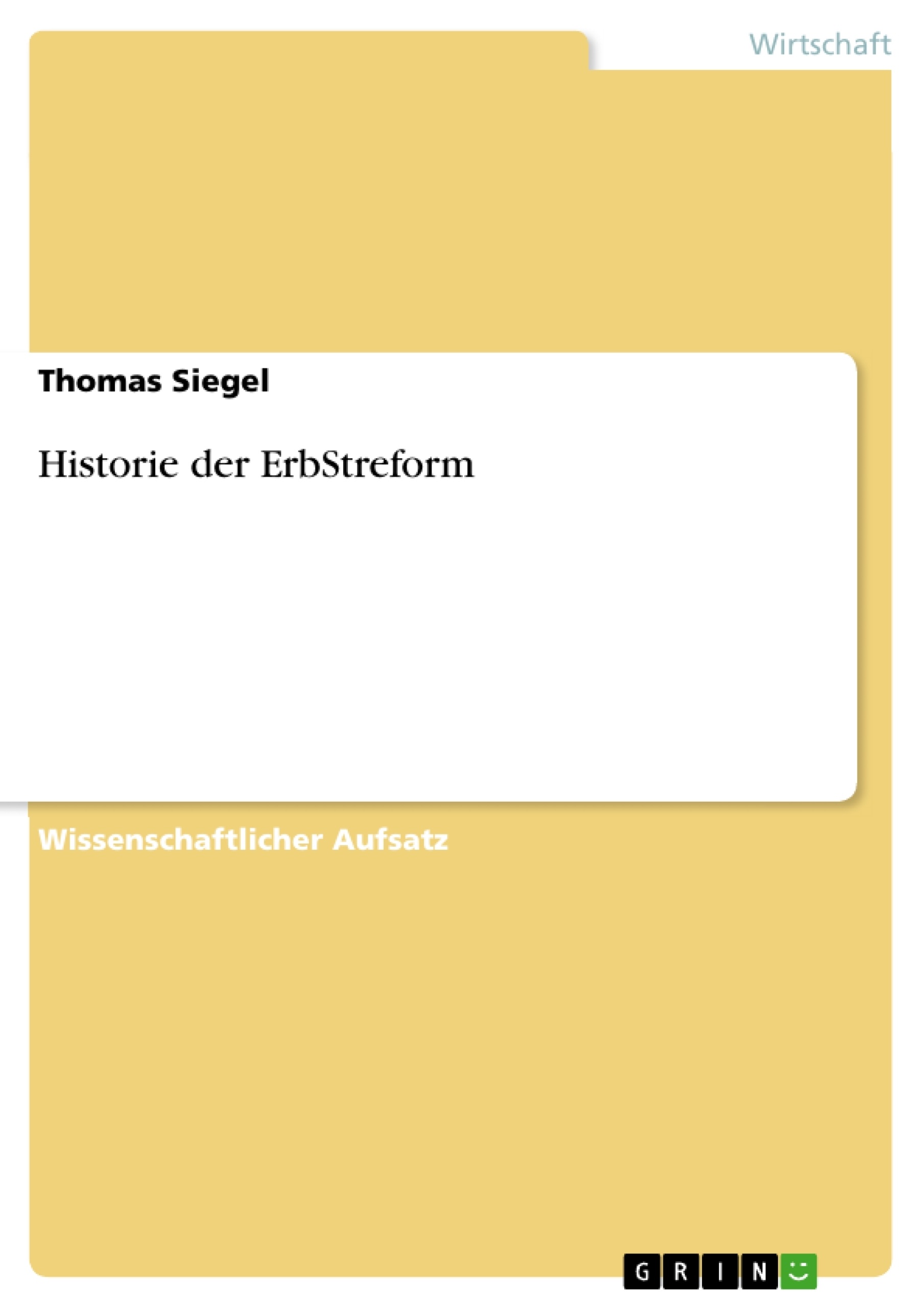Mit der Verabschiedung des Erbschaftsteuerreformgesetzes in den letzten Dezembertagen 2008 ist eine langjährige steuerrechtliche Unsicherheit in¬soweit beseitigt worden, die mit dem Steueränderungsgesetz 1992 in die Welt gesetzt wurde. Mit diesem Steueränderungsgesetz 1992 wurden unter anderem Bewertungsregelungen an die Steuerbilanzwerte geknüpft. Mit dem Jahressteuergesetz 1997 verabschiedete sich der Gesetzgeber von den Einheitswerten bei der Grundbesitzbewertung und orientierte sich zu gemeinen Werten. In der gesamten Folgezeit musste der Gesetzgeber immer wieder reagieren, um den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes hinsichtlich der Bewertung gerecht zu werden. Dies hat mit dem Erbschaftsteuerreformgesetz 2009 ein vorläufiges Ende gefunden.
Renommierte Vertreter der Fachwelt gehen davon aus, dass die seit 01.01.2009 gültige Erbschafts- und Schenkungsbesteuerung mit den Be¬wertungsregelungen wiederum nicht verfassungsgemäß ist. Informierte Kreise wollen wissen, dass der zweite Senat des Bundesfinanzhofes bereits wiederum einen Vorlagebeschluss an das Bundesverfassungsgericht vorbe¬reitet, um die Verfassungsmäßigkeit des aktuell gültigen Erbschafts- und Schenkungssteuerrechtes überprüfen zu lassen. Insoweit bleibt abzuwarten, wie lange das nunmehr gültige Recht Bestand haben wird. Von einer Abschaffung der Erbschafts-, Schenkungssteuer hat der Gesetzgeber abgesehen. Das Land Österreich wurde insoweit also nicht als Vorbild herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschluss des Bundesverfassungsgerichtshofes vom 22.06.1995 und Jahressteuergesetz 1997
- Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofes vom 22.05.2002
- Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 07.11.2006
- Verabschiedung der neuen Erbschaftsteuerreform 2009
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Historie der Erbschaftsteuerreform in Deutschland nachzuzeichnen und die wichtigsten Meilensteine und rechtlichen Auseinandersetzungen zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Bewertungsgrundlagen und den damit verbundenen verfassungsrechtlichen Herausforderungen.
- Entwicklung der Bewertungsgrundlagen für Grundbesitz in der Erbschaftsteuer
- Verfassungsrechtliche Auseinandersetzungen um die Erbschaftsteuer
- Einfluss der Urteile des Bundesverfassungsgerichts auf die Gesetzgebung
- Die Erbschaftsteuerreform 2009 und ihre Auswirkungen
- Vergleichende Betrachtung der verschiedenen Bewertungssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die langjährige Unsicherheit im Steuerrecht im Zusammenhang mit der Erbschaftsteuer und die Einführung des Erbschaftsteuerreformgesetzes 2009 als vorläufigen Abschluss dieser Unsicherheit. Es wird auch auf die anhaltende Debatte um die Verfassungsmäßigkeit der aktuellen Regelungen hingewiesen.
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22.06.1995 und Jahressteuergesetz 1997: Dieses Kapitel behandelt die Folgen des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 22.06.1995, der die bisherigen Wertansätze der Grundstücksbewertung für verfassungswidrig erklärte. Es beschreibt die darauf folgende Einführung des Jahressteuergesetzes 1997 und die damit verbundenen neuen Bewertungsregelungen basierend auf Bodenrichtwerten.
Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofes vom 22.05.2002: Hier wird der Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofes an das Bundesverfassungsgericht vom 22.05.2002 dargestellt. Der Bundesfinanzhof kritisierte die gesetzlichen Regelungen zur Bemessungsgrundlage der Erbschafts- und Schenkungssteuer als gleichheitswidrig und damit verfassungswidrig, insbesondere die pauschale Begünstigung des Betriebsvermögens und die pauschale Entlastung beim Erwerb von Anteilen an Kapitalgesellschaften.
Schlüsselwörter
Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer, Bundesverfassungsgericht, Bundesfinanzhof, Grundstücksbewertung, Einheitswert, Bodenrichtwert, Bewertungsregelungen, Verfassungsmäßigkeit, Steuerrecht, Steuerreform, Jahressteuergesetz 1997, Erbschaftsteuerreformgesetz 2009, Gleichheitsgrundsatz.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde das Erbschaftsteuerrecht in Deutschland reformiert?
Mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichts erklärten die bisherigen Bewertungsmethoden (z.B. Einheitswerte) für verfassungswidrig, da sie den Gleichheitsgrundsatz verletzten.
Was änderte sich durch das Jahressteuergesetz 1997?
Der Gesetzgeber verabschiedete sich von den veralteten Einheitswerten bei der Grundbesitzbewertung und orientierte sich stattdessen an gemeinen Werten (Verkehrswerten).
Was war der Kern der Erbschaftsteuerreform 2009?
Die Reform von 2009 zielte darauf ab, die Bewertung von Vermögen (insbesondere Immobilien und Betriebsvermögen) näher am tatsächlichen Marktwert auszurichten, um den verfassungsrechtlichen Vorgaben zu entsprechen.
Ist das aktuelle Erbschaftsteuerrecht endgültig rechtssicher?
Nein, die Arbeit weist darauf hin, dass auch nach 2009 Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit bestanden und der Bundesfinanzhof erneut Vorlagen an das Bundesverfassungsgericht vorbereitete.
Wurde die Erbschaftsteuer in Deutschland jemals abgeschafft?
Nein, der deutsche Gesetzgeber hat von einer Abschaffung abgesehen, anders als beispielsweise Österreich, das die Erbschaftsteuer auslaufen ließ.
Was sind Bodenrichtwerte in diesem Kontext?
Bodenrichtwerte wurden als Instrument eingeführt, um eine realistischere und aktuellere Bewertung von Grundstücken für steuerliche Zwecke zu ermöglichen.
- Quote paper
- Thomas Siegel (Author), 2012, Historie der ErbStreform, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187135