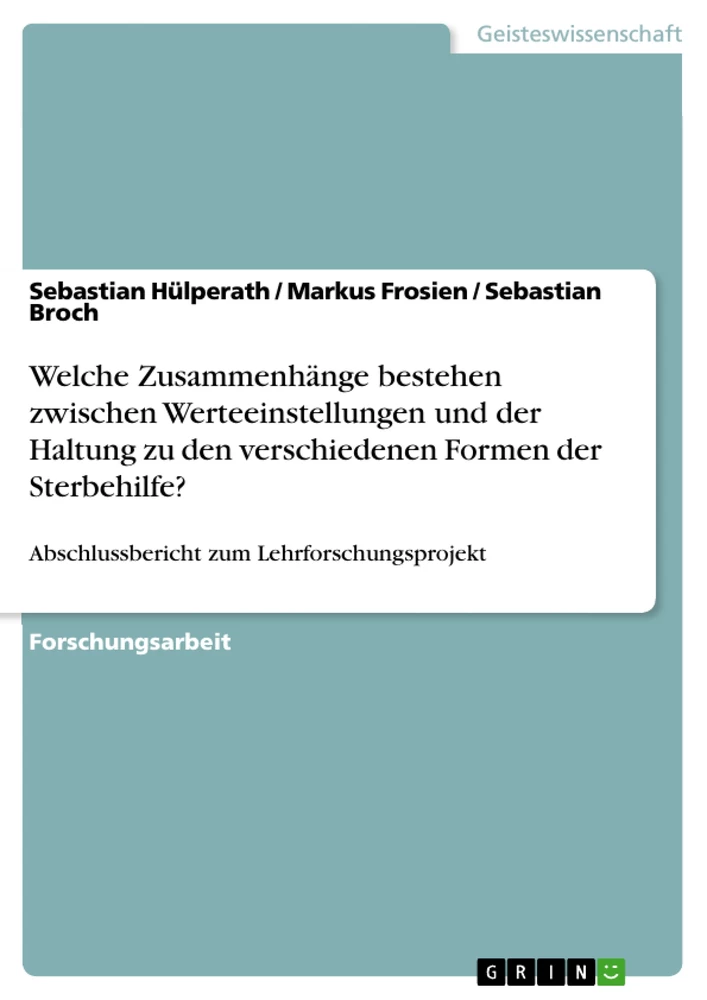Mit zunehmendem technischen und medizinischen Fortschritt sind in den vergangenen
Jahrzehnten neue Möglichkeiten der Heilung von Krankheiten entstanden. Die
durchschnittliche Lebensdauer konnte dadurch deutlich verlängert werden und insbesondere
im hohen Alter bedeutet eine schwere Krankheit nicht mehr zwangsläufig den Tod. Die
Kehrseite dieser Entwicklung ist, dass teilweise Patienten unter den lebensverlängernden
Maßnahmen leiden und Monate, wenn nicht sogar Jahre, nur mit Hilfe medizinischer Mittel
weiterleben, wobei die Lebensqualität dabei sehr gering sein kann. Eine Antwort auf die
Frage, ob derartige medizinische Maßnahmen oder deren Beendigung moralisch zu
rechtfertigen sind, ist nicht nach objektiven Maßstäben zu beantworten, sondern eine höchst
subjektive. Die moralische Bewertung der Sterbehilfe divergiert dementsprechend auch stark
innerhalb der Bevölkerung: Argumente, die auf der einen Seite als human beurteilt werden,
können von anderen als unmenschlich und grausam verurteilt werden (vgl. jjc/dpa/ddp 2008).
Die Debatten über das Thema wurden folglich in den letzten Jahren kontrovers geführt.
Mit der Überlegung des Einsatzes sterbeunterstützender Maßnahmen kann jeder in Berührung
kommen. Sei es als Angehöriger, der sich Gedanken über das Leid einer ihm nahestehenden
Person macht, oder als direkt Betroffener. Spätestens im hohen Alter überlegen sich die
meisten Menschen, wie das Lebensende gestaltet werden soll. Es ist also wahrscheinlich, dass
man sich im Laufe des Lebens über die Art und Weise des Ablebens – und damit über
Sterbehilfe – Gedanken machen muss. Und selbst wenn man sich nie direkt in einer kritischen
medizinischen Situation befand, ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema in Form einer
Patientenverfügung üblich. Spätestens beim Verfassen einer solchen Erklärung muss dann
eine Einstellung zur Sterbehilfe gefunden werden. Die Einflussfaktoren über die
Entscheidungen, ob sterbeunterstützende Maßnahmen befürwortet oder abgelehnt werden,
sind sehr vielfältig. Doch welche sind es genau und welchen Einfluss haben diese Faktoren?
Welche Rolle spielen soziodemographische Merkmale wie Alter, Geschlecht oder
Religionszugehörigkeit? Auch untersuchungswürdig ist die Bewertung der unterschiedlichen
Formen der Sterbehilfe wie aktiver und passiver Sterbehilfe sowie des assistierten Suizids.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorien und Hypothesen
- 2.1 Kurzdarstellung der relevanten Theorien
- 2.2 Hypothesenentwicklung und -darstellung
- 2.2.1 Hypothesen zur Soziodemographie
- 2.2.2 Hypothesen zur Werteinstellung
- 2.3 Indikatoren und Operationalisierung
- 2.4 Entwicklung der Merkmale und Ausprägungen für Vignetten
- 2.4.1 Design der Vignetten
- 2.4.2 Erstellung der Vignetten: Methode
- 3. Datenerhebung und -aufbereitung
- 3.1 Aufbereitung des Datensatzes
- 3.2 Rekodierung
- 3.3 Beschreibung der Stichprobe
- 4. Univariate Analysen der Zielvariablen
- 4.1 Analyse der Sterbehilfevariablen
- 4.1.1 Verteilung der Zustimmungswerte zur Sterbehilfe
- 4.1.2 Zusammenhänge innerhalb der Sterbehilfevariablen
- 4.2 Verteilung der Zustimmungswerte der Patientenverfügung
- 4.3 Univariate Analysen der unabhängigen Variablen zur Sterbehilfe
- 4.1 Analyse der Sterbehilfevariablen
- 5. Analyse des Werteinstruments
- 5.1 Korrelation der Schwartz Wertetypen
- 5.2 Vergleich Studentenstichprobe zu Respondi-Befragung
- 5.2.1 Faktoranalyse innerhalb des Werteschemas
- 5.2.2 Reliabilitätsanalyse der vier angenommenen Wertetypen
- 6. Bivariate Zusammenhangsanalyse
- 6.1 Werteeinfluss auf Sterbehilfeformen
- 6.2 Einfluss soziodemographischer Merkmale auf Sterbehilfe
- 7. Regressionsanalyse
- 7.1 Analysemethode
- 7.2 Empirische Resultate
- 7.3 Vignettenanalyse
- 7.3.1 Einflussstärke der Dimensionen
- 7.4 Interpretation der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Werteeinstellungen und der Haltung zu verschiedenen Formen der Sterbehilfe. Ziel ist es, empirisch zu belegen, inwieweit soziodemografische Faktoren und individuelle Werte die Einstellungen gegenüber Sterbehilfe beeinflussen. Die Studie nutzt dazu ein komplexes methodisches Design mit verschiedenen analytischen Ansätzen.
- Einfluss von Werten auf die Einstellung zur Sterbehilfe
- Rolle soziodemografischer Faktoren bei der Sterbehilfe-Haltung
- Analyse verschiedener Formen der Sterbehilfe (passive, aktive, assistierter Suizid)
- Anwendung und Evaluation verschiedener statistischer Methoden
- Entwicklung und Testung eines Vignetten-basierten Fragebogens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Studie ein und beschreibt den Forschungsstand und die Relevanz der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Werteeinstellungen und der Haltung zu verschiedenen Formen der Sterbehilfe. Es skizziert die Forschungsfrage und die methodischen Vorgehensweisen der Studie.
2. Theorien und Hypothesen: Dieses Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen der Studie und entwickelt Hypothesen zum Einfluss soziodemografischer Merkmale und von Werteeinstellungen auf die Zustimmung zu verschiedenen Formen der Sterbehilfe. Es werden relevante Theorien kurz dargestellt und die Operationalisierung der verwendeten Konstrukte erläutert. Die Kapitel detaillieren den Aufbau der Vignetten als zentralem Instrument der Datenerhebung.
3. Datenerhebung und -aufbereitung: Hier wird die Durchführung der Datenerhebung detailliert beschrieben. Es wird erläutert, wie der Datensatz aufbereitet und rekodiert wurde, sowie die Zusammensetzung der Stichprobe charakterisiert. Dieser Abschnitt beschreibt die Methoden der Datengewinnung und -aufbereitung, um die Grundlage der weiteren Analysen zu schaffen.
4. Univariate Analysen der Zielvariablen: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der univariaten Analysen der abhängigen Variablen (verschiedene Formen der Sterbehilfe und Patientenverfügung) präsentiert und interpretiert. Die Verteilungen der Zustimmungswerte werden beschrieben und erste Einblicke in die Daten gewonnen.
5. Analyse des Werteinstruments: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des verwendeten Werteinstruments, um dessen Validität und Reliabilität zu prüfen. Korrelationen zwischen den verschiedenen Wertetypen werden berechnet und die Ergebnisse einer Faktoranalyse und Reliabilitätsanalyse werden dargestellt und diskutiert.
6. Bivariate Zusammenhangsanalyse: Dieses Kapitel untersucht bivariate Zusammenhänge zwischen den Werten, soziodemografischen Merkmalen und den Einstellungen zu den verschiedenen Formen der Sterbehilfe. Hier werden die ersten Zusammenhänge zwischen den unabhängigen und abhängigen Variablen aufgezeigt.
7. Regressionsanalyse: Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit multiplen Regressionsanalysen, um den Einfluss der verschiedenen Variablen auf die Einstellung zur Sterbehilfe zu modellieren und die Hypothesen zu überprüfen. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Ergebnisse der Regressionsanalysen im Kontext der vorherigen Analysen und der theoretischen Überlegungen. Die Vignettenanalyse wird eingehend erläutert und ihre Bedeutung für die Interpretation der Ergebnisse herausgestellt.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, Werteinstellungen, Soziodemografie, Patientenverfügung, Empirische Forschung, Univariate Analyse, Bivariate Analyse, Regressionsanalyse, Vignettenstudie, Schwartz-Werte, Moralische Einstellungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Werteeinstellungen und Sterbehilfe
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Werteeinstellungen und der Haltung zu verschiedenen Formen der Sterbehilfe. Es wird empirisch geprüft, inwieweit soziodemografische Faktoren und individuelle Werte die Einstellungen gegenüber Sterbehilfe beeinflussen.
Welche Forschungsfragen werden bearbeitet?
Die Studie beleuchtet den Einfluss von Werten auf die Einstellung zur Sterbehilfe, die Rolle soziodemografischer Faktoren, analysiert verschiedene Sterbehilfeformen (passiv, aktiv, assistierter Suizid), evaluiert statistische Methoden und testet einen vignettenbasierten Fragebogen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet ein komplexes methodisches Design mit verschiedenen analytischen Ansätzen. Dazu gehören univariate und bivariate Analysen sowie Regressionsanalysen. Ein zentraler Bestandteil ist die Entwicklung und Anwendung eines Vignetten-basierten Fragebogens.
Welche Daten wurden erhoben und wie wurden sie aufbereitet?
Die Datenerhebung umfasste die Anwendung eines Fragebogens, der soziodemografische Daten und Werteeinstellungen erfasste, sowie die Einstellung zu verschiedenen Formen der Sterbehilfe und Patientenverfügungen. Der Datensatz wurde aufbereitet und rekodiert, die Stichprobe wird detailliert beschrieben.
Wie wurden die Werte gemessen?
Die Studie verwendete ein Werteinstrument (wahrscheinlich basierend auf dem Schwartz-Werte-Modell), dessen Validität und Reliabilität durch Korrelationsanalysen, Faktoranalysen und Reliabilitätsanalysen geprüft wurden.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse werden in mehreren Schritten präsentiert: Univariate Analysen der Zielvariablen (Sterbehilfeformen und Patientenverfügung), bivariate Zusammenhangsanalysen zwischen Werten, soziodemografischen Merkmalen und Sterbehilfe-Einstellungen, und schließlich multiple Regressionsanalysen, um den Einfluss der Variablen zu modellieren. Die Vignettenanalyse liefert zusätzliche Einblicke.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen werden im letzten Kapitel gezogen und basieren auf der Interpretation der Regressionsanalysen im Kontext der vorherigen Analysen und der theoretischen Überlegungen. Die Bedeutung der Vignettenanalyse für die Interpretation wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Sterbehilfe, Werteinstellungen, Soziodemografie, Patientenverfügung, Empirische Forschung, Univariate Analyse, Bivariate Analyse, Regressionsanalyse, Vignettenstudie, Schwartz-Werte, Moralische Einstellungen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Theorien und Hypothesen, Datenerhebung und -aufbereitung, Univariate Analysen, Analyse des Werteinstruments, Bivariate Zusammenhangsanalyse und Regressionsanalyse. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Personen, die sich für die Themen Sterbehilfe, Werteeinstellungen, soziodemografische Einflüsse und empirische Forschungsmethoden interessieren.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Hülperath (Autor:in), Markus Frosien (Autor:in), Sebastian Broch (Autor:in), 2011, Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Werteeinstellungen und der Haltung zu den verschiedenen Formen der Sterbehilfe?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187217