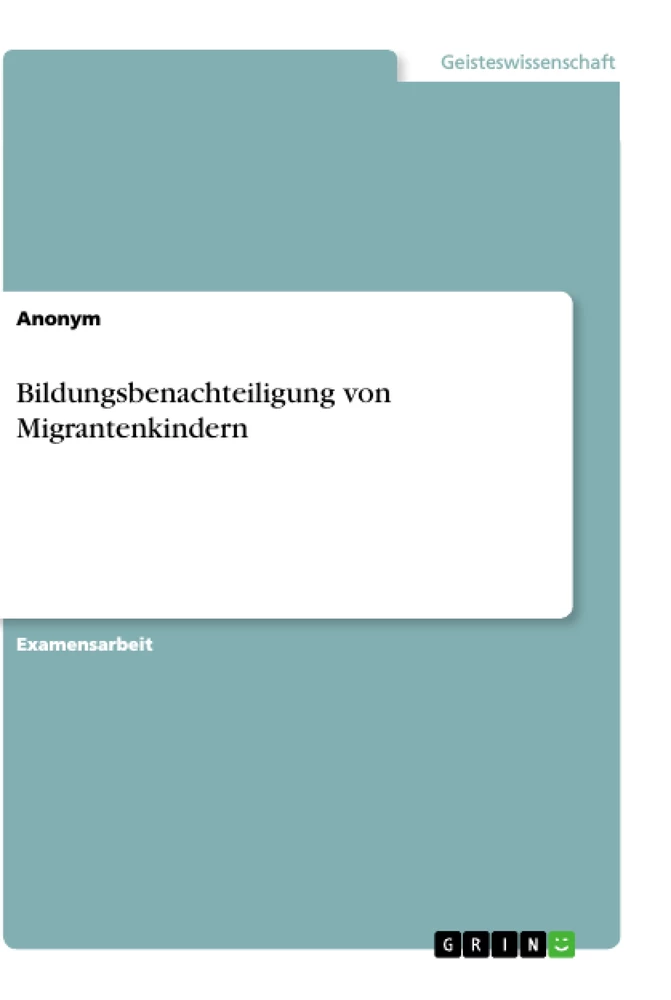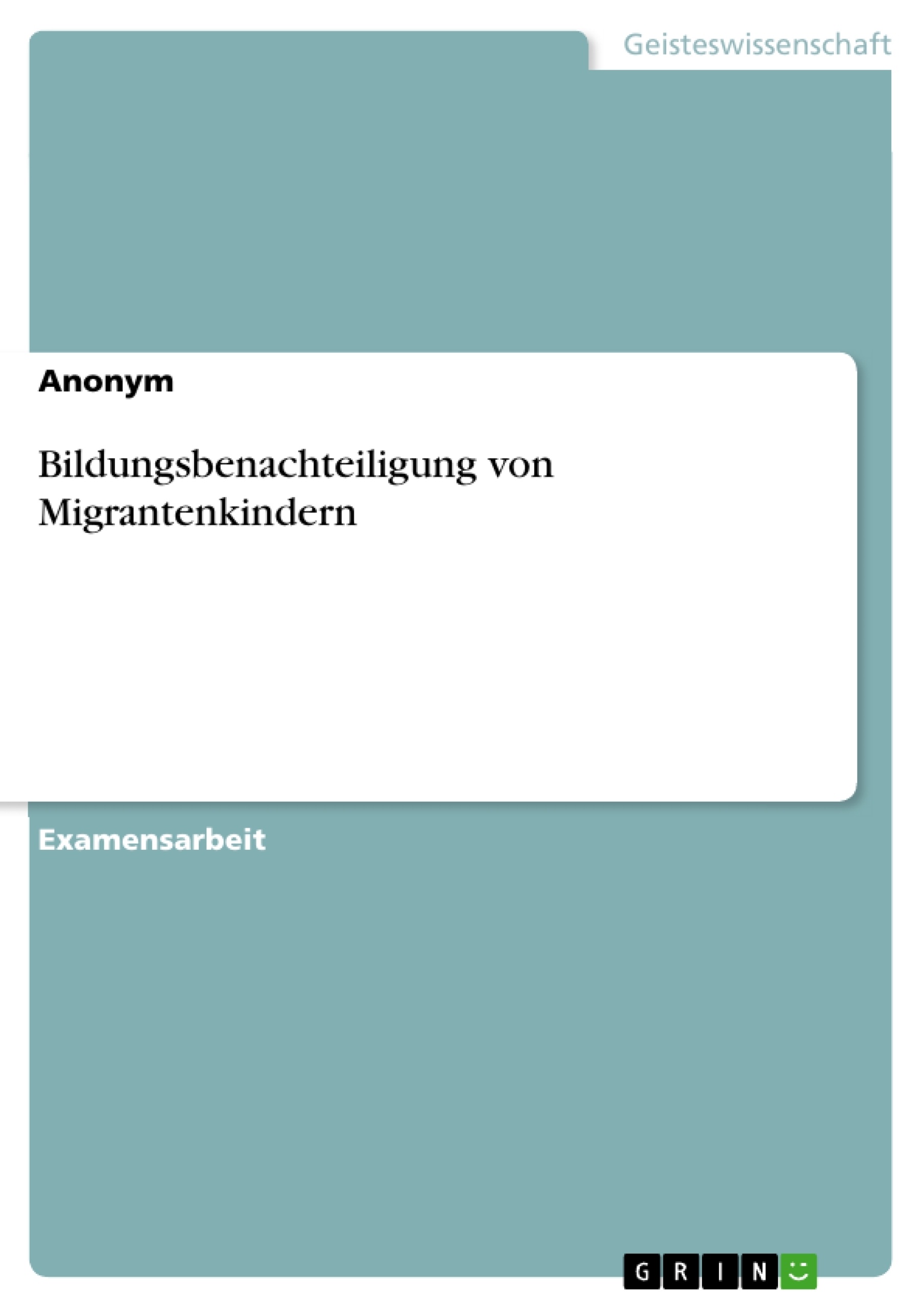Obwohl Ende der 1960er bereits 1,8 Millionen Ausländer in Deutschland lebten, gab es, mit Ausnahme der allgemeinen Schulpflicht für ausländische Kinder, keine bildungspolitischen Auseinandersetzungen mit dem Thema „Kinder von Migranten“. Alle Beteiligten, die Deutschen, die Herkunftsländer und die Betroffenen selbst, gingen davon aus, dass es sich bei den Zugewanderten um Gastarbeiter handelte, die nach einigen Arbeitsjahren in Deutschland in ihre Heimatländer zurückkehren würden.
Diese Auffassung hat sich heute grundlegend verändert. Denn was vor Jahren noch in Fachkreisen diskutiert wurde, ist heute Gewissheit: Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem Gastarbeiterland zu einem Einwanderungsland modernen Typs entwickelt!
Durch diese allmähliche Verwandlung steht Deutschland heute vor der Aufgabe, ihre multiethnische Bevölkerung in die Kerngesellschaft zu integrieren. Und dabei spielt ist Bildung eine zentrale Rolle:
„Wenn man gleiche Teilnahmechancen am Leben der Aufnahmegesellschaft als das Herzstück der Integration ansieht, dann stehen gleiche Bildungschancen im Zentrum der Integrationsprozesse. Bildung ist die zentrale Ressource für die Teilnahme am ökonomischen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben.
Nicht nur in der Politik und Wissenschaft, sondern auch in der breiten Bevölkerung werden kontroverse Diskussionen über den Umgang mit Bildung und Integration von Migrantenkindern in Deutschland geführt.
Die alarmierenden PISA-Studien (Programme for International Student Assessment) der letzten Jahre gossen noch zusätzlich Öl ins Feuer und führten zu zahlreichen vorschnellen Bildungsreformen.
Im Juli 2006 tagte der erste Integrationsgipfel mit Vertretern aus Politik, Medien, Wissenschaft und bürgerliche Organisationen. Dabei wurde die Erstellung eines Nationalen Integrationsplan (NIP) beschlossen. Kernziele des NIPs waren:
• die Verbesserung der Integrationskurse
• Förderung der deutschen Sprache
• Sicherung guter Bildung und Ausbildung.
Der Gipfel der Integrationsdebatte wurde im Jahr 2010 mit Sarrazins umstrittenem Buch „Deutschland schafft sich ab“ erreicht. In seinem Buch beschreibt Sarrazin, auf äußerst polemische Art und Weise die Folgen, die sich seiner Ansicht nach, für Deutschland aus der Kombination von Geburtenrückgang, wachsender Unterschicht und Zuwanderung ergeben.
Politiker und Wissenschaftler übten zwar harsche Kritik an Sarrazins Pseudowissenschaft und unterstellen ihm Rassismus und
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Gastarbeiter, Ausländer, Migrant, Ethnische Minderheit
- II.1 Begriffsproblematik: Vom Ausländer zur Ethnischen Minderheit
- II.2 Phasen der Auslanderpolitik
- II.3 Die Vielfalt der Minderheiten
- II.4 Bevölkerungsentwicklung und Soziallage von Migranten
- II.5 kurzer Exkurs: Ethnische Minderheiten in Ostdeutschland
- III. Wirkung und Ertrag von Bildung
- III.1 Bildung und Erwerbschancen
- III.2 Bildung und Einkommen
- III.3 Bildung und Gesundheit
- III.4 Individuelle Bildung als Nutzen für die Gesellschaft
- III.5 Zwischenfazit
- IV. Faktoren der Benachteiligung
- IV.1 Fremde Kultur
- IV.2 Deutsch als Fremdsprache
- IV.3 Doppelte Benachteiligung
- IV.3.1 Schichtspezifische Benachteiligung
- IV.3.2 Migrationsspezifische Benachteiligung
- IV.3.3 Doppelte Benachteiligung: Fazit
- IV.4 Leistungsunabhängiger sozialer Filter
- IV.5 Institutionelle Diskriminierung
- IV.6 Das deutsche Schulsystem
- IV.7 Zwischenfazit
- V. Migranten an deutschen Schulen
- VI. Schulleistungsstudien
- VI.1 Ergebnisse der IGLU-Studie 2006
- VI.2 Ergebnisse der PISA-Studien
- VI.3 Schulleistungsstudien: Zusammenfassung
- VII. Möglichkeiten zum Abbau der Bildungsdifferenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern in Deutschland. Ziel ist es, die Faktoren dieser Benachteiligung zu identifizieren und zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext der Migration nach Deutschland und die Entwicklung der Integrationspolitik.
- Begriffsbestimmung und historische Entwicklung der Migration in Deutschland
- Wirkung und Ertrag von Bildung für Migranten
- Faktoren der Bildungsbenachteiligung (soziale, kulturelle, institutionelle Aspekte)
- Ergebnisse von Schulleistungsstudien (IGLU, PISA)
- Möglichkeiten zum Abbau von Bildungsdifferenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert den Wandel Deutschlands von einem Gastarbeiterland zu einem Einwanderungsland und die Bedeutung von Bildung für die Integration von Migrantenkindern. Kapitel II beleuchtet die Begrifflichkeiten rund um Migration und die historische Entwicklung der deutschen Ausländerpolitik. Kapitel III untersucht den Zusammenhang zwischen Bildung und verschiedenen Lebensbereichen (Erwerbschancen, Einkommen, Gesundheit). Kapitel IV analysiert detailliert die Faktoren, die zur Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern beitragen, einschließlich kultureller Barrieren, Sprachproblemen und institutioneller Diskriminierung. Kapitel V fokussiert auf die Situation von Migrantenkindern an deutschen Schulen. Kapitel VI präsentiert die Ergebnisse relevanter Schulleistungsstudien wie IGLU und PISA, die die Bildungsbenachteiligung aufzeigen. Kapitel VII beschäftigt sich mit möglichen Ansätzen zur Reduzierung der Bildungsungleichheiten.
Schlüsselwörter
Bildungsbenachteiligung, Migrantenkinder, Integration, Schulleistungsstudien (IGLU, PISA), Ausländerpolitik, soziale Ungleichheit, kulturelle Barrieren, Sprachförderung, institutionelle Diskriminierung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Migrantenkinder im deutschen Bildungssystem benachteiligt?
Die Benachteiligung resultiert aus einer Kombination von Sprachbarrieren, schichtspezifischen Faktoren, kulturellen Unterschieden und institutioneller Diskriminierung innerhalb des Schulsystems.
Was bedeutet "institutionelle Diskriminierung" an Schulen?
Dies bezieht sich auf Strukturen und Abläufe im Bildungswesen, die Kinder aus Zuwandererfamilien unabhängig von ihrer individuellen Leistung benachteiligen können.
Welche Ergebnisse lieferten PISA und IGLU zur Situation von Migranten?
Diese Studien zeigten signifikante Leistungsdifferenzen zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund auf und verdeutlichten die starke Kopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland.
Was ist der Nationale Integrationsplan (NIP)?
Der 2006 beschlossene Plan zielt auf die Verbesserung von Integrationskursen, Sprachförderung und die Sicherung guter Bildung und Ausbildung für Zuwanderer ab.
Wie hat sich das Verständnis von Deutschland als Einwanderungsland gewandelt?
Früher ging man vom Konzept der "Gastarbeiter" aus, die zurückkehren würden. Heute ist anerkannt, dass Deutschland ein modernes Einwanderungsland ist, in dem Bildung der Schlüssel zur Integration ist.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187257