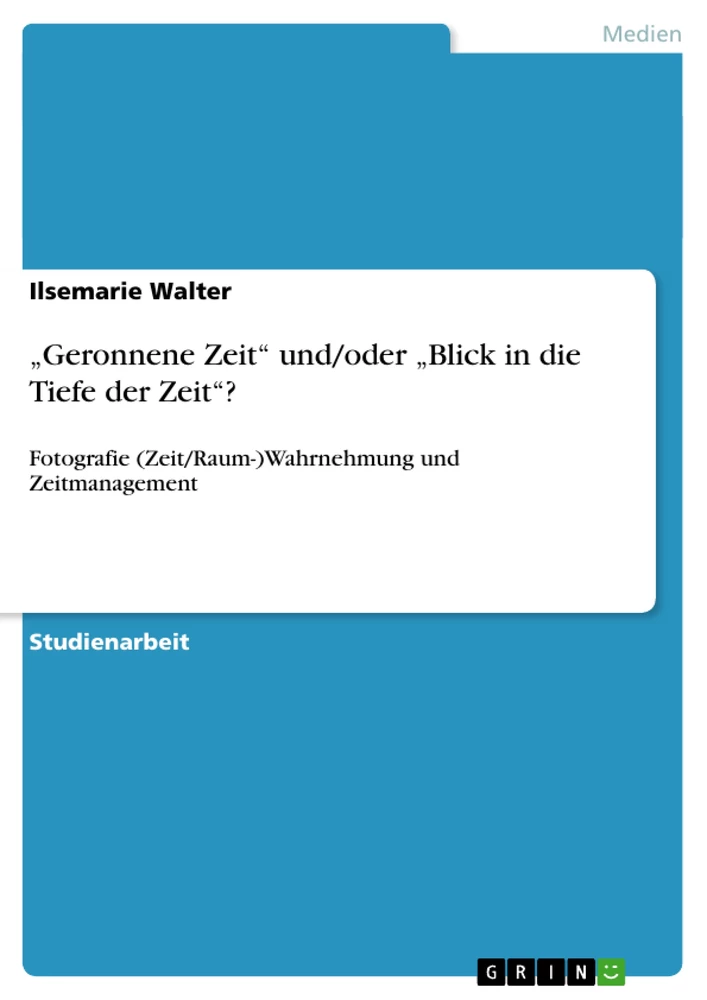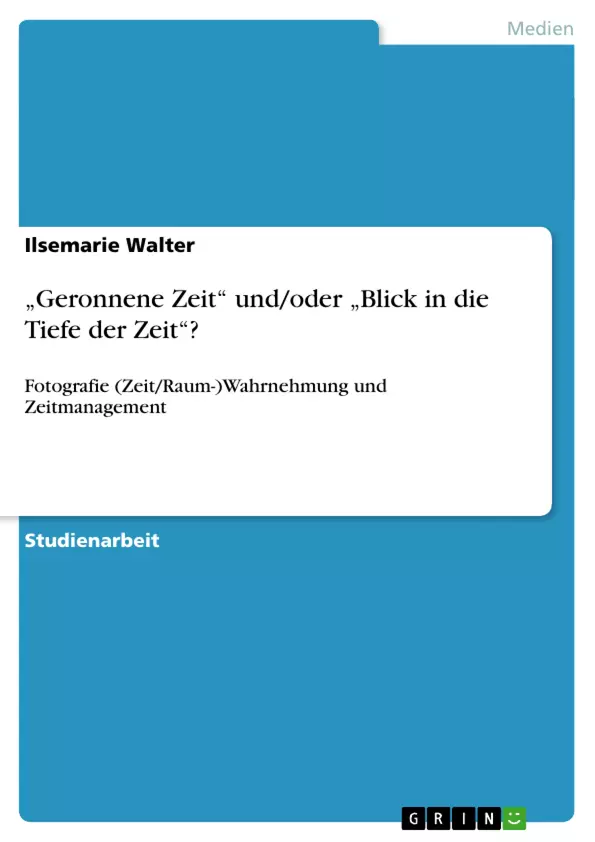Ausgehend von einer Aussage Kurt Weis’, mit dem Aufkommen der Fotografie habe eine ganz neue Codierung von Zeit begonnen, geht diese Arbeit der Frage nach, was diese Erfindung zu ihrer Zeit bedeutete und welche Veränderungen sie mit sich brachte.
Zur Erfindung der Fotografie mussten Kenntnisse aus zwei Wissenschaften kombiniert werden: aus der Physik/Optik zur Herstellung der Kamera und aus der Chemie zur Fixierung des Bildes. Die ersten Verfahren, die in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts entstanden, waren Positivverfahren, mit denen nur Unikate hergestellt werden konnten. Sie wurden in der zweiten Hälfte der 1850er Jahre von der Fotografie im engeren Sinn verdrängt, die mit einem Negativverfahren arbeitete und damit die Herstellung vieler Kopien ermöglichte. Die ersten Belichtungszeiten waren noch sehr lang. Erst ab Anfang der 1850er Jahre waren die technischen Voraussetzungen für die sogenannte „Momentaufnahme“ erfüllt. Während bisher hauptsächlich Portraits gemacht bzw. Architektur, Stilleben u. ähnl. abgebildet wurden, konnte sich nun auch die sogenannte „Dokumentarfotografie“ entwickeln. Die ersten ausführlichen Kriegsberichte erschienen aus dem Krimkrieg 1853 - 1856; später dann aus dem amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865). Eine äußerst wichtige Entwicklung stellten auch die systematischen Bewegungsstudien dar, die in den 1870er und 1880er Jahren begannen.
In der Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass die Fotografie und ganz besonders die Bewegungsaufnahmen die menschliche Wahrnehmung wesentlich verändert haben. Dabei wird verschieden argumentiert. Wo die Fotografie mit Gemälden oder Zeichnungen verglichen wird, herrschen negative Aussagen über die Fotografie vor. Die Fotografie gilt dann als etwas Erstarrtes, Totes, Unnatürliches, Unmenschliches, etwas, das nicht die „wirkliche Realität“ wiedergibt. Die Vertreter einer anderen Argumentationskette sind von der Entwicklung der neuen elektronischen Medien fasziniert und sehen darin eine fast unbeschränkte Verfügbarkeit über Zeit und Raum. Vergangenheit und Zukunft würden zu Gegenwart, die Zeit „schrumpfe“; mit der Fotografie habe diese Entwicklung begonnen. Andere wiederum betonen die große Möglichkeit der Meinungsbeeinflussung durch die Art der Darstellung und die Auswahl der Bilder. Jedenfalls hat die Erfindung der Fotografie wesentliche Veränderungen eingeleitet, die möglicherweise noch gar nicht abgeschlossen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Einige wichtige Daten aus der Geschichte der Fotografie
- Die Fotografie - eine Neucodierung der Zeit?
- Festhalten der Zeit
- Verfügbarkeit über Zeit und Raum
- Kybernetische Struktur
- „Sichtbarmachen des Unsichtbaren“
- Beliebige Reproduzierbarkeit
- Fotografie, Zeit und Wahrnehmung
- Belichtungszeiten und „Momentaufnahmen“
- Bewegungsaufnahmen - der „Blick in die Tiefe der Zeit“
- Gilbreth - die Fotografie im Dienste des Zeitmanagements
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Erfindung der Fotografie auf das Zeitverständnis und das Zeitmanagement. Sie beleuchtet die Frage, inwiefern die Fotografie eine "neue Codierung von Zeit" darstellt und welche Veränderungen der Wahrnehmung sie hervorgerufen hat. Die Rezeption der Fotografie durch Zeitgenossen und deren Auffassung im Kontext des Zeitkonzepts werden ebenfalls analysiert.
- Die Fotografie als neue Codierung von Zeit
- Veränderungen der Wahrnehmung durch die Fotografie
- Einfluss der Fotografie auf das Zeitmanagement
- Historische Entwicklung der Fotografie und ihre technischen Aspekte
- Die Camera Obscura und ihre Bedeutung für die Fotografie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Arbeit wird durch ein Zitat von Kurt Weis eingeleitet, das die Fotografie als eine "ganz neue Codierung von Zeit" beschreibt. Die Autorin hinterfragt diese Aussage und untersucht den Einfluss der Fotografie auf das Zeitverständnis, die Wahrnehmung und das Zeitmanagement. Sie definiert den Begriff Fotografie für den Kontext der Arbeit und skizziert die methodische Vorgehensweise. Die Unschärfe der Grenzen der Fotografie im Hinblick auf Vorläufertechniken und spätere Entwicklungen wird angesprochen und eine Abgrenzung gegenüber dem Medium Film wird angedeutet.
2. Einige wichtige Daten aus der Geschichte der Fotografie: Dieses Kapitel gibt einen knappen Überblick über die Geschichte der Fotografie von ihrer Erfindung 1839 bis zur Jahrhundertwende. Es werden die notwendigen Kenntnisse aus Physik/Optik und Chemie hervorgehoben und das Prinzip der Camera Obscura erläutert. Die Entwicklungen um die Heliographie von Nicéphore Niépce und die Daguerreotypie von Louis Jacques Mandé Daguerre werden beschrieben, wobei die komplexe Geschichte der Erfindung und die verschiedenen Verfahren beleuchtet werden. Die Kapitel beschreibt auch den gesellschaftlichen Kontext des aufkommenden Bürgertums und den Wunsch nach Bildreproduktionen als Triebfeder der Erfindung.
3. Die Fotografie - eine Neucodierung der Zeit?: Dieses Kapitel widmet sich der zentralen These der Arbeit: die Fotografie als eine "neue Codierung der Zeit". Es werden verschiedene Aspekte der Fotografie im Verhältnis zur Zeit beleuchtet, wie das "Festhalten der Zeit", die "Verfügbarkeit über Zeit und Raum", die "kybernetische Struktur" des Mediums, das "Sichtbarmachen des Unsichtbaren" und die "beliebige Reproduzierbarkeit". Durch eine eingehende Analyse dieser Punkte wird die These der Neucodierung von Zeit im Detail untersucht, aber ohne eine abschließende Bewertung abzugeben.
4. Fotografie, Zeit und Wahrnehmung: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf dem wechselseitigen Verhältnis zwischen Fotografie, Zeit und Wahrnehmung. Die Autorin untersucht die Rolle von Belichtungszeiten bei der Schaffung von „Momentaufnahmen“ und die Möglichkeiten, Bewegung durch „Bewegungsaufnahmen“ und den „Blick in die Tiefe der Zeit“ darzustellen. Die Analyse konzentriert sich auf die Auswirkungen der Fotografie auf unsere Wahrnehmung von Zeit und Raum durch die Möglichkeit, flüchtige Momente festzuhalten und Zeitabläufe darzustellen.
5. Gilbreth - die Fotografie im Dienste des Zeitmanagements: Dieses Kapitel behandelt den Einsatz der Fotografie im Bereich des Zeitmanagements, wobei die Arbeit von Frank und Lillian Gilbreth im Zentrum steht. Es wird untersucht, wie die Fotografie dazu verwendet wurde, Arbeitsprozesse zu analysieren und zu optimieren, um die Effizienz zu steigern. Das Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen der Fotografie als Werkzeug und der Entwicklung wissenschaftlicher Methoden des Zeitmanagements. Der Fokus liegt auf der Anwendung der Fotografie als Instrument zur Zeitmessung und -optimierung in der Arbeitswelt.
Schlüsselwörter
Fotografie, Zeit, Wahrnehmung, Zeitmanagement, Camera obscura, Daguerreotypie, Heliographie, Neucodierung der Zeit, Momentaufnahme, Bewegungsaufnahme, Gilbreth.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Fotografie und Zeit
Was ist der Hauptgegenstand des Textes?
Der Text untersucht den Einfluss der Erfindung der Fotografie auf unser Zeitverständnis und das Zeitmanagement. Er analysiert, inwiefern die Fotografie eine "neue Codierung von Zeit" darstellt und welche Veränderungen der Wahrnehmung sie hervorgerufen hat. Die Rezeption der Fotografie durch Zeitgenossen und deren Auffassung im Kontext des Zeitkonzepts werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Fotografie als neue Codierung von Zeit, Veränderungen der Wahrnehmung durch die Fotografie, den Einfluss der Fotografie auf das Zeitmanagement, die historische Entwicklung der Fotografie und ihre technischen Aspekte (einschließlich Camera Obscura, Heliographie und Daguerreotypie), sowie die Anwendung der Fotografie im wissenschaftlichen Zeitmanagement (am Beispiel der Gilbreths).
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es jeweils?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Eine Einleitung, die die zentrale These und die methodische Vorgehensweise beschreibt; ein Kapitel zur Geschichte der Fotografie; ein Kapitel zur Fotografie als Neucodierung der Zeit; ein Kapitel zum Verhältnis von Fotografie, Zeit und Wahrnehmung (Belichtungszeiten, Momentaufnahmen, Bewegungsaufnahmen); ein Kapitel zur Anwendung der Fotografie im Zeitmanagement durch Frank und Lillian Gilbreth; und abschließend eine Zusammenfassung.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für den Text?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Fotografie, Zeit, Wahrnehmung, Zeitmanagement, Camera obscura, Daguerreotypie, Heliographie, Neucodierung der Zeit, Momentaufnahme, Bewegungsaufnahme und Gilbreth.
Welche These wird im Text vertreten?
Die zentrale These des Textes ist, dass die Erfindung der Fotografie eine "neue Codierung von Zeit" darstellt und unser Verständnis und unsere Wahrnehmung von Zeit maßgeblich beeinflusst hat.
Wie wird die These des Textes begründet?
Die These wird durch die Analyse verschiedener Aspekte der Fotografie begründet, wie z.B. das Festhalten von Zeitpunkten, die Verfügbarkeit über Zeit und Raum durch Fotos, die kybernetische Struktur des Mediums, das Sichtbarmachen des Unsichtbaren und die beliebige Reproduzierbarkeit. Der Text untersucht zudem den Einfluss der Fotografie auf die Wahrnehmung von Zeit und Raum sowie ihre Anwendung im wissenschaftlichen Zeitmanagement.
Wer sind Frank und Lillian Gilbreth und welche Rolle spielen sie im Text?
Frank und Lillian Gilbreth werden als Beispiel für den Einsatz der Fotografie im Zeitmanagement vorgestellt. Der Text beschreibt, wie sie die Fotografie nutzten, um Arbeitsprozesse zu analysieren und zu optimieren.
Welche Bedeutung hat die Camera Obscura im Kontext des Textes?
Die Camera Obscura wird als ein wichtiger Vorläufer der Fotografie beschrieben und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Mediums hervorgehoben.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für Leser gedacht, die sich akademisch mit dem Einfluss der Fotografie auf unser Zeitverständnis und Zeitmanagement auseinandersetzen möchten.
- Quote paper
- Ilsemarie Walter (Author), 1999, „Geronnene Zeit“ und/oder „Blick in die Tiefe der Zeit“? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18737