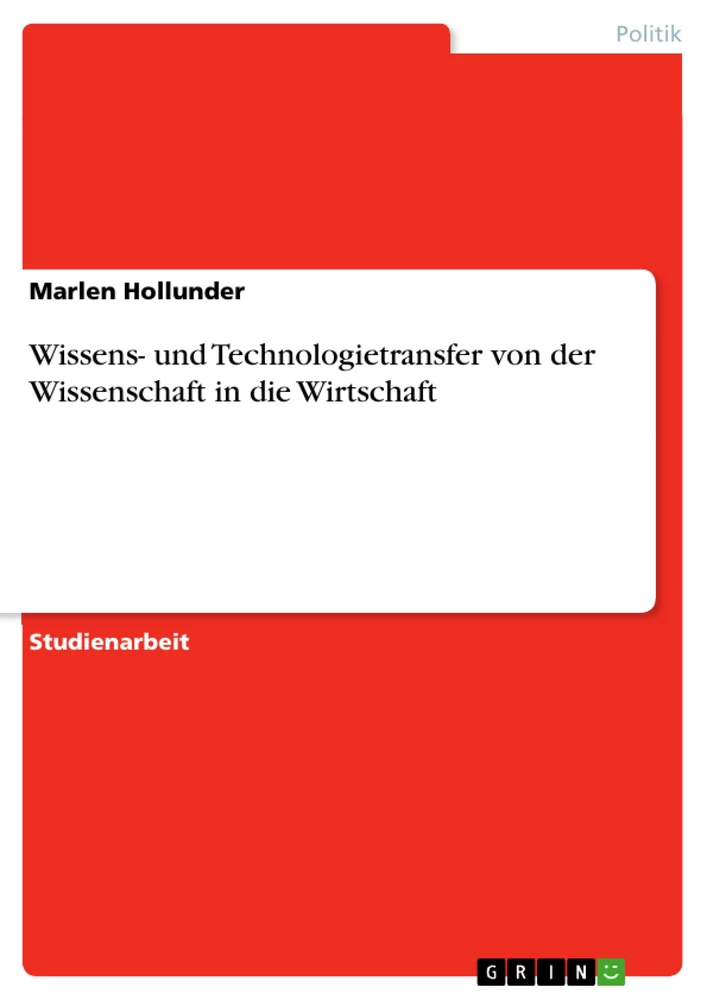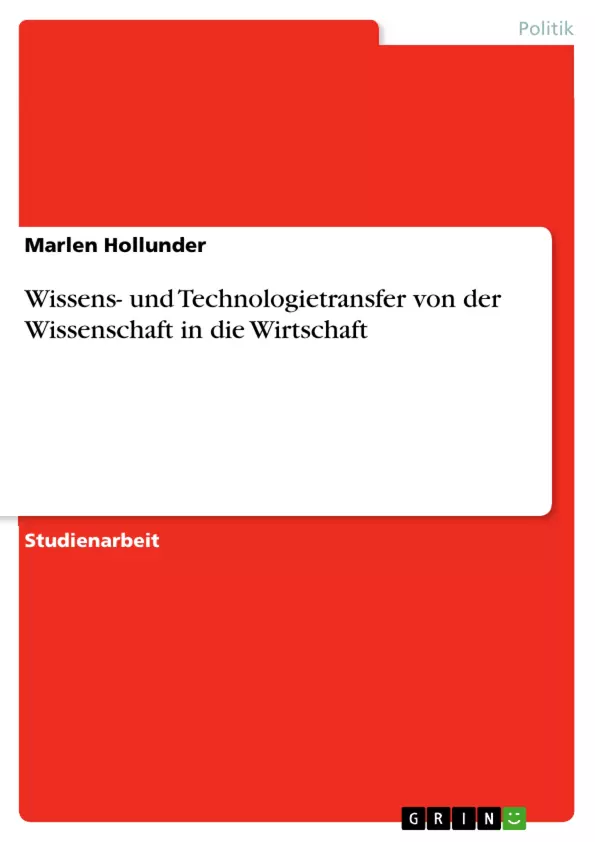Der Wissens- und Technologietransfer hat seit Ende der 1970er Jahre eine wachsende Bedeutsamkeit erlangt. Er ist nicht erst seitdem ein existierendes Konstrukt, denn bereits seit mehr als 130 Jahren wurde z.B. Gottlieb Daimler mit dem Auftrag nach Paris gesandt, sich eine neue Entwicklung des Gasmotors anzusehen. Diese Idee, welche er als überzeugend empfand, nahm er mit nach Hause und entwickelte daraus einen neuen Motor. Somit sieht man, dass der Wissens- und Technologietransfer schon in den vergangenen Jahrhunderten eine große Rolle spielte. Die Wirtschaft beschäftigt sich jedoch erst seit den letzten zwei Jahrzehnten mit den Problembereichen.
In der vorliegenden Arbeit bildet der Transfer des Wissens und der Technologie zwischen Wissenschaft und Wirtschaft den Untersuchungsgegenstand.
Gerade in den letzten Jahren hat der Wissens- und Technologietransfer immer stärker an Bedeutung gewonnen. Von Seiten der Politik wird das Bedürfnis nach einer stärkeren Verwertung und Anwendung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse immer größer. In Deutschland und auch im Ruhrgebiet wurden, zur Stärkung des Wissens-, Forschungs- und Technologietransfers, in den letzten Jahren eine Vielzahl von Initiativen ins Leben gerufen. Doch der Wissens- und Technologietransfer kann nur so wirksam sein, wie die Rahmenbedingungen, in denen er eingesetzt wird. Daher ist es wichtig festzustellen, dass es nicht nur um die Häufigkeit der Nutzung der Instrumente Wissens- und Technologietransfer geht, sondern dass das Innovationssystem als Einheit betrachtet wird. In der Praxis erwies sich die Überführung von Wissen und Technologie von der Wissenschaft in die Wirtschaft und in umgekehrter Richtung als Kernproblem, welches es zu lösen gilt. In dieser Arbeit wird das Ziel verfolgt, einen Überblick über die verschiedenen Transferarten zu geben und auf die bisher bestehenden Probleme und Hemmnisse bei Unternehmen und Hochschulen einzugehen. Vor allem möchte ich aufzeigen, was jede Partei, die an einer solchen Kooperation beteiligt ist, zu seiner Verbesserung beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretisches Verständnis des Wissenstransfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
- Wissen
- Technologie
- Wissenstransfer, Technologietransfer
- Wege und Formen des Wissenstransfers zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen und Wirtschaft
- Kooperative Forschung
- Gemeinsame Forschungseinrichtungen
- Spin-offs
- Hemmnisse für effektive Interaktion
- Handlungsempfehlungen für einen verbesserten Wissenstransfer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wissen- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Ziel ist es, einen Überblick über verschiedene Transferarten zu geben und bestehende Probleme und Hemmnisse bei Unternehmen und Hochschulen zu beleuchten. Die Arbeit zeigt auf, wie alle beteiligten Parteien zu einer Verbesserung des Wissenstransfers beitragen können.
- Definition und Kategorisierung von Wissen (explizit vs. implizit)
- Definition und Abgrenzung von Technologie im Kontext von Wissen
- Wege und Formen des Wissenstransfers (Kooperationen, gemeinsame Einrichtungen, Spin-offs)
- Hemmnisse des effektiven Wissenstransfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
- Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des Wissenstransfers
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Wissens- und Technologietransfer wird als Untersuchungsgegenstand eingeführt und seine wachsende Bedeutung hervorgehoben. Es wird auf die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung des Innovationssystems hingewiesen.
Theoretisches Verständnis des Wissenstransfers: Die Begriffe Wissen (explizit und implizit), Technologie und der Transferprozess selbst werden definiert und voneinander abgegrenzt. Der Wissenstransfer wird als Oberbegriff zum Technologietransfer erklärt.
Wege und Formen des Wissenstransfers: Verschiedene Wege des Wissenstransfers zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft werden vorgestellt, darunter kooperative Forschung, gemeinsame Forschungseinrichtungen und Spin-offs.
Schlüsselwörter
Wissenstransfer, Technologietransfer, Wissen, Technologie, explizites Wissen, implizites Wissen, Kooperation, Forschung, Innovation, öffentliche Forschungseinrichtungen, Wirtschaft, Hemmnisse, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen explizitem und implizitem Wissen?
Explizites Wissen ist dokumentierbar und leicht übertragbar, während implizites Wissen ("Können") an Personen gebunden und schwerer zu vermitteln ist.
Welche Wege des Wissenstransfers gibt es?
Zu den wichtigsten Formen gehören kooperative Forschung, gemeinsame Forschungseinrichtungen und die Gründung von Spin-offs aus der Wissenschaft.
Welche Hemmnisse gibt es beim Transfer zwischen Hochschule und Wirtschaft?
Probleme entstehen oft durch unterschiedliche Zielsetzungen, Zeithorizonte oder kulturelle Unterschiede zwischen akademischer Forschung und unternehmerischer Praxis.
Warum ist der Technologietransfer für Deutschland so wichtig?
Die Politik strebt eine stärkere Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse an, um die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu sichern.
Wie kann der Wissenstransfer verbessert werden?
Die Arbeit gibt Handlungsempfehlungen, wie Rahmenbedingungen optimiert und die Interaktion zwischen Forschern und Unternehmen effektiver gestaltet werden kann.
- Quote paper
- Marlen Hollunder (Author), 2011, Wissens- und Technologietransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187450