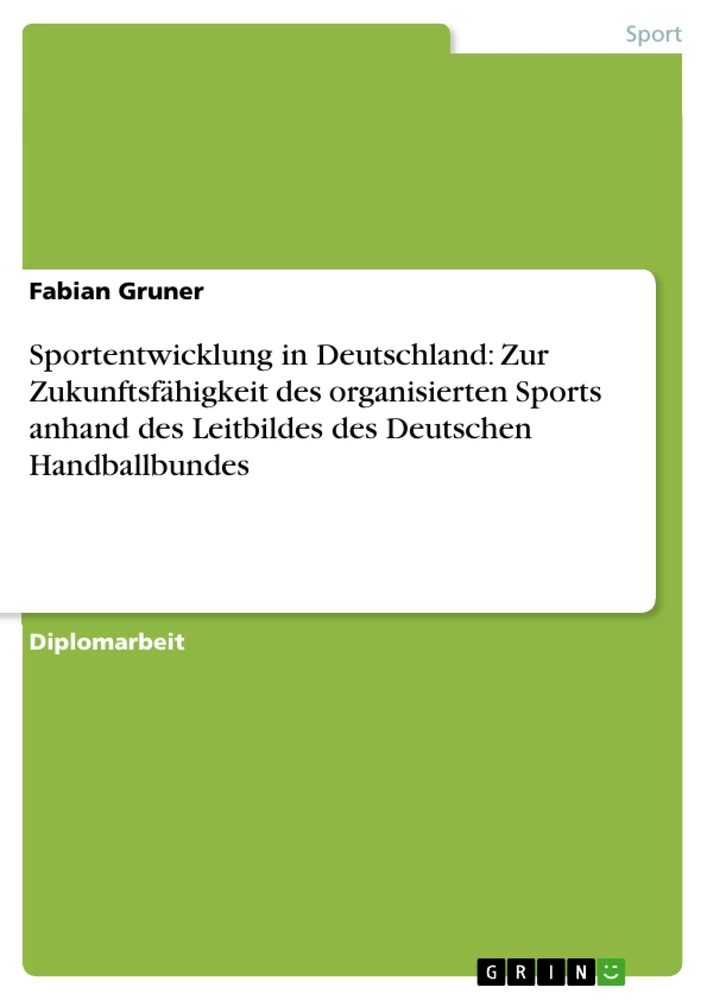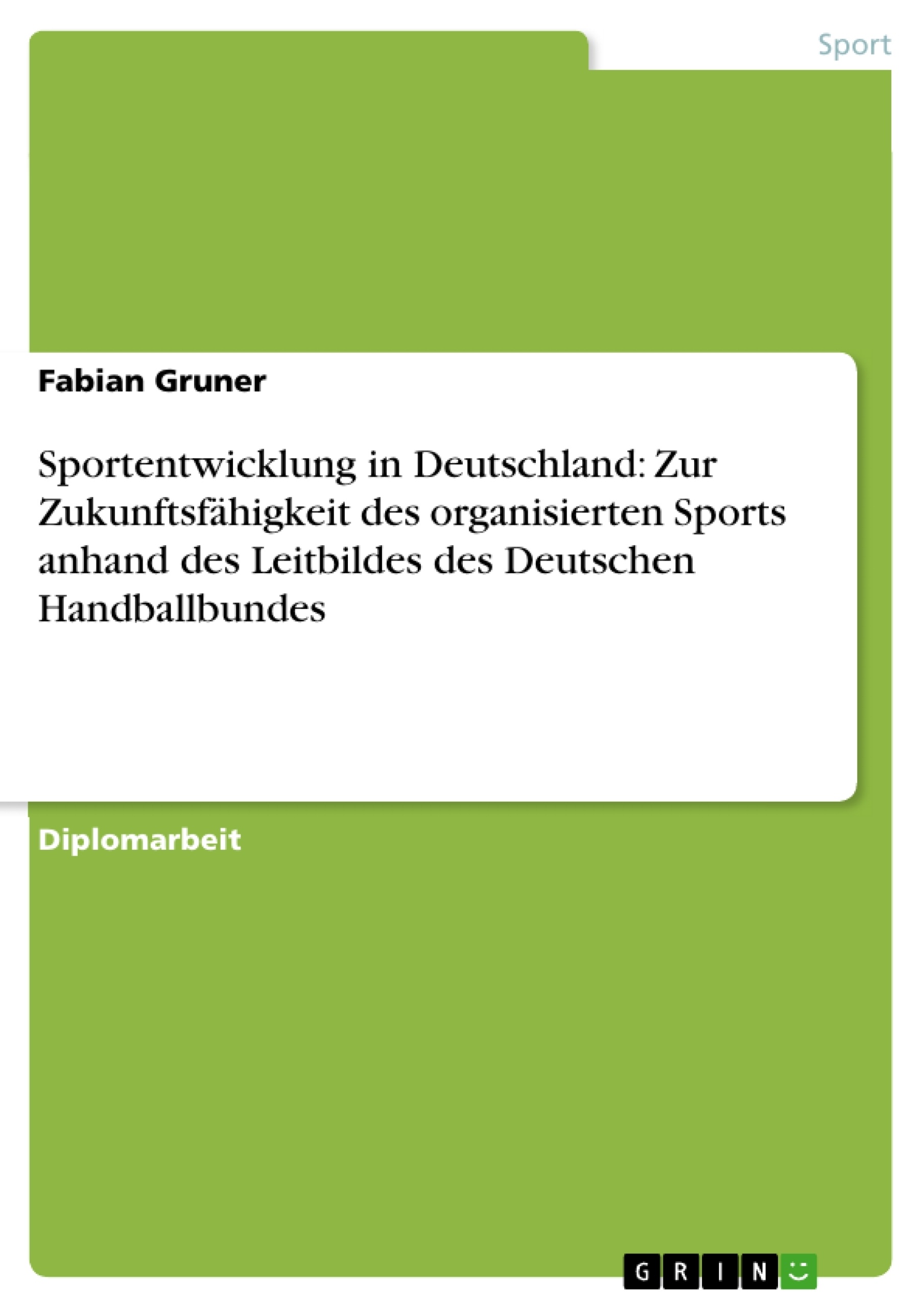Der Sport hat heute eine große Bedeutung für die Gesellschaft und ist fester Bestandteil unseres Alltags. Sport ist dabei "weder etwas Natürliches noch etwas Unveränderliches" (Digel & Thiel, 2009, S. 19), er unterliegt einem stetigen Wandel und kann demnach auch nicht unabhängig von gesellschaftlichen Entwicklungen betrachtet werden. Somit werden auch die Akteure des organisierten Sports wie Vereine und Verbände immer öfter mit dem gesellschaftlichen und sozialen Wandel konfrontiert. Der demographische Wandel und seine Konsequenzen führen zu veränderter Sportnachfrage, zukünftig werden immer weniger Kinder- und Jugendliche Sport treiben und dafür mehr Ältere sportlich aktiv sein. Weiter zu beobachten ist eine Differenzierung des Sportsystems, welches sich in vielfältige Organisationsformen mit unterschiedlichen Funktionen und Zielen aufgesplittert hat. Pluralisierungstendenzen führen zum Verlust eines eindeutigen Sportverständnisses, neben den organisierten Wettkampfsport treten zahheiche Sportformen und -arten mit unterschiedliehen Wert- und Handlungsmustern. Der gesamtgesellschaftliche Prozess der Individualisierung führt zu einer immer häufiger werdenden Selbstorganisation im Sport, d. h. Sporttreiben außerhalb von Organisationen ist immer populärer. Zunehmend treten neben dem wettkampforientierten Sport neue Motive und Sinnmuster für das Sporttreiben, wie Körper- und Gesundheitsbewusstsein, Erlebnis, Selbstverwirklichung oder Spaß in den Vordergrund.
Dies drückt sich besonders auch in der wachsenden Anzahl von kommerziellen Anbietern aus, die gesundheits- und ttendsportorientierte Angebote unterbreiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Fragestellung und Aufbau der Arbeit
- 1.2 Methoden
- 2 Sport und Gesellschaft – Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Gesellschaftliche Bedeutung und Strukturmerkmale des Sports
- 2.1.1 Sinn und Strukturmerkmale des Sports
- 2.1.2 Soziale und kulturelle Bedeutung des Sports
- 2.2 Sportentwicklung als neueres Forschungsfeld
- 2.2.1 Forschungsstand
- 2.2.2 Begriffliche Annäherungen
- 2.2.3 Ansätze der Sportentwicklungsplanung
- 3 Der organisierte Sport in Deutschland
- 3.1 Der organisierte Sport in Deutschland
- 3.1.1 Historische Entwicklung
- 3.1.2 Sportvereine – Strukturmerkmale, Funktion, Bedeutung
- 3.1.3 Sportverbände – System, Organisationsstruktur, Aufgaben
- 3.2 Sozialer Wandel des Sports
- 3.2.1 Differenzierung, Individualisierung und Pluralisierung im Sport
- 3.2.2 Alternative Sportformen, Trendsport und Freizeitsport
- 3.2.3 Gesundheit als Sinnmuster im Sport
- 3.2.4 Soziale Disparitäten im Sportverhalten
- 3.2.5 Integration im und durch Sport
- 3.2.6 Geschlechterdisparitäten
- 3.3 Demographischer Wandel
- 3.4 Kommerzialisierung und Professionalisierung im Sport
- 3.5 „Trends“ – markante Entwicklungen zur Leitbildbewertung
- 4 Handball
- 4.1 Handball heute
- 4.2 Historische Entwicklungen
- 4.3 Zur Struktur und Funktion der Sportart Handball
- 4.3.1 Handball – ein organisierter Wettkampf- und Leistungssport
- 4.3.2 Nutzergruppen- und Interessentenstruktur
- 4.3.3 Bewegungsformen, sportliche Handlungen und Training
- 4.3.4 Akteursbeziehungen – Handball ein Mannschaftssport
- 4.3.5 Räumliche und zeitliche Struktur
- 4.3.6 Regeln und Normierung
- 4.3.7 Struktur des Habitus und des Selbstbildes von Handballern
- 4.4 Handball als Event- und Trendsport - neuere Entwicklungen
- 4.4.1 Professionalisierung, Management, Vermarktung, Event
- 4.4.2 Handball als Trendsport: Beachhandball
- 5 „Wir nehmen die Zukunft in die Hand“ – Das Leitbild des Deutschen Handballbundes (2008)
- 5.1 Leitbildentwicklung als Instrument der Sportentwicklung
- 5.2 Analyse des DHB-Leitbildes
- 5.2.1 Entstehung des Leitbildes
- 5.2.2 Aufbau des Leitbildes
- 5.2.3 Selbstverständnis und Ziele
- 5.2.4 Relevante Trends der Sportentwicklung im Leitbild
- 5.3 Handball - ein zukunftsfähiger Sport?
- 5.3.1 Ergebnisse der Leitbildanalyse
- 5.3.2 Schlussfolgerungen für die Zukunft: ein „Handballsport für viele“
- 6 Zukunftsfähigkeit des organisierten Sports – welchen Beitrag kann Sportwissenschaft leisten?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zukunftsfähigkeit des organisierten Sports in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf den Handball. Ziel ist es, die Herausforderungen des sozialen Wandels für den organisierten Sport zu analysieren und Handlungsalternativen für eine zukunftsfähige Entwicklung aufzuzeigen. Die Arbeit fokussiert sich auf die Sportart Handball als Beispiel für einen traditionellen Wettkampfsport, der sich den gesellschaftlichen Veränderungen stellen muss.
- Einfluss des sozialen Wandels auf den organisierten Sport
- Analyse der Herausforderungen und Chancen für den organisierten Sport
- Sportentwicklungsplanung und Leitbilder als Instrumente zur Zukunftsgestaltung
- Der Handballsport als Fallbeispiel: Tradition und Innovation
- Beitrag der Sportwissenschaft zur Zukunftsfähigkeit des organisierten Sports
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Sportentwicklung in Deutschland ein und beleuchtet die Bedeutung des Sports in der Gesellschaft. Sie hebt den Wandel des Sports und die damit verbundenen Herausforderungen für den organisierten Sport hervor, insbesondere den demografischen Wandel, die zunehmende Differenzierung und Individualisierung sowie die Kommerzialisierung. Der Verlust des Anbietermonopols durch den organisierten Sport wird beschrieben, und die Notwendigkeit einer Anpassung an gesellschaftliche Bedürfnisse wird betont. Die Arbeit konzentriert sich auf den Handball als Fallbeispiel und stellt die Forschungsfrage nach dessen Zukunftsfähigkeit.
2 Sport und Gesellschaft – Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen der Arbeit. Es beleuchtet die gesellschaftliche Bedeutung und die Strukturmerkmale des Sports, den Forschungsstand zur Sportentwicklung sowie verschiedene Ansätze der Sportentwicklungsplanung. Es analysiert den Sport als dynamischen gesellschaftlichen Faktor und skizziert die Relevanz von soziologischen Perspektiven für das Verständnis von Sportentwicklungsprozessen.
3 Der organisierte Sport in Deutschland: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über den organisierten Sport in Deutschland. Es behandelt die historische Entwicklung, die Strukturmerkmale von Sportvereinen und -verbänden, den sozialen Wandel mit seinen Aspekten wie Differenzierung, Individualisierung, Pluralisierung, den Einfluss von Gesundheitstrends sowie soziale und geschlechtsspezifische Disparitäten. Der demografische Wandel und die Kommerzialisierung des Sports werden als wichtige Einflussfaktoren analysiert, um den Kontext für die Leitbildanalyse im folgenden Kapitel zu schaffen.
4 Handball: Dieses Kapitel fokussiert auf den Handball als Fallbeispiel. Es beleuchtet die aktuelle Situation des Handballsports, seine historische Entwicklung und seine Strukturmerkmale als organisierter Wettkampf- und Leistungssport. Es analysiert die Nutzergruppenstruktur, die Bewegungsformen, Akteursbeziehungen, räumliche und zeitliche Strukturen, Regeln und Normierungen sowie den Habitus und das Selbstbild von Handballern. Neue Entwicklungen, wie die zunehmende Kommerzialisierung und die Entstehung von Trendsportarten wie Beachhandball werden ebenso berücksichtigt.
5 „Wir nehmen die Zukunft in die Hand“ – Das Leitbild des Deutschen Handballbundes (2008): Dieses Kapitel analysiert das Leitbild des Deutschen Handballbundes (DHB) als Instrument der Sportentwicklung. Es untersucht die Entstehung, den Aufbau, das Selbstverständnis und die Ziele des Leitbildes sowie die im Leitbild berücksichtigten Trends der Sportentwicklung. Die Analyse dient der Bewertung der Zukunftsfähigkeit des Handballsports im Kontext der zuvor beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen.
Schlüsselwörter
Sportentwicklung, organisierter Sport, Handball, sozialer Wandel, Demographischer Wandel, Kommerzialisierung, Professionalisierung, Leitbild, Zukunftsfähigkeit, Sportentwicklungsplanung, Vereine, Verbände, Integration, Individualisierung, Pluralisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Zukunftsfähigkeit des organisierten Sports in Deutschland am Beispiel Handball
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Zukunftsfähigkeit des organisierten Sports in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf den Handball. Sie analysiert die Herausforderungen des sozialen Wandels für den organisierten Sport und zeigt Handlungsalternativen für eine zukunftsfähige Entwicklung auf.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative und deskriptive Methode. Sie basiert auf einer Literaturanalyse, einer Analyse des Leitbildes des Deutschen Handballbundes und einer Diskussion der relevanten soziologischen und sportwissenschaftlichen Theorien. Der Handball dient als Fallbeispiel für eine empirische Analyse.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Einfluss des sozialen Wandels (Demographie, Individualisierung, Kommerzialisierung) auf den organisierten Sport; die Herausforderungen und Chancen für den organisierten Sport; Sportentwicklungsplanung und Leitbilder als Instrumente zur Zukunftsgestaltung; den Handballsport als Fallbeispiel (Tradition und Innovation); und den Beitrag der Sportwissenschaft zur Zukunftsfähigkeit des organisierten Sports.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Sport und Gesellschaft – Theoretischer Hintergrund, Der organisierte Sport in Deutschland, Handball, „Wir nehmen die Zukunft in die Hand“ – Das Leitbild des Deutschen Handballbundes (2008), und Zukunftsfähigkeit des organisierten Sports – welchen Beitrag kann Sportwissenschaft leisten? Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Forschungsfrage.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Herausforderungen des sozialen Wandels für den organisierten Sport zu analysieren und Handlungsalternativen für eine zukunftsfähige Entwicklung aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf der Sportart Handball als Beispiel für einen traditionellen Wettkampfsport.
Welche Rolle spielt der Handball in dieser Arbeit?
Der Handball dient als Fallbeispiel, um die generellen Herausforderungen und Chancen des organisierten Sports im Kontext des sozialen Wandels zu illustrieren. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung, die Struktur und Funktion des Handballsports sowie dessen Anpassung an aktuelle gesellschaftliche Trends (z.B. Kommerzialisierung, Trendsportarten).
Wie wird das Leitbild des Deutschen Handballbundes (DHB) analysiert?
Das Leitbild des DHB wird als Instrument der Sportentwicklung analysiert. Die Analyse umfasst die Entstehung, den Aufbau, das Selbstverständnis und die Ziele des Leitbildes sowie die darin berücksichtigten Trends der Sportentwicklung. Die Ergebnisse dienen der Bewertung der Zukunftsfähigkeit des Handballsports.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Zukunftsfähigkeit des organisierten Sports und des Handballsports im Besonderen. Sie diskutiert den Beitrag der Sportwissenschaft zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Sportlandschaft und schlägt Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Entwicklung des organisierten Sports vor.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sportentwicklung, organisierter Sport, Handball, sozialer Wandel, demografischer Wandel, Kommerzialisierung, Professionalisierung, Leitbild, Zukunftsfähigkeit, Sportentwicklungsplanung, Vereine, Verbände, Integration, Individualisierung, Pluralisierung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Sportwissenschaftler, Sportmanager, Verantwortliche im organisierten Sport, Handballvereine und -verbände sowie alle, die sich für die Entwicklung des Sports und die Herausforderungen des sozialen Wandels im Sport interessieren.
- Citation du texte
- Fabian Gruner (Auteur), 2010, Sportentwicklung in Deutschland: Zur Zukunftsfähigkeit des organisierten Sports anhand des Leitbildes des Deutschen Handballbundes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187526