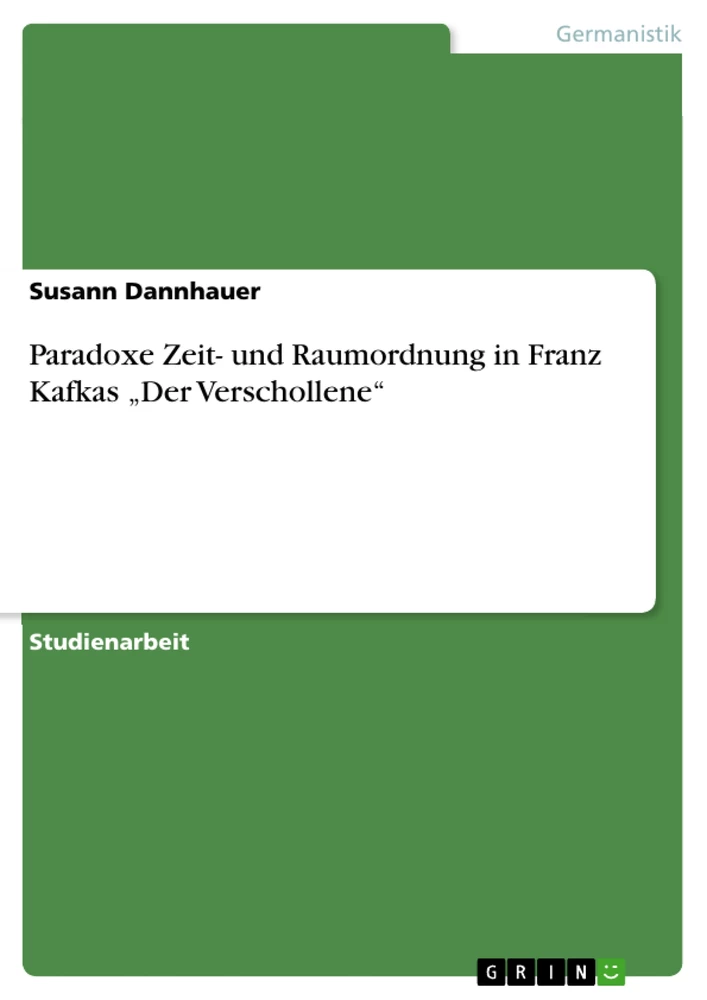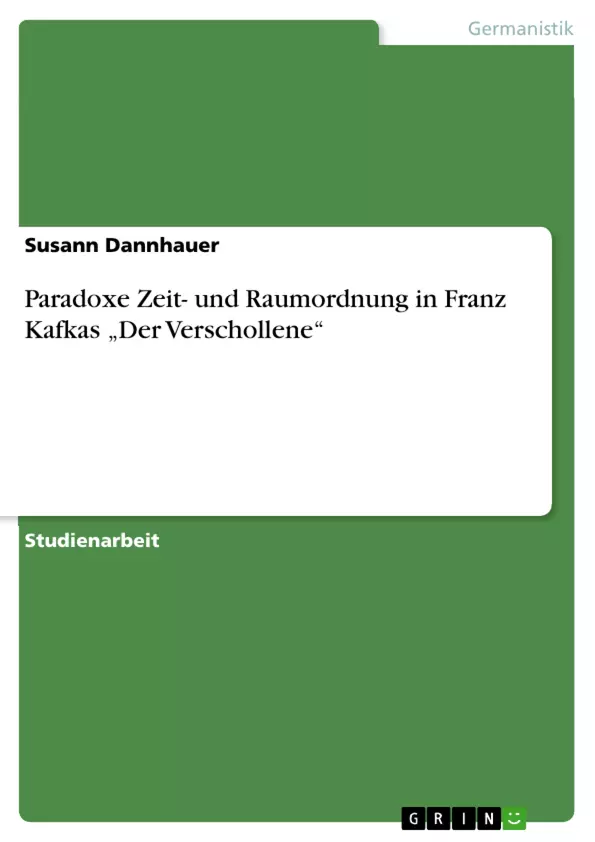Verschollenheitsgesetz [...]
Durch diesen Gesetzesauszug wird sehr deutlich, dass es anscheinend in der Bedeu-tung des Begriffes liegt, dass eine Person nur durch eine andere als verschollen er-klärt werden kann. Bezieht man den von Kafka, seiner Tagebucheinträge zufolge, gewählten Titel nun auf Karl Roßmann, die Hauptperson des Romans „Der Ver-schollene“, wird schnell klar, dass sich dieser zwar getrennt von seiner Familie in Amerika befindet, für den Leser jedoch bis zum Ende gegenwärtig und in seinen Taten verfolgbar bleibt. Kafka spielt also auf eine besondere Weise mit dem Begriff der Verschollenheit, der ausschließlich im Titel des Romans Erwähnung findet. Die Figur Roßmann befindet sich immerfort in einem Zwischenzustand und kann selbst vom Leser am Ende weder als tot, noch als lebendig erklärt werden, weil sein Reise-ziel zwar bekannt ist, jedoch innerhalb des Romans nicht erreicht wird. Dennoch bleibt es ein paradoxes Verfahren, einen stetig Anwesenden als Verschollenen zu bezeichnen. Genau aber mit jenen paradoxen Schreibverfahren Kafkas soll sich diese Arbeit ein Stück weit auseinander setzen, denn Kafka setzt seinen Hauptcharakter durchaus noch anderen Zwischenzuständen aus. So befindet sich Karl Roßmann auch zwischen einem Erinnern und Vergessen und somit in einem Spannungsfeld von Zeit und Raum. Auf die Untersuchung des Verhältnisses dieser Konzepte und ihrer Ver-knüpfung mit dem Begriff der Verschollenheit ist diese Arbeit ausgerichtet. Über-prüft werden soll also im Folgenden die These, ob Kafkas paradoxe Zeit- und Raum-struktur zwangsläufig zum Verschellen des Charakters führt und inwieweit dies am Text belegt werden kann. Dazu wird zuerst das Erinnern mit der Zeitstruktur des Romans in Verbindung gebracht, wobei der Fokus immer auf dem Begriff der Ver-schollenheit liegt. Anschließend sollen verschiedene Raummodelle des Romans und ihre Verbindung mit dem Begriff des Vergessens untersucht werden. Entsprechende Textstellen sollen auch hier zur Verdeutlichung analysiert werden. Danach soll es einen Versuch der Zusammenführung der beiden Themengebiete geben, um so die anfangs aufgestellte These hinsichtlich Kafkas paradoxer Zeit-und Raumordnung zu beweisen oder aber auch zu widerlegen. Abschließend folgt ein kurzes Resümee.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung – Der Begriff Verschollenheit
- 2. Das zeitliche Erinnern
- 2.1. Die verschiedenen Zeiteinheiten
- 2.2. Das Erinnern der Herkunft
- 2.3. Das kulturelle Dispositiv des Vergessens – ein Nicht-Erinnern
- 3. Das räumliche Vergessen
- 3.1. Raummodelle
- 3.2. Das rhetorische Dispositiv des Vergessens
- 4. Das Zusammenspiel von Zeit und Raum
- 5. Abschließende Bemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Zeit und Raum in Franz Kafkas „Der Verschollene“ und deren Zusammenhang mit dem Begriff der Verschollenheit. Es wird analysiert, inwieweit Kafkas paradoxe Zeit- und Raumstruktur zum Verschwinden des Protagonisten beiträgt.
- Der Begriff der Verschollenheit in Kafkas Roman im Vergleich zum juristischen Verständnis.
- Die komplexe Zeitstruktur des Romans und die Darstellung von Erinnerung.
- Die verschiedenen Raummodelle und ihre Bedeutung für die Interpretation.
- Das Zusammenspiel von Zeit und Raum als Gestaltungsmittel.
- Die Frage, ob Kafkas paradoxe Struktur zwangsläufig zur „Verschollenheit“ des Protagonisten führt.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung – Der Begriff Verschollenheit führt in die Thematik ein und definiert den Begriff „Verschollenheit“ im juristischen und literarischen Kontext. Es wird die zentrale Forschungsfrage formuliert: Führt Kafkas paradoxe Zeit- und Raumstruktur zur Verschollenheit des Protagonisten?
Kapitel 2: Das zeitliche Erinnern untersucht die komplexe Zeitstruktur des Romans und die Rolle von Erinnerung. Es wird die These der "prinzipiellen Aussparung vergangenheitsorientierter Perspektiven" in Kafkas Werk diskutiert und anhand von Textbeispielen analysiert. Die verschiedenen Zeitebenen werden im Detail betrachtet.
Kapitel 3: Das räumliche Vergessen analysiert die Raummodelle im Roman und ihre Verbindung zum Vergessen. Verschiedene räumliche Darstellungen werden untersucht und ihre Bedeutung im Kontext des Gesamtwerks erläutert.
Schlüsselwörter
Franz Kafka, Der Verschollene, Verschollenheit, Zeitstruktur, Raummodelle, Erinnerung, Vergessen, Paradoxie, literarische Analyse, Zeit und Raum.
- Arbeit zitieren
- Susann Dannhauer (Autor:in), 2010, Paradoxe Zeit- und Raumordnung in Franz Kafkas „Der Verschollene“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187546