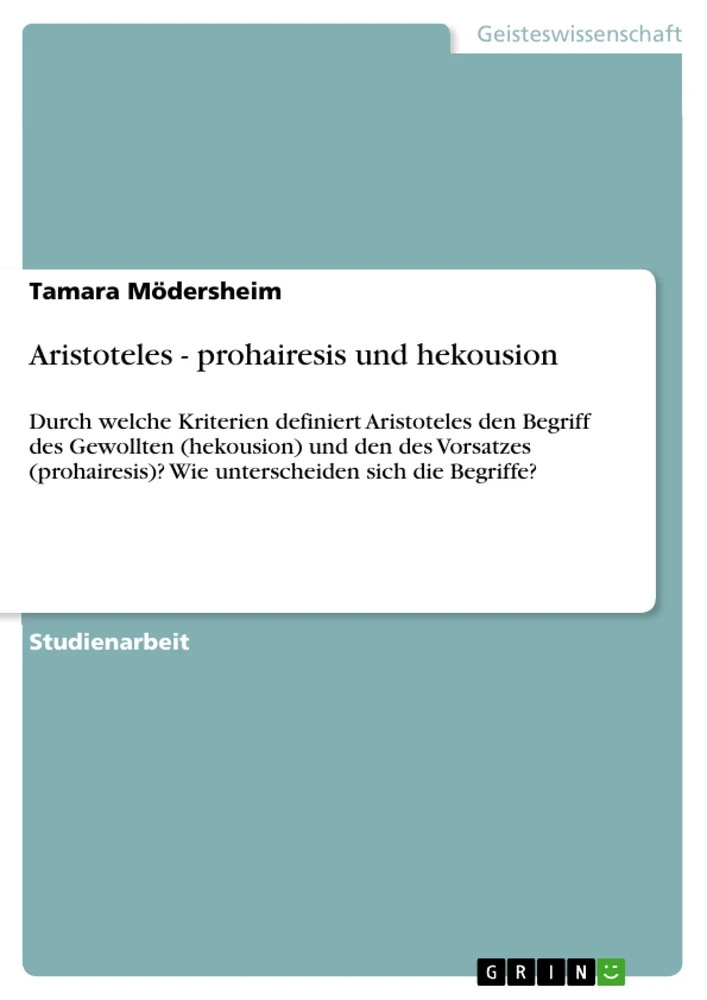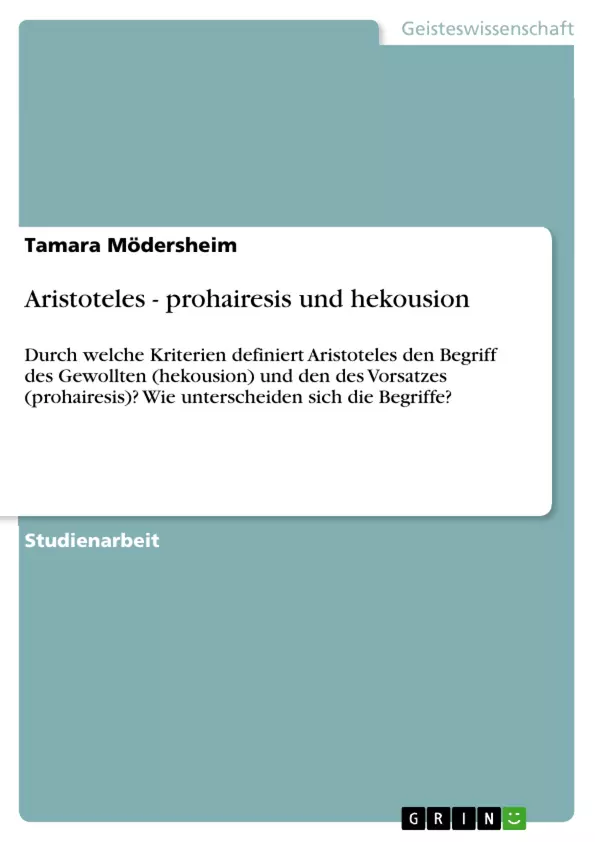Jeder Mensch führt jeden Tag eine Reihe von Handlungen aus. Meist welche über die er sich keine Gedanken machen muss. Doch wenn man beginnt darüber nachzudenken, welche Handlung angebracht und moralisch richtig ist und welche nicht, überlegt man vielleicht auch wo der Ursprung für die eigene Handlung liegt. Man wird oft für seine Handlungen gelobt oder kritisiert, aber worauf basiert dieses Lob / diese Kritik?
Ich folge in meiner Hausarbeit weitgehend der Gliederung von Aristoteles, weil mir diese als sehr sinnvoll erscheint. Ich beginne also mit dem Begriff des Gewollten (hekousios) indem ich die Kriterien zu Zwang und Wissen einzeln abarbeite. Danach geht es um den Begriff des Vorsatzes und seine Abgrenzung. Zum Schluss werde ich das Gewollte (hekousios) und den Vorsatz (prohairesis) vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten
- Der Begriff des Gewollten (hekousios)
- Unterscheidung zw. gewollten u. ungewollten Handlungen
- Ungewolltes Handeln durch Zwang
- Gemischte Handlungen
- Tadel und Lob
- Erzwungenes Verhalten
- Handeln gegen das Wollen und ohne das Wollen
- Der Begriff des Vorsatzes (prohairesis)
- Abgrenzung des Vorsatzes von verwandten Phänomenen
- Rolle der Überlegung (boule)
- Bestimmung des Vorsatzes
- Der Begriff des Gewollten (hekousios)
- Unterscheidung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem menschlichen Handeln und untersucht die Kriterien für gewollte und ungewollte Handlungen. Sie analysiert den Begriff des "Gewollten" (hekousios) und des "Vorsatzes" (prohairesis) im Kontext der aristotelischen Philosophie.
- Unterscheidung zwischen gewollten und ungewollten Handlungen
- Der Einfluss von Zwang auf das Handeln
- Die Rolle der Handlungssituation und des Ziels bei gemischten Handlungen
- Die Verbindung von Handeln, Tugend (arete) und Lob/Tadel
- Die Abgrenzung des Vorsatzes (prohairesis) von verwandten Phänomenen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor, die sich mit der Unterscheidung zwischen gewollten und ungewollten Handlungen beschäftigt. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Unterscheidung für die Beurteilung von Handlungen im Hinblick auf Tugendhaftigkeit und moralische Richtigkeit relevant ist. Die Hausarbeit orientiert sich an der Gliederung des Aristoteles und fokussiert zunächst auf den Begriff des Gewollten (hekousios).
Begrifflichkeiten
Der Begriff des Gewollten (hekousios)
Aristoteles verbindet das menschliche Handeln mit Tugend (arete) und betont, dass Lob und Tadel nur für gewollte Handlungen gelten. Die Unterscheidung zwischen gewollten und ungewollten Handlungen wird mit Beispielen veranschaulicht.
Ungewolltes Handeln durch Zwang
Zwang wird als eine äußere Bewegungsursache definiert, die den Handelnden oder Erleidenden vollständig kontrolliert. Handlungen, die aus Furcht vor größeren Übeln ausgeführt werden, werden nicht als erzwungen betrachtet, da der Handelnde eine gewisse Handlungsfreiheit behält.
Gemischte Handlungen
Gemischte Handlungen sind Handlungen, die sowohl gewollte als auch ungewollte Aspekte aufweisen. Die Handlungssituation und das Ziel der Handlung spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung, ob eine Handlung als gewollt oder ungewollt anzusehen ist.
Tadel und Lob
Ungewollte Handlungen können nicht gelobt oder getadelt werden, während gewollte Handlungen mit Lob oder Tadel bewertet werden. Lob erhält man für edle Handlungen, die auch Opfer fordern können. Tadel erhält man für niedere Handlungen, die keine edlen Ziele verfolgen. Es gibt auch Fälle, in denen Verzeihung angebracht ist, wenn eine niedere Handlung unter unzumutbaren Bedingungen ausgeführt wird.
Erzwungenes Verhalten
Erzwungenes Verhalten wird weiter beleuchtet und der Fokus liegt auf Handlungen, die zwar vom Handelnden selbst ausgeführt werden, aber aufgrund anderer Dinge gewählt werden. Das Beispiel des Güterabwerfens von einem Schiff während eines Sturms wird wieder aufgegriffen, um die Komplexität der Unterscheidung zwischen gewollten und ungewollten Handlungen zu verdeutlichen.
Der Begriff des Vorsatzes (prohairesis)
Aristoteles trennt den Vorsatz (prohairesis) von verwandten Phänomenen wie der Überlegung (boule) und untersucht die Rolle der Überlegung bei der Bildung des Vorsatzes. Es wird auf die Bestimmung des Vorsatzes eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die zentralen Konzepte des gewollten und ungewollten Handelns, der Tugend (arete), des Zwangs, der Handlungssituation und des Ziels (telos). Sie untersucht den Zusammenhang zwischen Handeln, Tugend und Lob/Tadel sowie den Begriff des Vorsatzes (prohairesis).
- Arbeit zitieren
- Tamara Mödersheim (Autor:in), 2011, Aristoteles - prohairesis und hekousion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187593