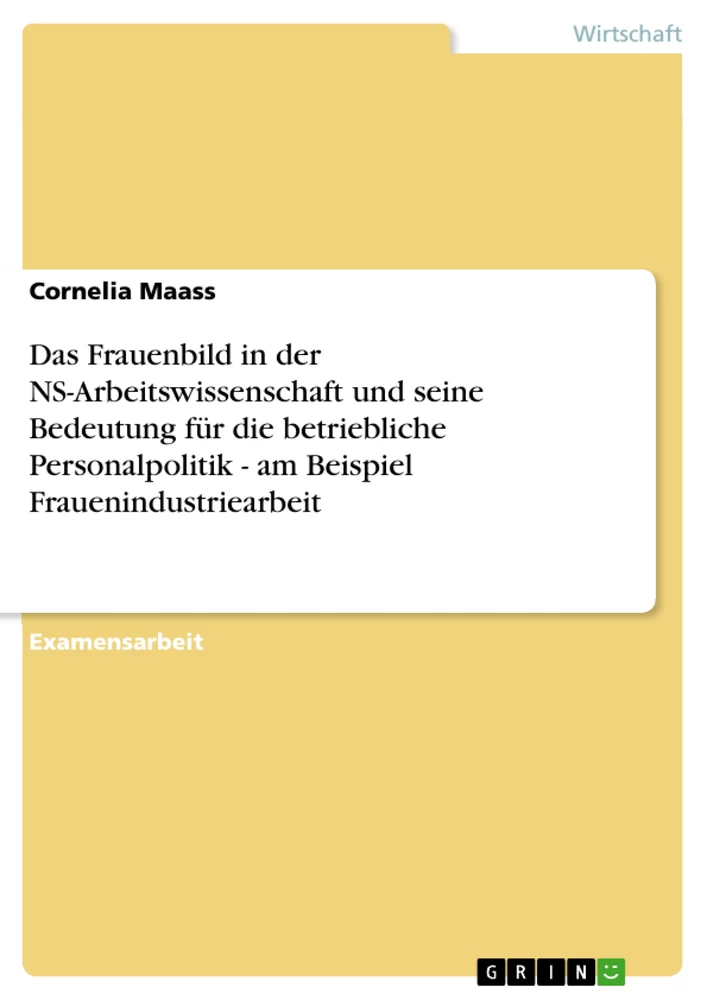Ich möchte mich in dieser Arbeit der Frage widmen, welche Bedeutung das Frauenbild der nationalsozialistischen Arbeitswissenschaft für die betriebliche Personalpolitik in der Industrie hatte. Die ArbeitswissenschaftlerInnen setzten bestimmte physische und psychische Merkmale von Frauen voraus, folgerten, daß Frauen sich von Männern auch beim Ausführen von Arbeitsprozessen und in ihrer Einstellung zur Erwerbstätigkeit unterschieden und leiteten daraus schließlich Hinweise für einen ,frauengerechten` Arbeitseinsatz in der Industrie ab. Des weiteren wurden Überlegungen zur Bewertung und Entlohnung der in der Industrie tätigen Frauen angestellt. Ich möchte anhand einiger Bereiche betrieblicher Personalpolitik überprüfen, ob ein ,wesensgemäßer` Fraueneinsatz in der Industrie zustande kam und wenn ja, wodurch er sich auszeichnete.
Da beschäftigungspolitische Maßnahmen und die Arbeitsgesetzgebung Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die Personalpolitik in den Fabriken darstellten, werden sie in meine Betrachtungen einbezogen. Durch beschäftigungspolitische Maßnahmen versuchte das Regime, die Erwerbstätigkeit von Frauen zu lenken, und die Arbeitsbedingungen in den Industriebetrieben wurden durch Arbeitsschutzbestimmungen beeinflußt.
Die Maßnahmen zur Steuerung des Arbeitsmarktes wiederum schienen teilweise das nationalsozialistische Frauenbild widerzuspiegeln: So waren z.B. in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft Bemühungen zu erkennen, Frauen von ihren Arbeitsplätzen zu verdrängen, und im Jahr 1942 wurde ein umfassendes Mutterschutzgesetz erlassen.
Frauenindustriearbeit im Nationalsozialismus wird in dieser Arbeit unter drei verschiedenen Gesichtspunkten thematisiert, die gleichzeitig die verschiedenen Ebenen der Arbeit darstellen: Es handelt sich erstens um die ideologische und arbeitswissenschaftliche, zweitens um die beschäftigungspolitische und gesetzliche und drittens um die betriebliche, personalpolitische Ebene. Ich möchte die Zusammenhänge, Übereinstimmungen, Widersprüche und Interessenkonflikte sowohl innerhalb der als auch zwischen den einzelnen Ebenen deutlich machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Frauenbild in der NS-Ideologie und in der NS-Arbeitswissenschaft
- Das Frauenbild in der NS-Ideologie
- Vorbemerkungen
- Die, Deutsche Frau als Mutter
- Die, Deutsche Frau - Der, Deutsche Mann – Die, Deutsche' Ehe im Dienst der, Deutschen Volksgemeinschaft
- Grundsätzliches zur, Deutschen Frau und Erwerbsarbeit
- Das Bild der Industriearbeiterin in der Nationalsozialistischen Arbeitswissenschaft
- Vorbemerkungen
- „Mütterlichkeit‘ und die Bindung von Frauen an die Industriearbeit – Körperliche und seelische Merkmale
- Und die spezielle Eignung der Frauen zur Fließbandarbeit
- Der Entgeltpolitische Diskurs zur Frauenindustriearbeit
- Das Frauenbild in der NS-Ideologie
- Beschäftigungspolitsche und gesetzliche Rahmenbedingungen für die betriebliche Personalpolitik
- Nationalsozialistische Frauenbeschäftigungpolitik
- Vorbemerkungen
- Maßnahmen, um Frauen vom Arbeitsplatz zu verdrängen
- Die, Kampagne gegen das Doppelverdienertum
- Das, Ehestandsdarlehen
- Die Gewährung von Kinderbeihilfen und steuerpolitische Maßnahmen
- Die Entwicklung der Frauenbeschäftigung von der, Machtergreifungʻ bis zum, Vierjahresplan'
- Maßnahmen, um Frauen für Rüstung und Kriegswirtschaft zu mobilisieren
- Propaganda zur Förderung der Berufstätigkeit von Frauen
- Meldepflicht und Dienstverpflichtung zur Steigerung der Frauenbeschäftigung
- Die Entwicklung der Frauenbeschäftigung während des Zweiten Weltkrieges
- Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen
- Die Gründung der DAF und Veränderungen in der Arbeitsgesetzgebung
- Arbeitszeiten und Beschäftigungsverbote für Frauen
- Das Mutterschutzgesetz von 1942
- Nationalsozialistische Frauenbeschäftigungpolitik
- Personalpolitik in Industriebetrieben
- Vorbemerkungen
- ,Wesensgemäße Tätigkeiten, Deutscher' Industriearbeiterinnen auf, Frauengerechten Arbeitsplätzen
- Einarbeitung und Führung von Frauen
- Die Entlohnung der Industriearbeiterinnen
- Die Betreuung, Deutscher Frauen mittels betrieblicher Sozialleistungen
- Die Arbeitsbedingungen für Industriearbeiterinnen und ihre Folgen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Frauenbildes der nationalsozialistischen Arbeitswissenschaft für die betriebliche Personalpolitik in der deutschen Industrie während der NS-Zeit. Sie analysiert, wie die Arbeitswissenschaft das Frauenbild in ihre Ansätze zur Arbeitsgestaltung integrierte und welche Auswirkungen dies auf die Praxis der Personalpolitik hatte.
- Die Rolle des Frauenbildes in der NS-Ideologie und seine Einbindung in die Arbeitswissenschaft
- Die spezifischen Anforderungen und Merkmale, die die Arbeitswissenschaft Frauen in der Industriearbeit zuschrieb
- Die Auswirkungen dieser Ideologie auf die beschäftigungspolitischen Maßnahmen des Regimes und die Arbeitsgesetzgebung
- Die konkreten Beispiele der Personalpolitik in Industriebetrieben, die den Einfluss des Frauenbildes auf die Praxis demonstrieren
- Die Widersprüche zwischen der idealisierten Rolle der Frau in der NS-Ideologie und der tatsächlichen Notwendigkeit der Frauenindustriearbeit in der Kriegswirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Analyse des Frauenbildes in der NS-Ideologie und seiner Bedeutung für die Arbeitswissenschaft. Es wird gezeigt, wie Frauen in der NS-Propaganda als „Mutter“ und Hüterin des „deutschen“ Lebens definiert wurden, während ihre Rolle in der Erwerbsarbeit als widersprüchlich dargestellt wurde. Kapitel 2 beleuchtet, wie diese Widersprüche in der Arbeitswissenschaft aufgelöst wurden. Die Arbeitswissenschaft argumentierte, dass Frauen aufgrund ihrer körperlichen und psychischen Eigenschaften besonders gut für bestimmte Aufgaben in der Industrie geeignet seien, insbesondere für die Fließbandarbeit. Kapitel 3 analysiert die beschäftigungspolitischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, die die Personalpolitik in den Fabriken prägten. Es werden Maßnahmen des Regimes zur Lenkung der weiblichen Erwerbstätigkeit, sowie die Entwicklung des Arbeitsrechts während der NS-Zeit betrachtet, insbesondere im Hinblick auf Frauen. Kapitel 4 beleuchtet die konkrete Personalpolitik in Industriebetrieben und analysiert, wie das Frauenbild in der Praxis umgesetzt wurde. Dabei werden Bereiche wie die Auswahl und Einarbeitung von Frauen, ihre Entlohnung und die betriebliche Sozialarbeit betrachtet. Der Fokus liegt auf der Frage, ob und wie der „wesensgemäße“ Einsatz der Frau in der Industrie realisiert wurde und welche Auswirkungen diese Praxis auf die Arbeitsbedingungen von Frauen hatte.
Schlüsselwörter
Frauenbild, NS-Ideologie, Arbeitswissenschaft, Frauenindustriearbeit, Personalpolitik, Beschäftigungspolitik, Arbeitsgesetzgebung, Kriegswirtschaft, Arbeitsbedingungen, Entlohnung, Sozialleistungen, Mutterschutz.
Häufig gestellte Fragen
Welches Frauenbild herrschte in der NS-Ideologie vor?
Die Frau wurde primär als „Mutter“ und Hüterin der „Volksgemeinschaft“ definiert, deren Hauptaufgabe im Dienst der Familie und des Staates lag.
Wie bewertete die NS-Arbeitswissenschaft Frauen in der Industrie?
Arbeitswissenschaftler schrieben Frauen spezifische physische und psychische Merkmale zu, die sie angeblich besonders für monotone Tätigkeiten wie die Fließbandarbeit prädestinierten.
Was war die Kampagne gegen das „Doppelverdienertum“?
In den ersten Jahren der NS-Herrschaft gab es Bestrebungen, Frauen vom Arbeitsmarkt zu verdrängen, um Arbeitsplätze für Männer frei zu machen, sofern das Familieneinkommen gesichert schien.
Warum änderte sich die Frauenbeschäftigungspolitik im Laufe der Zeit?
Mit Beginn des Vierjahresplans und besonders während des Zweiten Weltkriegs erforderte die Kriegswirtschaft eine massive Mobilisierung von Frauen für die Rüstungsindustrie.
Was beinhaltete das Mutterschutzgesetz von 1942?
Es war ein umfassendes Gesetz, das den Arbeitsschutz für werdende Mütter regelte, jedoch auch dem Ziel diente, die Arbeitskraft der Frauen im Sinne der NS-Bevölkerungspolitik zu erhalten.
Wie sah die Entlohnung von Industriearbeiterinnen aus?
Trotz ihrer wichtigen Rolle in der Kriegswirtschaft wurden Frauen oft schlechter entlohnt als Männer, was durch ideologische Annahmen über ihre geringere Leistungsfähigkeit gerechtfertigt wurde.
- Arbeit zitieren
- Cornelia Maass (Autor:in), 1999, Das Frauenbild in der NS-Arbeitswissenschaft und seine Bedeutung für die betriebliche Personalpolitik - am Beispiel Frauenindustriearbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1876